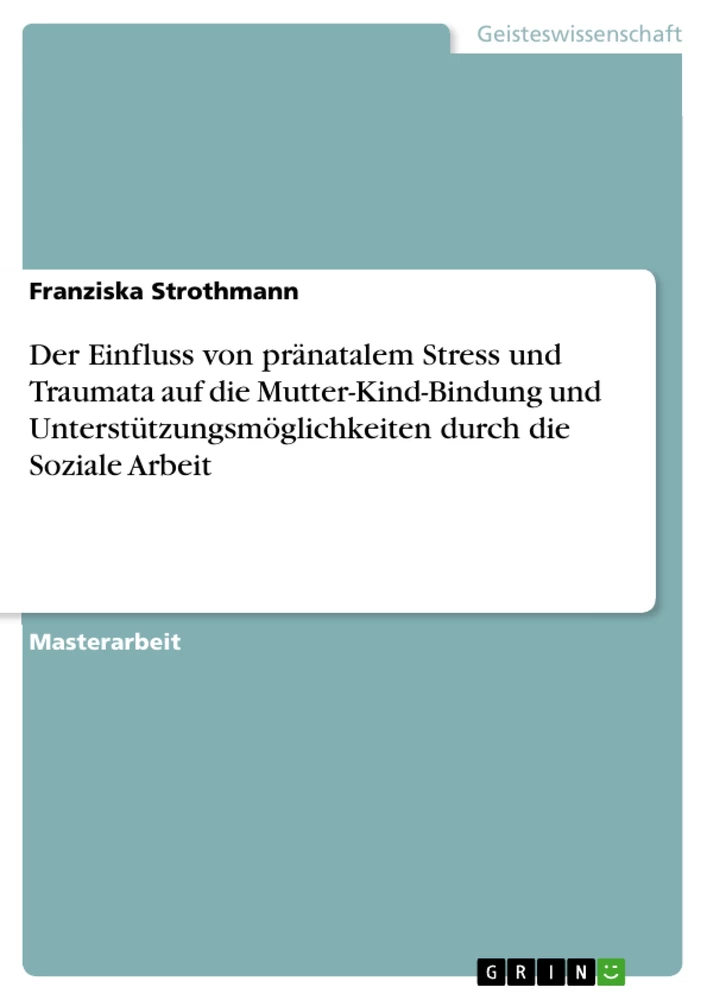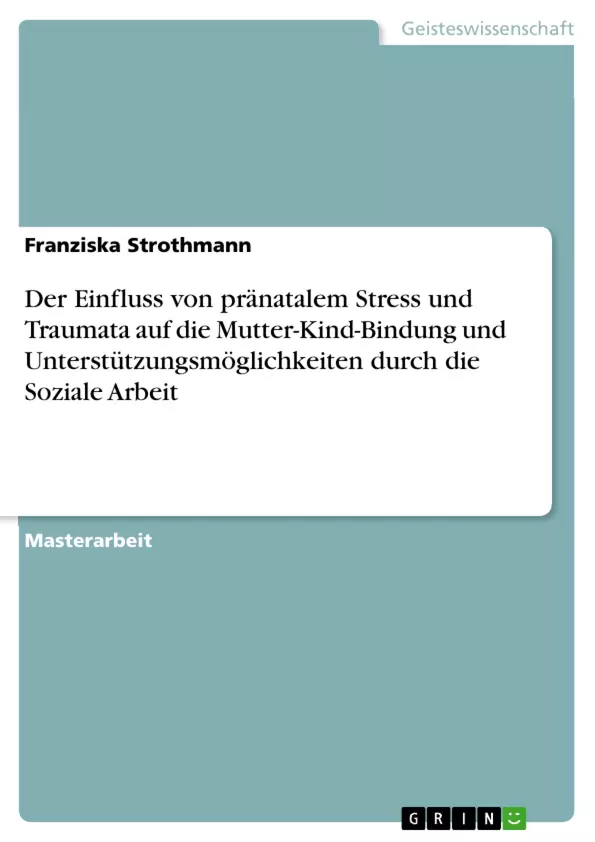Die vorliegende Masterarbeit gibt einen Überblick über pränatalen Stress und Traumata und wie sich diese auf das ungeborene Kind sowie die Mutter-Kind-Bindung auswirken. Im Zuge dessen werden verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten durch die Soziale Arbeit aufgezeigt. Es wird zunächst ein Überblick über die pränatale Entwicklung geboten. Um die früheste Entwicklungsphase eines Menschen zu verstehen, ist ein biologisches Grundverständnis nötig, weshalb von der Befruchtung bis hin zu den ersten Lernerfahrungen die wesentlichen Entwicklungsschritte dargestellt werden. Daraufhin werden die Grundlagen der Bindungsforschung mit dem Fokus auf die pränatale Bindung erläutert, da sich gezeigt hat, dass die Mutter-Kind-Bindung bereits in der pränatalen Phase beginnt und entscheidend durch Erfahrungen während der Schwangerschaft beeinflusst wird. So können äußere schädigende Einflüsse wie Toxine, Über- oder Unterernährung sowie überlebte Abtreibungsversuche, aber auch innere schädigende Einflüsse wie mütterliche psychische Belastungen und negative Einstellungen diese sensible Entwicklungsphase sowie die Mutter-Kind-Bindung erheblich beeinträchtigen.
Aus diesem Grund werden innerhalb dieser Masterarbeit unterschiedliche Präventions- und Interventionsmöglichkeiten, vor allem durch die Soziale Arbeit, aufgezeigt. Hierzu zählen neben dem Jugendamt und dem Allgemeinen Sozialen Dienst die Frühen Hilfen, Schwangerschaft- und Suchtberatungsstellen, verschiedene Angebote aus der Traumapädagogik sowie die Frühinterventionsprogramme SAFE und STEEP. Vertieft werden die theoretischen Erkenntnisse und Darstellungen anhand von empirischer, qualitativer Forschung. Hierzu wurden fünf Expertinneninterviews geführt.
Einige schwangere Frauen fallen durch das Raster des präventiven und intervenierenden Versorgungsangebot, dies liegt zum einen an der Unkenntnis über die bestehenden Angebote und zum anderen an der Angst vor dem Jugendamt, welches häufig mit dem gefürchteten Sorgerechtsentzug verbunden wird. Zudem sollte die Vernetzung und Kooperation zwischen der Sozialen Arbeit und dem Gesundheitswesen, vor allem Gynäkolog:innen vertieft und gefördert werden, da dies eine wichtige Anlaufstelle für schwangere Frauen darstellt. Daher wird in dieser Arbeit die Relevanz einer universellen, niederschwelligen und flächendeckenden Prävention und Intervention besonders hervorgehoben, um eine professionelle und bedarfsgerechte Unterstützung durch die Soziale Arbeit gewährleisten zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Theoretischer Teil
- Einleitung
- Anlass und Ausgangssituation
- Untersuchungsgegenstand und forschungsleitende Frage
- Aufbau und Methoden der Arbeit
- Relevanz einer pränatalen Psychologie
- Pränatale Entwicklung
- Die Befruchtung
- Neuronale Entwicklungsprozesse
- Erleben und Verhalten des ungeborenen Kindes
- Bewegung
- Berührung
- Riechen und Schmecken
- Hören
- Sehen
- Erste Lernerfahrungen
- Die pränatale Bindung
- Grundlagen der Bindungsforschung
- Forschungsgeschichte der pränatalen Bindung
- Die Entwicklung der pränatalen Bindung
- Pränatale Bindungsentwicklung
- Pränatale Mutter-Kind-Interaktion
- Pränataler Stress und Traumata
- Begriffsbestimmungen Stress und Trauma
- Stress und Traumata in der Schwangerschaft
- Äußere schädigende Einflüsse
- Toxische Einflüsse
- Unter-/Überernährung
- Überlebte Abtreibungsversuche
- Innere schädigende Einflüsse
- Mütterliche psychische Belastungen
- Negative mütterliche Einstellung
- Auswirkungen von pränatalem Stress und Traumata
- Fetale Programmierung
- Epigenetik
- Transgenerationale Weitergabe
- Auswirkungen auf die Mutter-Kind-Bindung
- Bindungsstörungen
- Auswirkungen der Bindungsstörungen auf das Rechtshirn
- Spätfolgen von pränatalen Bindungsstörungen
- Prävention und Intervention von pränatalem Stress und Traumata
- Darstellung ausgewählter Präventions- und Interventionsmaßnahmen
- Prä- und postnatale Psychotherapie
- BabyCare
- Mutter-Kind-Bindungsanalyse
- Emotionale Erste Hilfe © (EEH)
- Präventions- und Interventionsmaßnahmen der Sozialen Arbeit
- Der Allgemeine Soziale Dienst
- Frühe Hilfen
- Familienhebammen
- Schwangerschaftsberatungsstellen
- Suchtberatungsstellen
- Präventionsprogramm SAFE®
- Interventionsprogramm STEEPTM
- Traumapädagogik
- Zusammenfassung des theoretischen Teils
- Empirischer Teil
- Methode
- Zielsetzung der empirischen Untersuchung
- Methode Vorgehensweise
- Leitfadengestütztes Expert:inneninterview
- Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring
- Akquise und Vorstellung der Interviewpartner:innen
- Interviewsetting und -durchführung
- Darstellung der wesentlichen Ergebnisse
- Persönliche und institutionelle Informationen
- Präventions- und Interventionsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit
- Relevanz für die Soziale Arbeit
- Kritik und Zukunftsausblick
- Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse
- Diskussion
- Diskussionsansatz
- Handlungsempfehlungen für die Praxis
- Methodenkritik
- Fazit
- Die Bedeutung pränataler Erfahrungen für die Entwicklung des Kindes
- Die Auswirkungen von pränatalem Stress und Traumata auf die Mutter-Kind-Bindung
- Die Rolle der Sozialen Arbeit bei der Prävention und Intervention von pränatalem Stress und Traumata
- Die Bedeutung von frühen Hilfen und Familienförderung in der Sozialen Arbeit
- Die Notwendigkeit einer interdisziplinären Zusammenarbeit im Kontext von pränatalem Stress und Traumata
- Einleitung: Diese Kapitel stellt den Anlass und die Ausgangssituation der Arbeit dar. Es wird der Untersuchungsgegenstand und die forschungsleitende Frage definiert und der Aufbau der Arbeit erläutert.
- Relevanz einer pränatalen Psychologie: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung der pränatalen Psychologie für die Entwicklung des Kindes und erläutert die Notwendigkeit, den Einfluss pränataler Erfahrungen auf die kindliche Entwicklung zu berücksichtigen.
- Pränatale Entwicklung: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die pränatale Entwicklung, inklusive der Befruchtung, der neuronalen Entwicklungsprozesse und der verschiedenen Entwicklungsstufen des ungeborenen Kindes.
- Die pränatale Bindung: Dieses Kapitel behandelt die Grundlagen der Bindungsforschung und geht auf die Entwicklung der pränatalen Bindung ein. Es werden die pränatale Bindungsentwicklung und die pränatale Mutter-Kind-Interaktion diskutiert.
- Pränataler Stress und Traumata: Dieses Kapitel definiert die Begriffe Stress und Trauma und untersucht deren Auswirkungen in der Schwangerschaft. Es wird die Unterscheidung zwischen äußeren und inneren schädigenden Einflüssen getroffen und die Auswirkungen pränatalen Stresses und Traumata auf die Entwicklung des Kindes beleuchtet.
- Prävention und Intervention von pränatalem Stress und Traumata: Dieses Kapitel stellt verschiedene Präventions- und Interventionsmaßnahmen vor, die zur Unterstützung von Familien während der Schwangerschaft und nach der Geburt eingesetzt werden können. Es werden verschiedene Ansätze aus der Psychologie, der Sozialen Arbeit und anderen Disziplinen vorgestellt.
- Zusammenfassung des theoretischen Teils: Dieses Kapitel fasst die wichtigsten Erkenntnisse des theoretischen Teils der Arbeit zusammen und bietet eine Brücke zum empirischen Teil.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht den Einfluss pränataler Stresserfahrungen und Traumata auf die Mutter-Kind-Bindung und deren Bedeutung für die Soziale Arbeit. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für die Auswirkungen pränatalen Stresses und Traumata auf die Entwicklung des Kindes zu gewinnen und die Rolle der Sozialen Arbeit bei der Prävention und Intervention in diesem Kontext zu beleuchten.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Pränataler Stress, pränatale Traumata, Mutter-Kind-Bindung, Bindungsstörungen, Entwicklung des Kindes, Soziale Arbeit, Prävention, Intervention, Frühe Hilfen, Familienförderung, interdisziplinäre Zusammenarbeit.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst pränataler Stress das ungeborene Kind?
Pränataler Stress kann zu fetaler Programmierung und epigenetischen Veränderungen führen, die das Risiko für spätere psychische und physische Erkrankungen erhöhen.
Wann beginnt die Mutter-Kind-Bindung?
Die Bindung beginnt bereits in der pränatalen Phase während der Schwangerschaft und wird durch die Einstellung und Belastung der Mutter beeinflusst.
Welche Unterstützung bietet die Soziale Arbeit für Schwangere?
Unterstützung erfolgt durch Frühe Hilfen, Schwangerschaftsberatungsstellen, Familienhebammen und Programme wie SAFE oder STEEP.
Warum nehmen manche Frauen keine Hilfe in Anspruch?
Häufige Gründe sind Unkenntnis über Angebote oder die Angst vor dem Jugendamt und einem möglichen Sorgerechtsentzug.
Was sind "innere schädigende Einflüsse" in der Schwangerschaft?
Dazu zählen mütterliche psychische Belastungen, Traumata und eine negative Einstellung zur Schwangerschaft oder zum Kind.
- Arbeit zitieren
- Franziska Strothmann (Autor:in), 2022, Der Einfluss von pränatalem Stress und Traumata auf die Mutter-Kind-Bindung und Unterstützungsmöglichkeiten durch die Soziale Arbeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1292733