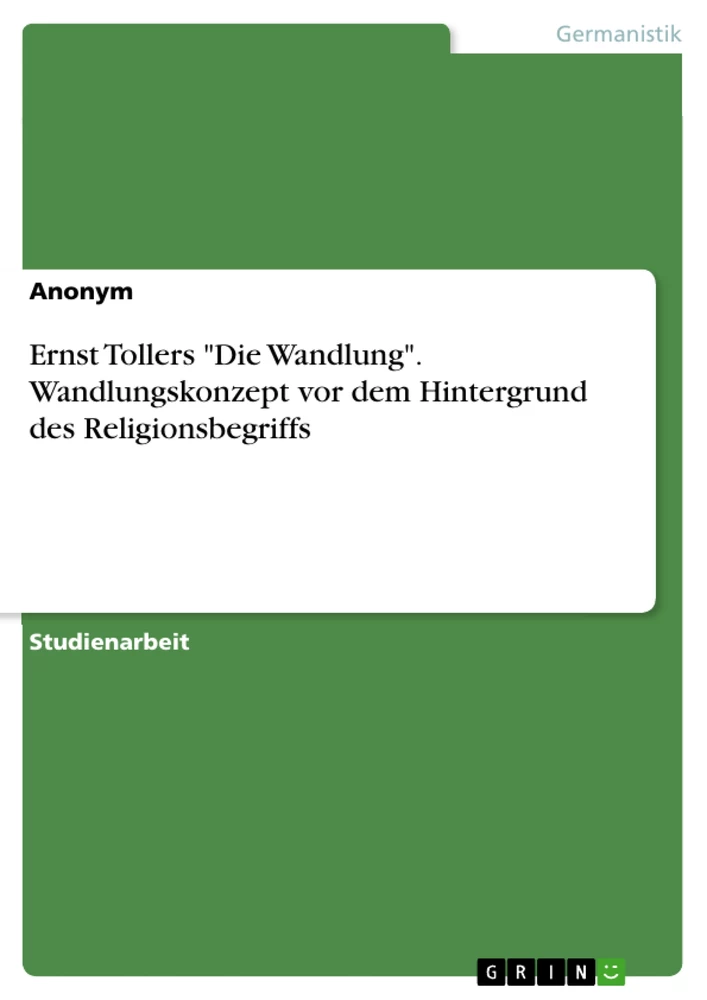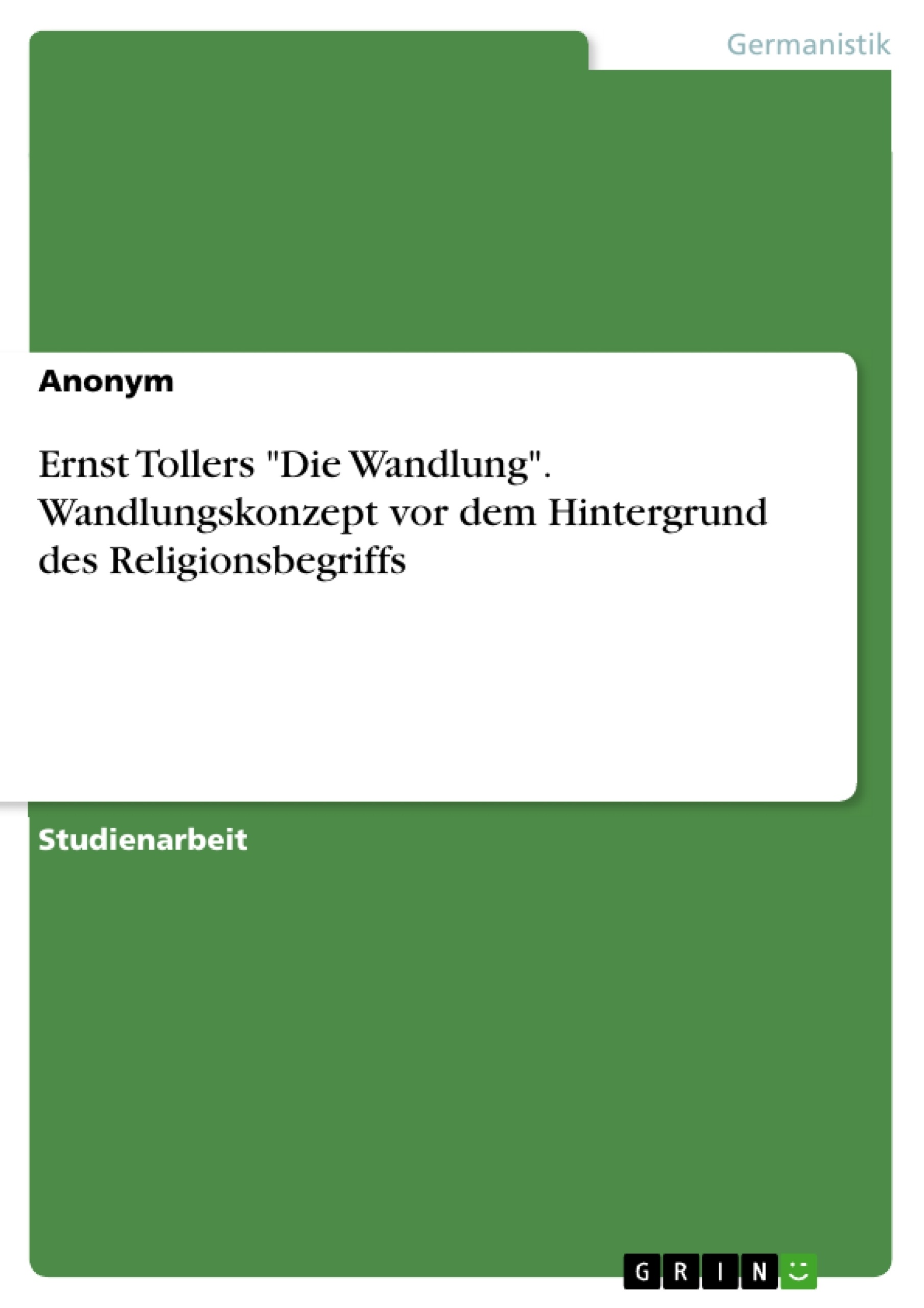Ziel dieser Arbeit ist, das Wandlungskonzept und den Religionsbegriff in Ernst Tollers Drama "Die Wandlung" zu analysieren und vergleichend gegenüberzustellen. Im Verlauf der Arbeit sollen dabei zunächst der Begriff der Wandlung und die damit verbundenen Konnotationen definiert werden.
Darauf aufbauend wird ausgehend von der Selbstentfremdung des Protagonisten Friedrich der innere Wandlungsprozess untersucht, der am Ende des Dramas eine Kollektivwirkung entfaltet. Anschließend soll die Aufrüttelung, die gleich zu Beginn des Dramas einen religiösen Kontext herstellt, kurz erläutert werden und darauf basierend die Begriffsentwicklung anhand der Figur des Ahasver und der Kreuzsymbolik aufgezeigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gegenüberstellung von Wandlungskonzept und Religionsbegriff
- Wandlungskonzept
- Begriffsbestimmung und Definition
- Selbstentfremdung und Zugehörigkeitsproblematik
- Innerer Wandlungsprozess mit Kollektivwirkung
- Religionsbegriff
- Aufschlüsselung der „Aufrüttelung”
- Begriffsentwicklung
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das Wandlungskonzept und den Religionsbegriff in Ernst Tollers Drama „Die Wandlung“ und stellt sie vergleichend gegenüber. Dabei wird der Begriff der Wandlung definiert, der innere Wandlungsprozess des Protagonisten Friedrich untersucht und die „Aufrüttelung“ im religiösen Kontext erläutert. Die Entwicklung des Religionsbegriffs anhand der Figur des Ahasver und der Kreuzsymbolik wird ebenfalls aufgezeigt.
- Definition des Wandlungskonzepts und seiner Bedeutung
- Analyse des inneren Wandlungsprozesses von Friedrich
- Die Rolle der „Aufrüttelung“ in der religiösen Dimension des Dramas
- Entwicklung des Religionsbegriffs im Kontext der Figur des Ahasver und der Kreuzsymbolik
- Parallelen und Abweichungen zwischen Wandlungskonzept und Religionsbegriff
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Arbeit untersucht das Wandlungskonzept und den Religionsbegriff in Ernst Tollers Drama „Die Wandlung“. Sie definiert den Begriff der Wandlung und analysiert den inneren Wandlungsprozess des Protagonisten Friedrich, der am Ende des Dramas eine Kollektivwirkung entfaltet. Des Weiteren wird die „Aufrüttelung“ erläutert, die gleich zu Beginn des Dramas einen religiösen Kontext herstellt, und die Entwicklung des Religionsbegriffs anhand der Figur des Ahasver und der Kreuzsymbolik aufgezeigt.
Gegenüberstellung von Wandlungskonzept und Religionsbegriff
Wandlungskonzept
Begriffsbestimmung und Definition
Der religiöse Wandlungsbegriff ist eng mit den Begriffen der Transsubstantiation und der Eucharistie verknüpft. Die Wandlung ist die beim Abendmahl (Eucharistie) vollzogene Wandlung von Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi (Transsubstantiation).¹
Die Analyse von Wörterbüchern wie dem „Duden“, dem „Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache“ und dem „Wahrig - Deutsches Wörterbuch“ zeigt, dass der Begriff der Wandlung mit Begriffen wie Änderung, Erneuerung, Umbruch, Umgestaltung, Veränderung, Wechsel und Wende gebraucht wird. Diese Wandlung kann sich innerlich oder äußerlich vollziehen. Der Begriff der Wandlung umfasst „ein Vorher und ein Nachher“.²
Selbstentfremdung und Zugehörigkeitsproblematik
Das Wandlungskonzept wird in dieser Arbeit im Kontext der Selbstentfremdung des Protagonisten Friedrich untersucht.
Innerer Wandlungsprozess mit Kollektivwirkung
Die Arbeit analysiert den inneren Wandlungsprozess von Friedrich, der am Ende des Dramas eine Kollektivwirkung entfaltet.
Religionsbegriff
Aufschlüsselung der „Aufrüttelung”
Die Arbeit erläutert die „Aufrüttelung“, die gleich zu Beginn des Dramas einen religiösen Kontext herstellt.
Begriffsentwicklung
Die Arbeit untersucht die Entwicklung des Religionsbegriffs im Kontext der Figur des Ahasver und der Kreuzsymbolik.
Schlüsselwörter
Wandlung, Religionsbegriff, Transsubstantiation, Eucharistie, Selbstentfremdung, Zugehörigkeitsproblematik, innerer Wandlungsprozess, Kollektivwirkung, „Aufrüttelung“, Ahasver, Kreuzsymbolik, Expressionismus, Ernst Toller, Die Wandlung.
¹ Vgl. Peter-Matthias Gaede (Hg.): Religionen: Glauben, Riten, Heilige. A-Kir. Mannheim 2007 (GEO Themenlexikon, Bd. 15), S. 152 und Peter-Matthias Gaede (Hg.): Religionen: Glauben, Riten, Heilige. Kis-Z. Mannheim 2007 (GEO Themenlexikon, Bd. 16), S. 779 und 807f.
² Michael Ossar: Die jüdische messianische Tradition und Ernst Tollers Wandlung, in: Bayerdörfer, Hans-Peter und Grimm, Gunter E. (Hg.): Im Zeichen Hiobs. Jüdische Schriftsteller und deutsche Literatur im 20. Jahrhundert, Königstein 1985, S. 301.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Ernst Tollers Drama "Die Wandlung"?
Das Drama beschreibt den inneren Wandlungsprozess des Protagonisten Friedrich, der von Selbstentfremdung und Kriegserfahrung zu einer revolutionären, menschlichen Erneuerung findet.
Welche Rolle spielt der Religionsbegriff in dem Werk?
Toller nutzt religiöse Motive wie die Kreuzsymbolik und die Figur des Ahasver, um den ethischen und fast messianischen Charakter der menschlichen Wandlung zu unterstreichen.
Was versteht man unter dem Wandlungskonzept bei Toller?
Es bezeichnet eine tiefgreifende Erneuerung des Individuums, die über das Private hinausgeht und am Ende eine kollektive Wirkung auf die gesamte Gesellschaft entfaltet.
Wer ist die Figur des Ahasver im Drama?
Ahasver, der "ewige Jude", dient als Symbol für Heimatlosigkeit und die Suche nach Zugehörigkeit, was Friedrichs eigene Identitätskrise widerspiegelt.
Wie ist die Verbindung zwischen Wandlung und Transsubstantiation?
Toller entlehnt den Begriff der Wandlung dem religiösen Kontext der Eucharistie, deutet ihn aber säkular als Umgestaltung des Menschen zum "neuen Menschen" um.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2018, Ernst Tollers "Die Wandlung". Wandlungskonzept vor dem Hintergrund des Religionsbegriffs, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1294669