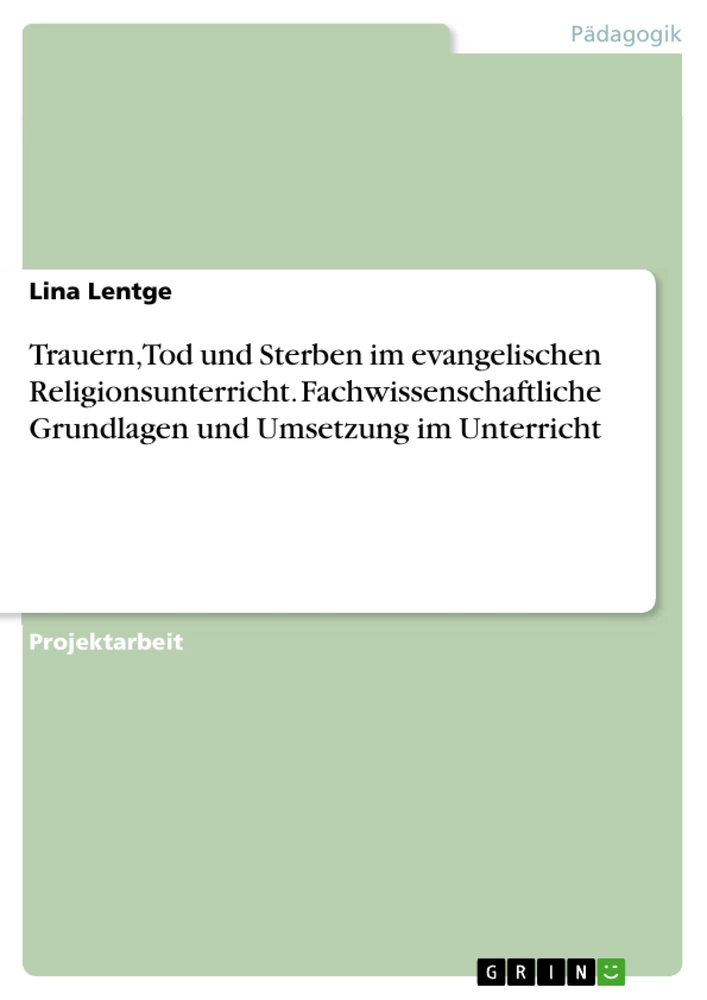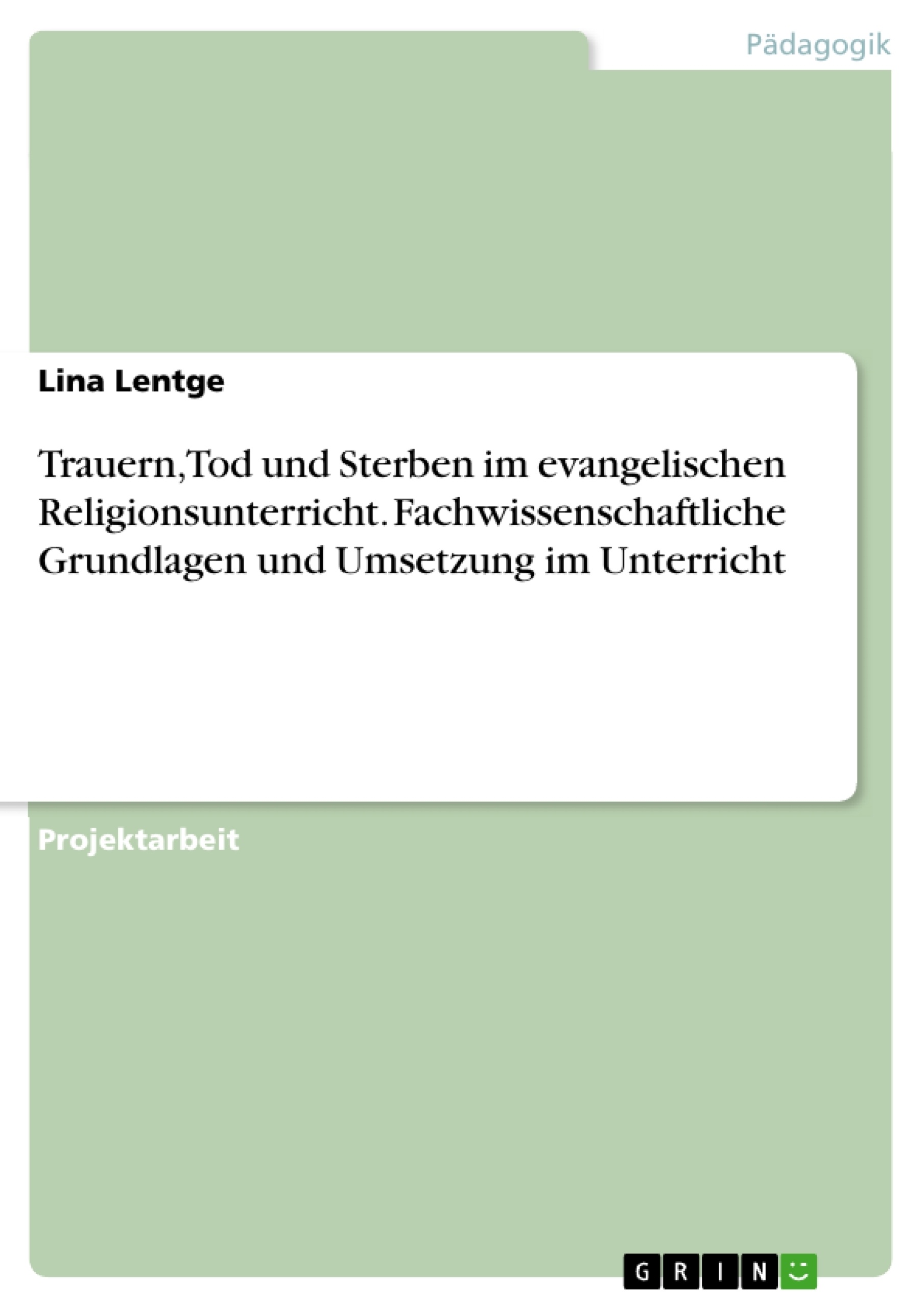Die Arbeit diskutiert die Thematik um Sterben, Tod und Trauer im Religionsunterricht und zeigt kurz und knapp die Methodenvielfalt zur Behandlung der Thematik auf. Die Thematik des Sterbens gilt es nicht nur als Teilthema von Tod und Jenseitsvorstellungen sondern auch als eigenständiges Thema zu behandeln. Das Sterben an sich, ist für Kinder und Jugendliche nicht erst dann präsent, wenn es in ihrem eigenen Umfeld geschieht. In verschiedenen Filmen, Serien, Hörspielen und Büchern wird das Sterben immer häufiger zum Thema. Die Problematik jedoch ist, dass mit den Kindern und Jugendlichen nur selten über das gesehene, gehörte oder gelesene gesprochen wird und sie ganz allein mit dem sensiblen Thema des Sterbens zurechtkommen müssen.
Innerhalb des Religionsunterrichts bietet es sich also an, auf die fiktionalen Sterbeerzählungen einzugehen, auf welche die Schüler:innen in ihrem Alltag treffen. Sie ermöglichen eine imaginative Annäherung an die vielen Facetten des Sterbeprozesses. Beispielhaft zu nennen sind Filme, wie "Oskar und die Dame in Rosa", "Wie man unsterblich wird" oder "Das Schicksal ist ein mieser Verräter".
Hinzu kommen Berichte realer Personen, die in den verschiedensten Sozialen Netzwerken von ihrem Prozess des Sterbens berichten. An erster Stelle steht jedoch die Berücksichtigung des jeweiligen Todesverständnis der Kinder und Jugendlichen. Mit dem Grundschulalter kommt erstmalig die Angst gegenüber dem Tod auf. Die Kinder verstehen erstmalig die Endgültigkeit des Todes. Sie trauern wie die Erwachsenen auch, nur wesentlich kürzer. Grund dafür, ist die Tatsache, dass Kinder in dem Alter sich eher auf das Leben im Augenblick fokussieren.
Inhaltsverzeichnis
- Gesamtreflexion der Lehrinhalte der Veranstaltungen
- Welche Lerninhalte haben meine fachlichen und didaktischen Kompetenzen erweitert?
- Welche Impulse für mein persönliches Studium wurden mir durch die Lehrveranstaltungen geliefert?
- An welchen Punkten sind Fragen offengeblieben?
- Vertiefende Auseinandersetzung mit der Thematik „Tod und Trauer im Religionsunterricht"
- Fachwissenschaftliche Grundlagen
- Sterben
- Suizid
- Trauer
- Fachdidaktik
- Sterben & Trauern
- Tod-Interreligiös
- Konkrete Umsetzungsansätze
- Fallbeispiel „Lisa ist gestorben"
- Unterrichtsanstätze zum Themenschwerpunkt für einen lang vorbereiteten Unterricht
- Fachwissenschaftliche Grundlagen
- Dokumentation: Meine Umsetzung eines Scrapbooks für den Religionsunterricht
- Quellenverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Portfolio reflektiert die Inhalte der Lehrveranstaltungen „Subjekte in religiösen Lernprozessen“ und „Lernprozesse im RU planen, gestalten, bewerten“ im Hinblick auf die Erweiterung fachlicher und didaktischer Kompetenzen, Impulse für das persönliche Studium sowie offene Fragen. Der Fokus liegt dabei auf der Vertiefung der Thematik „Tod und Trauer im Religionsunterricht“ und der praktischen Umsetzung eines Scrapbooks.
- Erweiterung der fachlichen und didaktischen Kompetenzen im Bereich des Religionsunterrichts
- Reflexion der eigenen Rolle als zukünftige Religionslehrerin
- Interreligiöse Kompetenzentwicklung
- Vertiefung der Thematik „Tod und Trauer“ im Religionsunterricht
- Praktische Umsetzung von Unterrichtskonzepten
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil des Portfolios behandelt die Gesamtreflexion der Lehrinhalte der beiden Veranstaltungen. Dabei werden die gewonnenen Erkenntnisse hinsichtlich der fachlichen und didaktischen Kompetenzen, die Impulse für das persönliche Studium sowie die offenen Fragen beleuchtet. Im zweiten Teil wird die Thematik „Tod und Trauer im Religionsunterricht“ vertieft. Hier werden die fachwissenschaftlichen Grundlagen, die fachdidaktischen Aspekte sowie konkrete Umsetzungsansätze vorgestellt. Der dritte Teil dokumentiert die praktische Umsetzung eines Scrapbooks für den Religionsunterricht.
Schlüsselwörter
Religionsunterricht, Subjekte in religiösen Lernprozessen, Lernprozesse planen, gestalten, bewerten, Tod und Trauer, Interreligiöse Kompetenz, Fachdidaktik, Scrapbooks, Gottesbilder, Dilemmageschichten, Schöpfung, Theologisieren, Salafismus.
- Citar trabajo
- Lina Lentge (Autor), 2022, Trauern, Tod und Sterben im evangelischen Religionsunterricht. Fachwissenschaftliche Grundlagen und Umsetzung im Unterricht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1298948