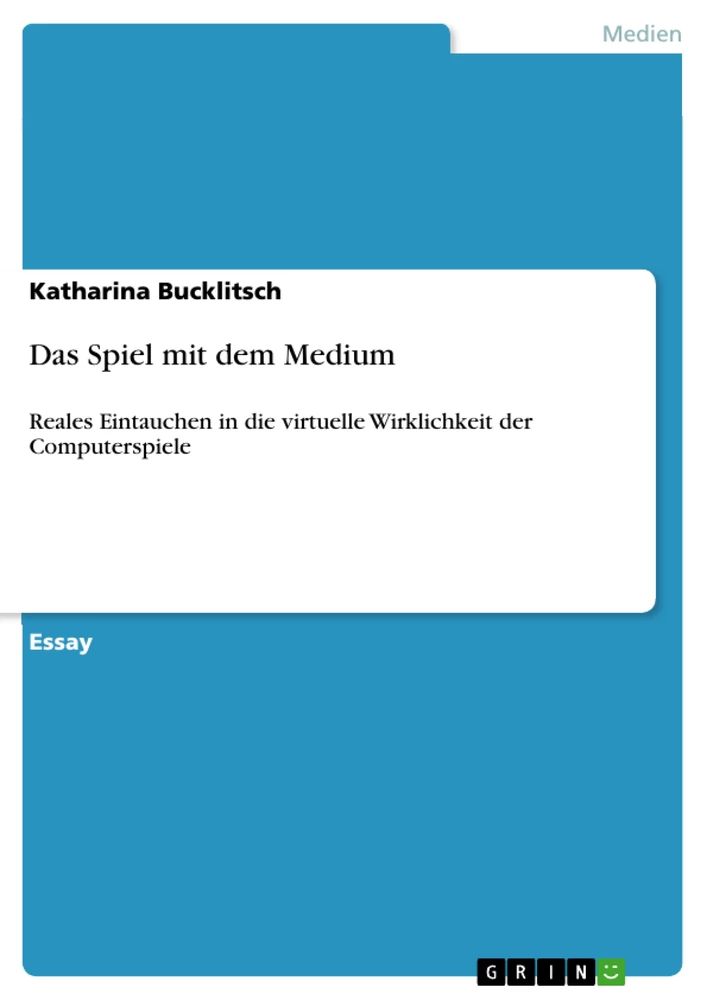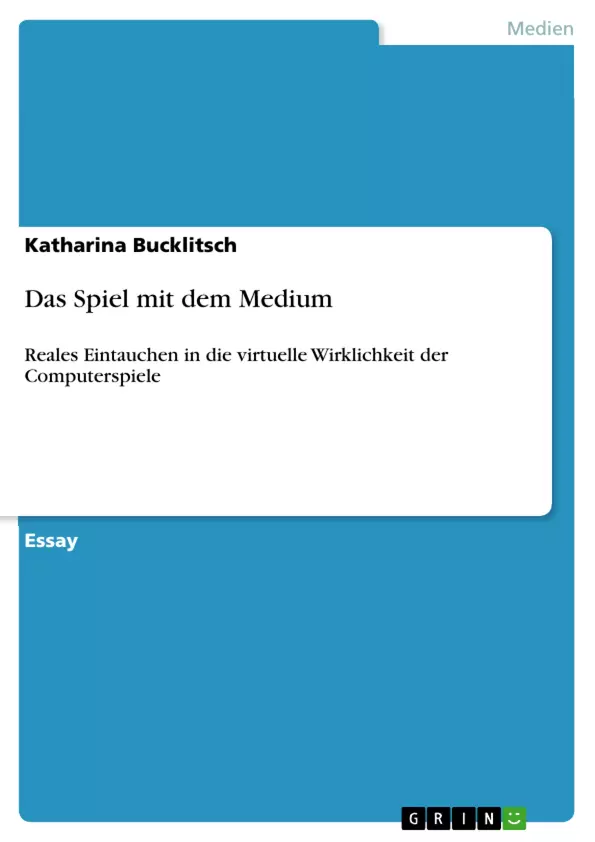Medien stellen mittlerweile neben der Familie und Schule eine weitere bedeutende Sozialisationsinstanz dar. Oftmals ist auch die Rede von den Medien als die „heimlichen Miterzieher“. Kinder und Jugendliche werden heute geradezu überflutet von verschiedensten Medien und geraten auch schon überaus früh in Kontakt mit ihnen. Gerade die auf der Grundlage der Computertechnik mögliche Gestaltung und Verbreitung von Medien hat zu einer enormen Änderung sowohl des Medienangebots als auch der Mediennutzung geführt. Ein perfektes Beispiel hierfür ist das Medium der Computerspiele. Es hat sich bereits seit vielen Jahren als attraktive Freizeitbeschäftigung fest in den Alltag von Kindern und Jugendlichen etabliert. Dieses „neue“ Medium mit seiner Nutzung hat einen Reflex ausgelöst, wobei besonders auch Gewaltdarstellungen, die manche Computer- und Videospiele beinhalten, sicherlich einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet haben. Viele Eltern und Pädagogen beschäftigt die Frage, ob das Computerspiel überhaupt eine sinnvolle Art und Weise der Freizeitgestaltung darstellt und ob eventuell negative Auswirkungen die Folge der Nutzung dieses Mediums, und dies insbesondere in Bezug auf die Nutzung Gewalt orientierter Computerspiele, sein könnten. Stellt also das Spielen am Computer eine Gefahr dar und findet eine Verwischung der Grenzen zwischen realer und virtueller Welt statt?
Als der 19- Jährige Robert Steinhäuser am 24. April 2002 das Leben von sechzehn Menschen mit gezielten Nahschüssen beendete und im Anschluss an seinen Amoklauf sich selbst hinrichtete, forschte die Presse in der Folgezeit im Privatleben des Jungen. Schnell wurde klar, dass der Außenseiter Steinhäuser sich täglich stundenlange Schlachten am PC liefert. „Counter-Strike“ ist der Name des Ego-Shooters, in dem der Spieler in 3D-Perspektive eine virtuelle Actionwelt durchläuft und Terroristen jagt. Dabei stehen ihm neben Bomben und Handgranaten eine Reihe von Pistolen, Maschinengewehren und anderen Waffen zur Verfügung. Steinhäusers martialischer Auftritt lässt Parallelen zum PC-Spiel erkennen. Die Ereignisse am Erfurter Johann- Gutenberg-Gymnasium sind seitdem mahnendes Beispiel für die gefährliche Wirkung von Computerspielen. Die angestoßene öffentliche Debatte führte in Deutschland zur Verabschiedung eines neuen Jugendschutzgesetzes, das zur altersgerechten Kennzeichnung von Computerspielen verpflichtet.
Inhaltsverzeichnis
- Medien stellen mittlerweile neben der Familie und Schule eine weitere bedeutende Sozialisationsinstanz dar. Oftmals ist auch die Rede von den Medien als die „heimlichen Miterzieher“. Kinder und Jugendliche werden heute geradezu überflutet von verschiedensten Medien und geraten auch schon überaus früh in Kontakt mit ihnen. Gerade die auf der Grundlage der Computertechnik mögliche Gestaltung und Verbreitung von Medien hat zu einer enormen Änderung sowohl des Medienangebots als auch der Mediennutzung geführt. Ein perfektes Beispiel hierfür ist das Medium der Computerspiele. Es hat sich bereits seit vielen Jahren als attraktive Freizeitbeschäftigung fest in den Alltag von Kindern und Jugendlichen etabliert. Dieses „neue“ Medium mit seiner Nutzung hat einen Reflex ausgelöst, wobei besonders auch Gewaltdarstellungen, die manche Computer- und Videospiele beinhalten, sicherlich einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet haben. Viele Eltern und Pädagogen beschäftigt die Frage, ob das Computerspiel überhaupt eine sinnvolle Art und Weise der Freizeitgestaltung darstellt und ob eventuell negative Auswirkungen die Folge der Nutzung dieses Mediums, und dies insbesondere in Bezug auf die Nutzung Gewalt orientierter Computerspiele, sein könnten. Stellt also das Spielen am Computer eine Gefahr dar und findet eine Verwischung der Grenzen zwischen realer und virtueller Welt statt?
- Als der 19- Jährige Robert Steinhäuser am 24. April 2002 das Leben von sechzehn Menschen mit gezielten Nahschüssen beendete und im Anschluss an seinen Amoklauf sich selbst hinrichtete, forschte die Presse in der Folgezeit im Privatleben des Jungen. Schnell wurde klar, dass der Außenseiter Steinhäuser sich täglich stundenlange Schlachten am PC liefert. „Counter-Strike“ ist der Name des Ego-Shooters, in dem der Spieler in 3D- Perspektive eine virtuelle Actionwelt durchläuft und Terroristen jagt. Dabei stehen ihm neben Bomben und Handgranaten eine Reihe von Pistolen, Maschinengewehren und anderen Waffen zur Verfügung. Steinhäusers martialischer Auftritt lässt Parallelen zum PC- Spiel erkennen. Die Ereignisse am Erfurter Johann- Gutenberg-Gymnasium sind seitdem mahnendes Beispiel für die gefährliche Wirkung von Computerspielen. Die angestoßene öffentliche Debatte führte in Deutschland zur Verabschiedung eines neuen Jugendschutzgesetzes, das zur altersgerechten Kennzeichnung von Computerspielen verpflichtet. Zeitgleich tritt der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag in Kraft. Die Basis dieser Gesetze ist ein Denkansatz, der davon ausgeht, dass gewalthaltige Computerspiele eine Wirkung auf das Alltagsleben des Spielers haben. Im öffentlichen Diskurs ist diese Annahme weit verbreitet, aber ist sie wissenschaftlich auch wirklich fundiert? Kann man ohne weiteres von einer Übertragung der gewalttätigen Handlungen in einer virtuellen Welt auf die tatsächliche Gewaltbereitschaft des Spielers schließen?
- Versucht man die Frage nach der Wirkung von Computerspielen zu beantworten, so bieten sich zwei unterschiedliche Ansätze an: Zum einen kann man, ausgehend von der Annahme, dass das Spiel eine Grundform menschlichen Seins und eine Basis der Entwicklung ist, untersuchen, ob Video- und Computerspiele Spiele im Sinne dieser Annahme sind, ob sie daher eine sinnvolle Beschäftigung darstellen und geeignet sind, einen Teil der menschlichen Entwicklung zu fördern. Der zweite Ansatz, der zur Zeit in der Öffentlichkeit wesentlich stärkeres Interesse findet, geht nicht von vorgegebenen Kriterien des „Spiels" aus, um zu prüfen, ob diese auch bei Tele- und Computerspielen gegeben sind. Er geht davon aus, dass Bildschirmspiele ein Teil eines Mediensystems sind, dass vor allem Kindern und Jugendlichen Anhaltspunkte zur Errichtung und/ oder Veränderung ihres Weltbildes näher bringt. Die Inhalte der Spiele können somit Einfluss nehmen auf die Vorstellung, Ziele, Wünsche und Einstellungen der Menschen. Die Frage ist in welchem Maße der Einfluss vorherrschend ist und welcher Art dieser Einfluss ist.
- Die so genannten „Home-Computer“, welche Anfang der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts erschienen und vor allem für den Einsatz von Computerspielen nutzbar waren, wurden in erster Linie von Kindern und Jugendlichen gekauft. Sie traten somit einen Siegeszug in die Kinderzimmer an, etablierten sich dort und führten dazu, dass innerhalb kürzester Zeit eine unüberschaubare Anzahl von Videospielen als Raubkopie unter die Jugendlichen gelangte. Die Verbreitung dieser Spiele erfuhr in den neunziger Jahre eine nochmalige Potenzierung, als durch die Überproduktion auch die Preise für Personal Computer zu bröckeln begannen und neue Nutzergruppen mit der Spielsoftware in Kontakt kamen. Die ersten Spiele waren relativ schlicht und einfach und sind hinsichtlich des technischen Niveaus mit den heutigen nicht mehr vergleichbar.
- In den letzten Jahrzehnten haben Computerspiele eine Konjunktur des Spielens ausgelöst und die Frage nach einer neuen Epoche des Spiels aufgeworfen. Heute besitzen fast alle Jugendlichen einen Computer. Dies mag mit daran liegen, dass ihre Eltern bereitwillig ein solches Gerät finanzieren, weil sie ihre Töchter und Söhne optimal auf die Zukunft vorbereiten wollen. Der Computer spielt aber vor allem eine große Rolle in der Freizeit der Jugendlichen. In den letzten Jahren sind pro Jahr immer mehr Spiele auf den Markt gekommen, so dass es unmöglich wird, sie alle zu kennen oder sogar zu prüfen. Durch das Internet geraten auch Spiele nach Deutschland, die hier noch gar nicht erschienen sind und so auch nicht kontrolliert werden können. Falls Spiele in Deutschland wegen ihres Inhalts verboten werden müssen, besteht keine Möglichkeit, sie komplett aus dem Netz zu entfernen, da sie immer wieder und von überall auf der Welt eingespielt, getauscht und verkauft werden. Auf diesen Markt hat die staatliche Kontrolle kaum Zugriff. Die Spiele dürfen außerdem von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften nur auf Antrag eines Kreis- oder Landesjugendamtes geprüft und gegebenenfalls auch infiziert werden. Deswegen entgehen viele Spiele der Kontrolle, weil einfach kein Antrag auf Prüfung gestellt wird. Manche besorgten Eltern gehen davon aus, dass das Spielen am Computer den Spieler direkt beeinflusst, also sein Handeln in der realen Welt bestimmt. Das heißt, wer in Computerspielen Probleme gewaltsam löst, neigt auch sonst dazu, Konflikte mit Gewalt zu lösen. Es gibt jedoch auch die Theorie, dass Computerspiele aggressions- mindernd wirken, weil sie helfen, Spannungen abzubauen. Aber auch sie ist genauso unbewiesen, wie die Behauptung, Gewalttätigkeit ließe sich direkt auf Computerspiele zurückführen. Eine andere Vermutung ist, dass Personen, die zu Gewalt neigen, auch gerne virtuelle Gewalt konsumieren, nicht jedoch der Konsum virtueller Gewalt zu realer Gewalt führe.
- Da Macht, Herrschaft und Kontrolle häufig im Zentrum der Spiele stehen, bleibt meines Erachtens kaum Platz für Mitmenschlichkeit. In der virtuellen Welt gibt es keine Lebewesen mit Gefühlen, also wird auch vom Spieler kein Einfügungsvermögen verlangt. Das kann längerfristig dazu führen, dass das sich Einfühlen in andere Menschen nicht gelernt wird. Dadurch, dass Leiden im Computerspiel nicht vorkommt, muss sich der Spieler auch nicht mit Schmerzen, die seinem Feind zugefügt werden, auseinander setzen. Um zu gewinnen kommt es nur darauf an, ohne Gefühle und möglichst kaltblütig und effektiv zu handeln. Somit ist die Gefahr gegeben, dass diese Kaltblütigkeit in die reale Welt übertragen wird und Mitgefühl und Mitleid zurück gedrängt werden. Die Frage, ob Computerspiele jedoch die Gewaltbereitschaft fördern, kann nicht eindeutig beantwortet werden. Die Ursachen für Aggressivität und für die Bereitschaft, Gewalt anzuwenden liegen häufig in der Familie. Auch Misserfolge in der Schule und im Beruf können dafür verantwortlich sein, dass Jugendliche glauben, Probleme mit Gewalt lösen zu können. Um dieses Problem zu lösen, muss man die Jugendlichen eingehend informieren und ihnen erklären, dass wenn man sie zu viel Zeit an den Computer verbringen sie nicht lernen, mit den anderen Mitgliedern ihrer Gesellschaft umzugehen. Auf der anderen Seite sind für Kinder zahlreiche Spiele interessant und pädagogisch wertvoll, die Geschicklichkeit und Reaktionsvermögen fördern, Fantasie und Kreativität anregen und auch analytisches, komplexes Denken stimulieren.
- Mit zunehmend komplexer werdenden Medien- und Kommunikationssystemen gewinnt die Fragestellung nach dem Verhältnis von Medien- und Lebenswirklichkeit erneut an Aktualität. Eine Vielzahl an Kindern und Jugendlichen und auch Erwachsene sind von Computer- und Videospielen fasziniert. Aber was ist das Faszinierende an diesen Spielen? Wieso sind sie so beliebt? Wieso spielen selbst solche Personen, Gewalt- Computerspiele, die ansonsten als sehr friedfertig gelten? Computerspiele werden in der Gesellschaft immer populärer. Doch parallel zu ihrer ansteigenden Verbreitung, mehren sich auch die Stimmen, die in den virtuellen Spielwelten eine Gefahr sehen. Es stellen sich Fragen, inwiefern Aussagen über Wirklichkeit in unserer Gesellschaft überhaupt zustande kommen und welchen Beitrag die Medien, wie in diesem Fall die Computerspiele, zur Wirklichkeitserfahrung beitragen. Nicht zu vergessen sei hierbei, dass das Mediensystem einer eigenen Logik unterliegt. Es konstruiert eine eigene Form der Realität und ist Instrument der zwischenmenschlichen Kommunikation: Ohne Medien ist Kommunikation nicht möglich, und ohne Kommunikation wiederum gibt es keine Kultur. Und Spielen ist wahrscheinlich eines der ältesten Kulturformen überhaupt. Da jedoch jede Erfahrung in den Medien vor dem Hintergrund der eigenen leiblichen Situation geschieht, bleibt die Differenz zwischen Welt und Medium jedoch immer erhalten. Daher ist keine Welt möglich, die vollständig eine virtuelle Welt wäre. Die virtuellen Situationen und Welten hängen vom Gegebensein realer Situationen und Welten ab. Ihre durch die Verbreitung der Neuen Medien geschaffene Zugänglichkeit jedoch verändert die Realität dieses realen lebensweltlichen Lebens. Insofern haben die Neuen Medien Realität und schaffen sie neue Realität – nicht durch die Abschaffung der Wirklichkeit, sondern deren Veränderung durch die Eröffnung der Möglichkeit, uns nahezu andauernd auf Situationen zu beziehen, in denen wir nicht sind. Technische Medien, wie der Computer, bieten verschiebbare Blickpunkte und neue Erfahrungen der Wirklichkeit, die in menschlicher Wahrnehmung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit „Das Spiel mit dem Medium“ befasst sich mit der Frage, inwiefern Computerspiele die Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen beeinflussen. Die Arbeit analysiert die Entwicklung der Computerspiele, ihre Verbreitung und die damit verbundenen gesellschaftlichen Debatten. Dabei werden insbesondere die Auswirkungen von Gewalt in Computerspielen auf die reale Welt untersucht.
- Entwicklung und Verbreitung von Computerspielen
- Einfluss von Computerspielen auf die Lebenswirklichkeit
- Debatte um die Auswirkungen von Gewalt in Computerspielen
- Verhältnis von virtueller und realer Welt
- Medien und Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
- Der erste Teil der Arbeit beleuchtet die Bedeutung von Medien in der heutigen Gesellschaft und die zunehmende Verbreitung von Computerspielen. Es wird die Frage aufgeworfen, ob Computerspiele eine sinnvolle Art der Freizeitgestaltung darstellen und ob negative Auswirkungen auf die Nutzer, insbesondere durch Gewaltdarstellungen, zu befürchten sind.
- Der zweite Teil der Arbeit analysiert die Ereignisse am Erfurter Johann-Gutenberg-Gymnasium, bei denen ein 19-jähriger Schüler ein Amoklauf verübte. Die Presse stellte in der Folgezeit einen Zusammenhang zwischen dem Amoklauf und dem Computerspiel „Counter-Strike“ her. Die Ereignisse führten zu einer öffentlichen Debatte über die Auswirkungen von Computerspielen und zur Verabschiedung eines neuen Jugendschutzgesetzes in Deutschland.
- Der dritte Teil der Arbeit untersucht die Wirkung von Computerspielen aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. Zum einen wird die Frage gestellt, ob Computerspiele als Spiele im Sinne der menschlichen Entwicklung betrachtet werden können. Zum anderen wird die Rolle von Computerspielen als Teil eines Mediensystems analysiert, das Einfluss auf die Vorstellung, Ziele, Wünsche und Einstellungen der Nutzer nehmen kann.
- Der vierte Teil der Arbeit beleuchtet die Geschichte der Computerspiele und ihre Verbreitung in den 80er und 90er Jahren. Es wird die Entwicklung der Spiele von einfachen, schlichten Spielen zu komplexen, technisch anspruchsvollen Spielen beschrieben.
- Der fünfte Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob Computerspiele die Gewaltbereitschaft von Nutzern fördern. Es werden verschiedene Theorien diskutiert, die sowohl eine aggressionsfördernde als auch eine aggressionsmindernde Wirkung von Computerspielen postulieren. Es wird jedoch betont, dass die Ursachen für Aggressivität und Gewaltbereitschaft in der Regel in der Familie oder in anderen Lebensbereichen liegen.
- Der sechste Teil der Arbeit analysiert die Rolle von Computerspielen in der Gesellschaft und die Frage, inwiefern sie die Lebenswirklichkeit von Nutzern beeinflussen. Es wird betont, dass Computerspiele eine eigene Form der Realität konstruieren und ein Instrument der zwischenmenschlichen Kommunikation darstellen. Die Arbeit stellt jedoch auch fest, dass die Differenz zwischen Welt und Medium immer erhalten bleibt und keine Welt vollständig virtuell sein kann.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Computerspiele, Medien, Lebenswirklichkeit, Gewalt, Jugendschutz, Mediennutzung, virtuelle Realität, Gesellschaft, Kommunikation, Kultur, Entwicklung, Einfluss, Wirkung, Debatte, Forschung, Analyse.
Häufig gestellte Fragen
Stellen gewalthaltige Computerspiele eine Gefahr für Jugendliche dar?
Die Arbeit diskutiert, ob virtuelle Gewalt die reale Gewaltbereitschaft erhöht, weist aber darauf hin, dass die wissenschaftliche Beweislage hierzu nicht eindeutig ist.
Welches Ereignis prägte die deutsche Debatte um Ego-Shooter?
Der Amoklauf von Erfurt im Jahr 2002 durch Robert Steinhäuser führte zu einer intensiven Diskussion über Spiele wie „Counter-Strike“.
Gibt es auch positive pädagogische Aspekte von Computerspielen?
Ja, viele Spiele fördern Geschicklichkeit, Reaktionsvermögen, Kreativität sowie analytisches und komplexes Denken.
Was ist die Theorie der Aggressionsminderung beim Spielen?
Einige Theorien besagen, dass Spiele helfen können, Spannungen abzubauen, was jedoch ebenso wenig bewiesen ist wie der direkte Zusammenhang mit realer Gewalt.
Wie funktioniert die staatliche Kontrolle von Computerspielen in Deutschland?
Durch das Jugendschutzgesetz und die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien werden Spiele geprüft und mit Alterskennzeichnungen versehen.
- Arbeit zitieren
- Katharina Bucklitsch (Autor:in), 2006, Das Spiel mit dem Medium, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/130595