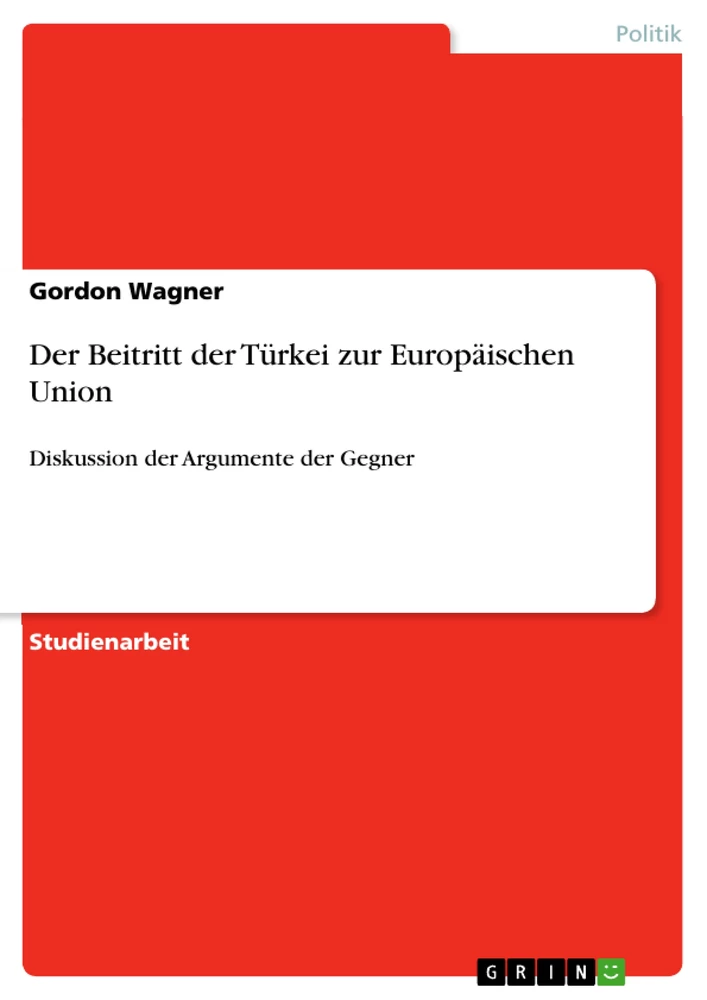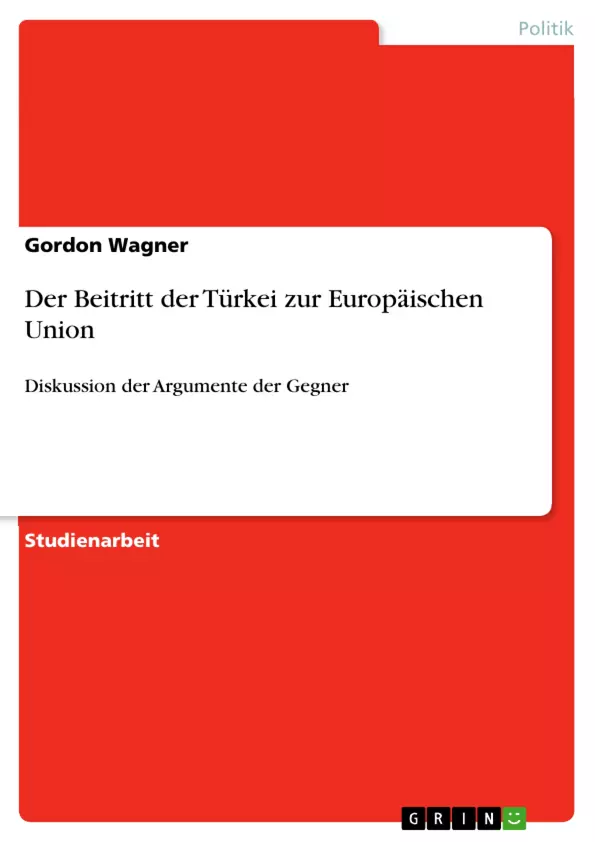This homework, written in German, is pointing out the basic arguments against Turkey’s accession to the European Union, splitting them into the three Weberian terms “ideas”, “institutions” and “interests”. I will give examples for every term and discuss them later on while showing that there mostly is also a positive aspect to every drawback, e.g. for the proposed waves of Turkish immigrants in case of a Turkish EU-membership. I will eventually conclude that Turkey’s membership is actually making sense in the long run but cannot possibly achieved without a) a steadier progression of reforms in Turkey and b) a reformation of the obsolete EU institutions as given in the current Treaty of Lisbon.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Gegenstand und Aufbau der Arbeit
- Darlegung der Argumente gegen einen Beitritt
- Ideen
- Institutionen
- Interessen
- Diskussion der angebrachten Argumente unter Berücksichtigung der Befürworter-Perspektive
- Konklusion
- Literaturliste
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Argumenten der Gegner eines Beitritts der Türkei zur Europäischen Union. Sie analysiert die Gründe für die Skepsis gegenüber einer türkischen Mitgliedschaft und diskutiert diese im Kontext der Befürworter-Perspektive. Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Bild der Debatte um den Türkei-Beitritt zu zeichnen und die verschiedenen Argumente zu beleuchten.
- Geographische Zugehörigkeit der Türkei
- Wertesystem und kulturelle Unterschiede
- Gleichberechtigung der Geschlechter in der Türkei
- Politische und wirtschaftliche Stabilität der Türkei
- Europäische Integration und die Rolle der Türkei
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Gegenstand und den Aufbau der Arbeit vor. Sie erläutert die aktuelle Situation der EU-Erweiterung und die Bedeutung der Türkei als potenziellen Beitrittskandidaten.
Das zweite Kapitel analysiert die Argumente der Gegner eines Türkei-Beitritts, die sich auf die Bereiche Ideen, Institutionen und Interessen konzentrieren. Es werden die Bedenken hinsichtlich der kulturellen und politischen Unterschiede zwischen der Türkei und der EU sowie die Sorgen um die wirtschaftliche und politische Stabilität der Türkei beleuchtet.
Das dritte Kapitel diskutiert die Argumente der Gegner im Kontext der Befürworter-Perspektive. Es werden die Vorteile eines Türkei-Beitritts für die EU und die Türkei selbst beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Beitritt der Türkei zur Europäischen Union, die Argumente der Gegner, die kulturellen und politischen Unterschiede zwischen der Türkei und der EU, die wirtschaftliche und politische Stabilität der Türkei, die Europäische Integration und die Rolle der Türkei in der EU.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptargumente gegen einen EU-Beitritt der Türkei?
Gegner führen oft kulturelle Unterschiede, die geographische Lage, wirtschaftliche Stabilitätsrisiken und Bedenken hinsichtlich der Gleichberechtigung an.
Wie lassen sich die Gegenargumente nach Max Weber einteilen?
Die Argumente werden in die Kategorien „Ideen“ (Werte/Kultur), „Institutionen“ (politische Struktur) und „Interessen“ (wirtschaftlicher Nutzen) unterteilt.
Welche Rolle spielt die geographische Zugehörigkeit?
Es wird diskutiert, ob die Türkei aufgrund ihres kleinen europäischen Teils überhaupt als europäisches Land im Sinne der EU-Verträge gelten kann.
Gibt es auch positive Aspekte eines Beitritts?
Befürworter sehen Chancen in der jungen Bevölkerung gegen den demographischen Wandel der EU und die strategische Bedeutung der Türkei als Brücke zum Nahen Osten.
Was ist notwendig, damit ein Beitritt langfristig gelingen könnte?
Voraussetzungen sind stetige Reformen in der Türkei sowie eine Reform der EU-Institutionen, wie sie im Vertrag von Lissabon teilweise angestrebt wurde.
- Arbeit zitieren
- Gordon Wagner (Autor:in), 2009, Der Beitritt der Türkei zur Europäischen Union , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/130676