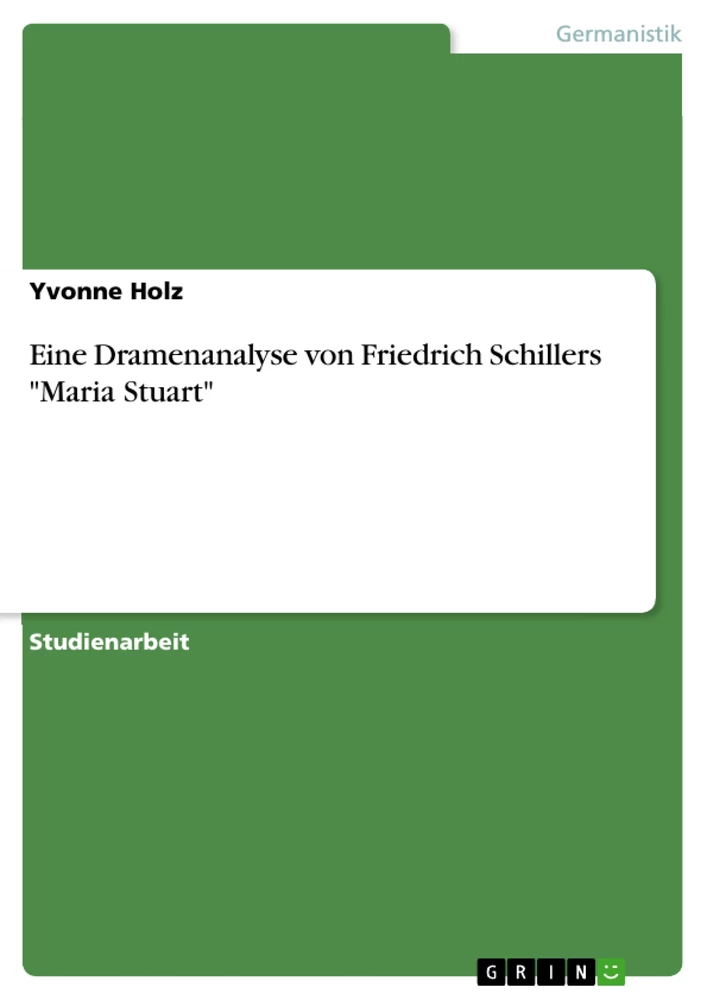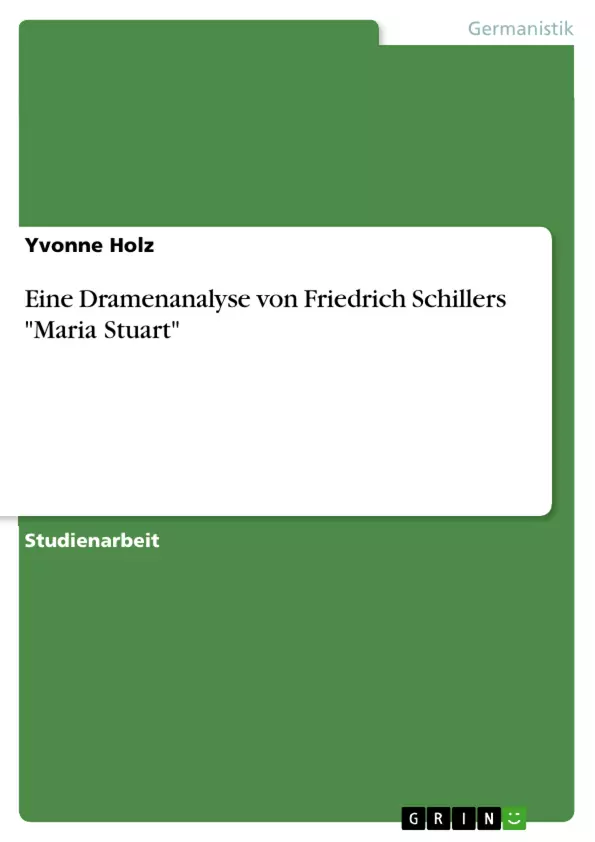Friedrich Schiller setzt sich bereits im Jahr 1782/83 mit der historischen Figur der schottischen Königin Maria Stuart auseinander. Zu einer literarischen Realisierung kommt es jedoch erst im Jahr 1799, nachdem er zuvor den „Wallenstein“ abgeschlossen hat. In seinem Drama behandelt Schiller ausschließlich die letzten Lebenstage der Maria Stuart und ihre Hinrichtung.
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der formalen Analyse von Schillers Drama. Dabei stützt sich die Untersuchung vorrangig auf den Dramentext als solches.
Die Ebenen der Transformation und der Aufführung, sind für das Gesamtverständnis eines Dramas von hoher Bedeutung, da sich die textliche Grundlage des Dramas erst in der Bühnenaufführung endgültig realisiert, sollen aber dennoch an dieser Stelle ausgespart werden.
Zunächst wird der Aufbau der Handlung untersucht. Hierbei werden Fragen zu Strukturmerkmalen und Form des Dramas beantwortet.
Nachfolgend werden das Setting und die Figurenrede, Augenmerk liegt hierbei vorrangig auf den Sprachformen des Mono- und Dialogs, der Stichomythie sowie der Zeilenrede, untersucht. Im Anschluss wird im Rahmen der Analyse das zentrale Merkmal der Regieanweisungen (Paratexte) dargelegt. Alle analytischen Untersuchungen werden mit konkreten Beispielen unterlegt und veranschaulicht.
Ziel und zugleich Hauptaugenmerk der Dramenanalyse ist es, einen ersten Einblick in die Struktur von Schillers Drama zu geben. Weitreichende, detaillierte Beschreibungen inhaltlicher sowie formaler Art, kann und soll diese Arbeit nicht leisten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Analyse
- 2.1 Aufbau der Handlung
- 2.2 Ort und Zeit
- 2.3 Figurenrede
- 2.4 Regieanweisungen
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, eine formale Analyse von Friedrich Schillers Drama „Maria Stuart“ zu liefern. Der Fokus liegt auf der Struktur des Dramas, ohne tief in inhaltliche Details einzugehen. Die Analyse konzentriert sich auf den Dramentext selbst, wobei Aspekte der Bühnenaufführung ausgeklammert werden.
- Aufbau der Handlung nach dem Fünfaktschema
- Einhaltung der Einheiten von Ort und Zeit
- Analyse der Figurenrede (Monolog, Dialog, Stichomythie)
- Bedeutung der Regieanweisungen
- Charakterisierung des Dramas als geschlossenes und analytisches Drama
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt Schillers Auseinandersetzung mit der historischen Figur Maria Stuart. Sie benennt den Fokus der Arbeit auf die formale Analyse des Dramas und kündigt die einzelnen Schritte der Analyse an: Aufbau der Handlung, Ort und Zeit, Figurenrede und Regieanweisungen. Es wird betont, dass die Analyse primär auf dem Dramentext basiert und Aufführungsaspekte ausklammert. Der Ausblick auf die angestrebte Strukturanalyse des Dramas wird gegeben, wobei die Einschränkung auf einen ersten Einblick in die Struktur des Dramas deutlich gemacht wird.
2. Analyse: Dieses Kapitel bietet eine allgemeine Einführung in den Begriff "Drama" und seine Besonderheiten, wobei es explizit auf die textliche Grundlage des Dramas eingegrenzt wird, im Gegensatz zur Aufführung. Es legt den Grundstein für die detailliertere Analyse der folgenden Unterkapitel.
2.1 Aufbau der Handlung: Dieses Kapitel analysiert den Aufbau der Handlung in Schillers „Maria Stuart“ als geschlossenes Drama in fünf Akten, entsprechend dem Freytagschen Fünfaktschema. Der erste Akt stellt die Exposition dar, der zweite die steigende Handlung, der dritte den Höhepunkt (Peripetie), der vierte die fallende Handlung (Retardation) und der fünfte die Katastrophe (Auflösung). Die Kapitel beschreiben die jeweilige Funktion der Akte anhand konkreter Beispiele aus dem Drama, wie beispielsweise die Einführung von Maria Stuart im ersten Akt und die Begegnung der beiden Königinnen im dritten Akt als Höhepunkt des Konflikts. Die Analyse unterstreicht die lineare Handlung und die begrenzte Anzahl an Figuren als weitere Merkmale des geschlossenen Dramas. Abschließend wird das Drama als analytisches Drama klassifiziert, bei dem der Endzustand der Handlung bereits erreicht ist und der Fokus auf den Ereignissen liegt, die zu diesem Zustand führten.
2.2 Ort und Zeit: Dieses Kapitel befasst sich mit der Einhaltung der aristotelischen Einheiten von Ort und Zeit. Die Einheit der Zeit wird im Drama durch die Begrenzung der Handlung auf ungefähr drei Tage zwischen Gerichtsbeschluss und Hinrichtung erfüllt. Die Einheit des Ortes wird im Drama durch einen einzigen Schauplatz, der vermutlich durch die Bühnenform vorgegeben ist, eingehalten. Die Kapitel beleuchtet bühnentechnische Gründe, warum die Einhaltung der Einheit des Ortes insbesondere in der Antike wichtig war.
Schlüsselwörter
Friedrich Schiller, Maria Stuart, Dramenanalyse, Fünfaktschema, geschlossenes Drama, analytisches Drama, Einheit von Ort und Zeit, Figurenrede, Regieanweisungen, Monolog, Dialog, Stichomythie.
Häufig gestellte Fragen zu Friedrich Schillers "Maria Stuart" - Formale Dramenanalyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit liefert eine formale Analyse von Friedrich Schillers Drama "Maria Stuart". Der Fokus liegt auf der Struktur des Dramas, ohne tief in inhaltliche Details einzugehen. Analysiert werden Aufbau der Handlung, Ort und Zeit, Figurenrede und Regieanweisungen. Aufführungsaspekte werden dabei ausgeklammert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Analysekapitel mit Unterkapiteln zum Aufbau der Handlung, Ort und Zeit, Figurenrede und Regieanweisungen, sowie ein Fazit. Die Einleitung beschreibt den Fokus der Arbeit und kündigt die einzelnen Analyseabschnitte an. Das Analysekapitel untersucht die formalen Strukturen des Dramas detailliert. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Wie wird der Aufbau der Handlung analysiert?
Der Aufbau der Handlung in Schillers "Maria Stuart" wird als geschlossenes Drama in fünf Akten nach dem Freytagschen Fünfaktschema analysiert. Die einzelnen Akte (Exposition, steigende Handlung, Höhepunkt, fallende Handlung, Katastrophe) werden anhand konkreter Beispiele aus dem Drama beschrieben. Die lineare Handlung und die begrenzte Anzahl an Figuren werden als Merkmale des geschlossenen Dramas hervorgehoben. Das Drama wird als analytisches Drama klassifiziert, bei dem der Fokus auf den Ereignissen liegt, die zum Endzustand der Handlung führten.
Wie werden Ort und Zeit im Drama behandelt?
Die Arbeit untersucht die Einhaltung der aristotelischen Einheiten von Ort und Zeit. Die Einheit der Zeit wird durch die Begrenzung der Handlung auf ungefähr drei Tage erfüllt. Die Einheit des Ortes wird durch einen einzigen Schauplatz eingehalten, der vermutlich durch die Bühnenform vorgegeben ist. Die Analyse beleuchtet auch bühnentechnische Gründe für die Bedeutung der Einheit des Ortes, insbesondere in der Antike.
Welche Aspekte der Figurenrede werden betrachtet?
Die Analyse der Figurenrede umfasst Monologe, Dialoge und Stichomythien. Es wird untersucht, wie diese Formen der Figurenrede zur Gestaltung der Handlung und Charaktere beitragen.
Welche Rolle spielen die Regieanweisungen?
Die Arbeit analysiert die Bedeutung der Regieanweisungen für das Verständnis des Dramas. Es wird untersucht, wie diese Anweisungen die Inszenierung und das Verständnis des Stücks beeinflussen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Friedrich Schiller, Maria Stuart, Dramenanalyse, Fünfaktschema, geschlossenes Drama, analytisches Drama, Einheit von Ort und Zeit, Figurenrede, Regieanweisungen, Monolog, Dialog, Stichomythie.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, eine formale Analyse von Friedrich Schillers Drama "Maria Stuart" zu liefern. Die Arbeit konzentriert sich auf die Struktur des Dramas und vermeidet eine detaillierte inhaltliche Interpretation.
Welche Methode wird in der Analyse verwendet?
Die Analyse basiert primär auf dem Dramentext selbst und klammert Aufführungsaspekte aus. Es wird eine strukturelle Analyse durchgeführt, die den Aufbau des Dramas nach dem Fünfaktschema, die Einhaltung der Einheiten von Ort und Zeit sowie die Figurenrede und Regieanweisungen untersucht.
- Quote paper
- Magister Artium Yvonne Holz (Author), 2005, Eine Dramenanalyse von Friedrich Schillers "Maria Stuart", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/130786