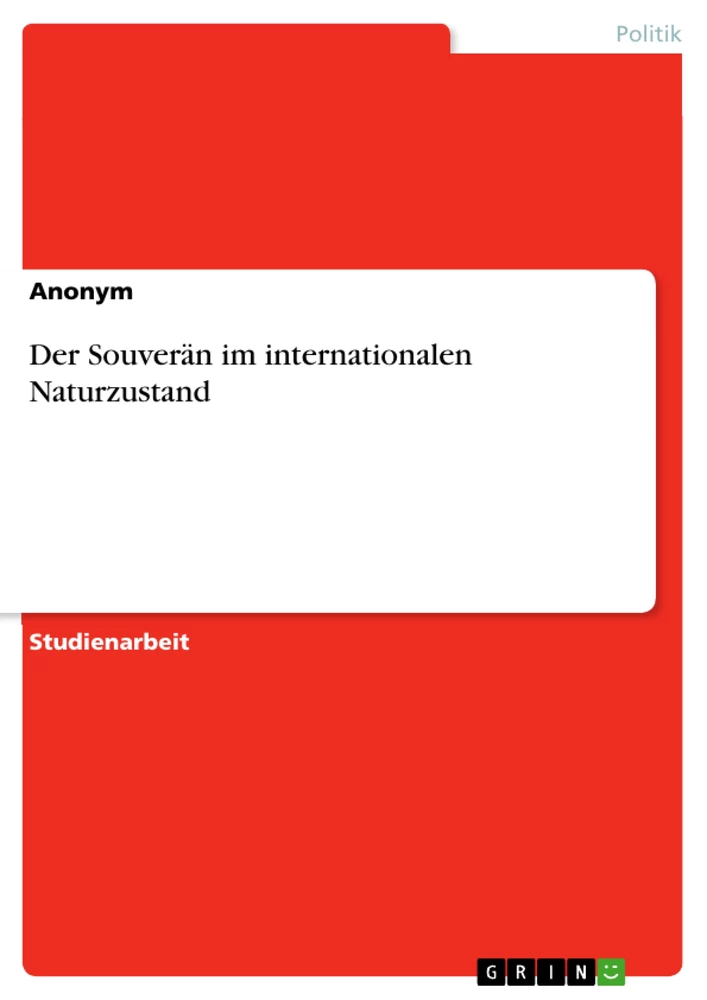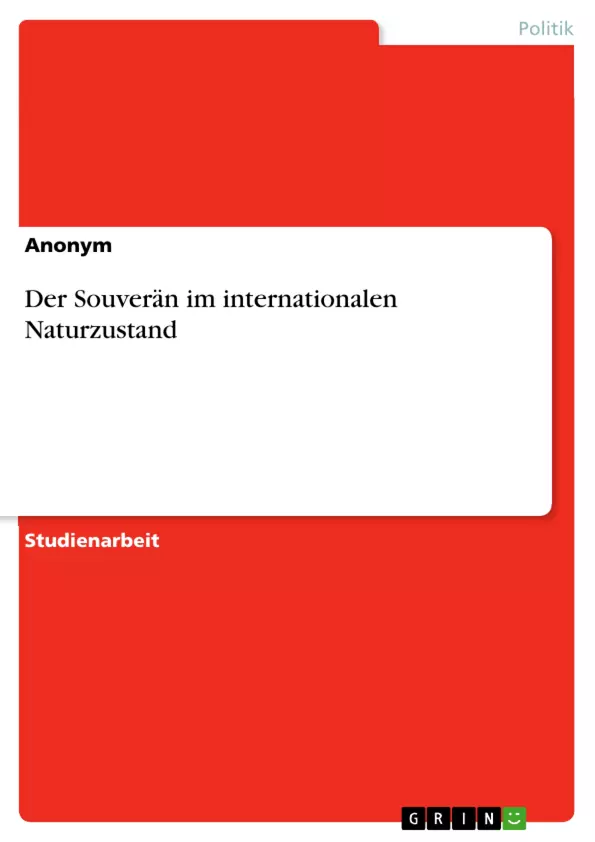Die Arbeit behandelt die Frage, ob sich der in Thomas Hobbes' Theorie entwickelte Souverän auf internationaler Ebene im Naturzustand befindet und inwiefern diese Analogie zum individuellen Naturzustand genauerer Betrachtung standhält. Zu Beginn der Analyse gehe ich auf Unterschiede in der Beschaffenheit von Individuen und Staaten ein, auf Grundlage derer ich aufzeige, dass die Konsequenz aus den unterschiedlichen Naturzuständen eine andere ist. Danach benenne ich Restriktionen, denen der Souverän auf internationaler Ebene unterliegt und schlussfolgere daraus, dass eine aggressive Außenpolitik aus Hobbes Sicht nicht vertretbar sein kann. Im Anschluss an diese Überlegungen erwäge ich die Effizienz eines supranationalen Souveräns und die Alternative des modifizierten Naturzustandes.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorie
- Der Naturzustand
- Von den natürlichen Gesetzen und dem Übergang zum Staat
- Quis custodiet ipsos custodes?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Frage, ob sich der in Hobbes' Theorie entwickelte Souverän auf internationaler Ebene im Naturzustand befindet und inwiefern diese Analogie zum individuellen Naturzustand genauerer Betrachtung standhält.
- Der individuelle Naturzustand in Hobbes' Theorie
- Die Übertragbarkeit des Naturzustandes auf das internationale System
- Die Unterschiede zwischen dem Naturzustand auf individueller und staatlicher Ebene
- Die Effizienz eines supranationalen Souveräns
- Die Alternative des modifizierten Naturzustandes
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung erläutert die Relevanz von Hobbes' Leviathan für das heutige Verständnis des internationalen Systems und stellt die zentrale Forschungsfrage der Arbeit dar. Sie erläutert den Aufbau der Arbeit und grenzt den Umfang der Untersuchung ein.
Theorie
Der Naturzustand
Dieser Abschnitt beschreibt den individuellen Naturzustand in Hobbes' Theorie, kennzeichnet ihn als Zustand ohne verbindliche Gesetze und Moral, in dem jeder Mensch Richter seiner selbst ist. Er beleuchtet die Gleichheit der Menschen in ihren Fähigkeiten und den natürlichen Drang nach Wettbewerb, Verteidigung und Ruhm, der zu einem Krieg aller gegen alle führt.
Von den natürlichen Gesetzen und dem Übergang zum Staat
Dieser Abschnitt erläutert die natürlichen Gesetze, die sich aus der Natur des Menschen ergeben und die den Übergang vom Naturzustand zum Staat ermöglichen. Es wird die Rolle der Angst und des Strebens nach Sicherheit im Prozess der Staatsbildung hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Schlüsselbegriffe der Arbeit sind: Thomas Hobbes, Leviathan, Naturzustand, internationaler Kriegszustand, Souverän, Anarchismus, natürliche Gesetze, Staatsbildung, Krieg aller gegen alle, individuelle Gleichheit, Sicherheitsbedürfnis, Staatsgewalt.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2020, Der Souverän im internationalen Naturzustand, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1312812