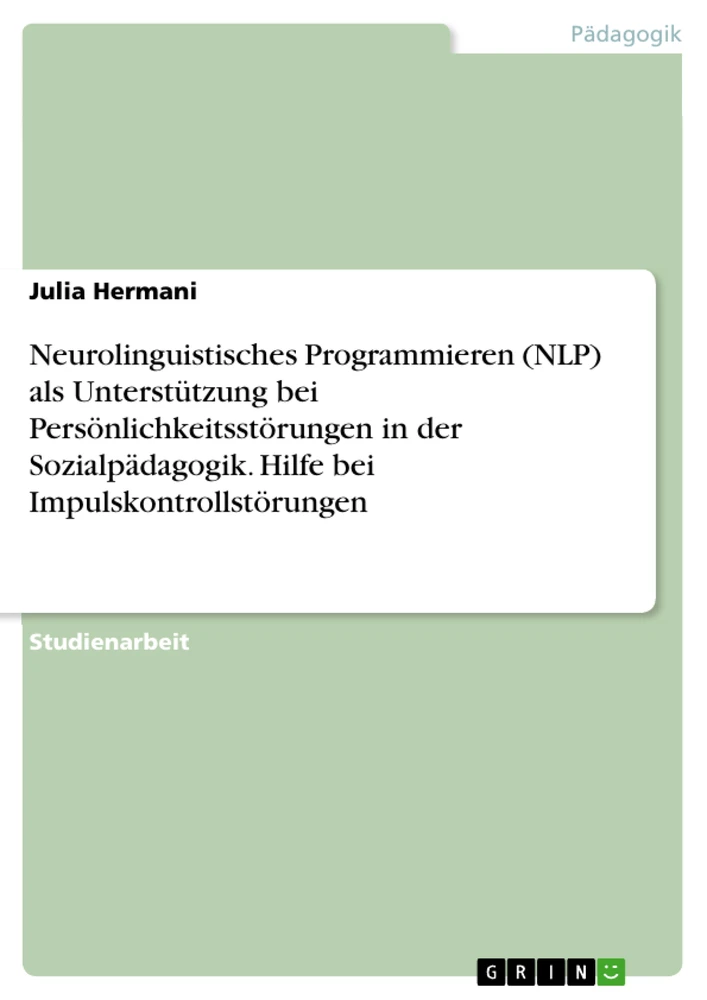Das Neurolinguistische Programmieren (NLP) ist als Coaching-Methode seit den 1980ern bekannt und dient zum Beispiel dazu, neue Ressourcen aufzubauen und alte Gewohnheiten, wie zum Beispiel Ängste oder Sorgen auszulöschen. Da die Ressourcenarbeit auch innerhalb der sozialpädagogischen Tätigkeit zur Anwendung kommt, wirft das die Frage auf, ob und inwieweit NLP das sozialpädagogische Handeln unterstützen kann.
Jährlich sterben 10000 Menschen in Deutschland an Suiziden, bei 90 Prozent ist eine psychische Erkrankung oder Suchterkrankung vorangegangen. Laut Bericht der Bundes Psychotherapeuten Kammer von 2020 mangele es in Deutschland massiv an Psychotherapieplätzen für Kurz- oder Langzeittherapien. Durch die Corona- Pandemie habe sich die Nachfrage sogar noch verstärkt. Aus diesem Grund stellt sich die Frage, ob eine alternative Behandlungsmöglichkeit dem kontinuierlichen Anstieg von psychischen Erkrankungen entgegenwirken kann.
Inhaltsverzeichnis
- Glossar
- Einleitung
- Persönlichkeitsstörungen
- Definition und Diagnose
- Ursache und Behandlung
- Sozialpädagogik bei Persönlichkeitsstörungen
- Umgang mit Verhaltensstörungen
- Interventionen bei herausforderndem Verhalten
- Das Neurolinguistische Programmieren (NLP)
- Definition und Vorgehensweise
- Anwendung in der Sozialpädagogik
- NLP-Untersuchung bei herausforderndem Verhalten
- Ausgangsproblematik und präferierte Techniken
- Protokoll 1: „Moment of Excellence\" und doppelten Anker integrieren
- Protokoll 2: „Standard-Swish“
- Protokoll 3: „Umgang mit Kritik“
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende wissenschaftliche Hausarbeit befasst sich mit der Frage, ob und inwieweit das Neurolinguistische Programmieren (NLP) die Sozialpädagogik bei Persönlichkeitsstörungen nach F61 unterstützen kann. Die Arbeit analysiert verschiedene Aspekte, die für die Anwendung von NLP in der Sozialpädagogik relevant sind, und beleuchtet die potenziellen Vorteile und Herausforderungen.
- Definition und Diagnose von Persönlichkeitsstörungen
- Sozialpädagogische Methoden im Umgang mit herausforderndem Verhalten
- Das Neurolinguistische Programmieren (NLP) und seine Anwendungsmöglichkeiten
- Die Wirksamkeit von NLP-Techniken bei Persönlichkeitsstörungen
- Die Integration von NLP in die sozialpädagogische Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas und die Motivation für die Untersuchung dar. Sie beleuchtet den steigenden Bedarf an alternativen Behandlungsmöglichkeiten bei psychischen Erkrankungen, insbesondere Persönlichkeitsstörungen.
Kapitel 1 befasst sich mit der Definition und Diagnose von Persönlichkeitsstörungen. Es erläutert die verschiedenen Formen und Variationen von Persönlichkeitsstörungen und beschreibt die diagnostischen Kriterien nach ICD-10.
Kapitel 2 untersucht verschiedene sozialpädagogische Methoden, die bei herausforderndem Verhalten bei Personen mit Persönlichkeitsstörungen eingesetzt werden können. Es beleuchtet die Bedeutung des Umgangs mit Verhaltensstörungen und die Anwendung von Interventionen bei herausforderndem Verhalten.
Kapitel 3 stellt das Neurolinguistische Programmieren (NLP) vor und beschreibt seine Definition und Vorgehensweise. Es beleuchtet die Anwendung von NLP in der Sozialpädagogik und die Möglichkeiten, NLP-Techniken in der Praxis zu integrieren.
Kapitel 4 analysiert die Anwendung von NLP-Techniken bei herausforderndem Verhalten. Es präsentiert drei verschiedene NLP-Protokolle: „Moment of Excellence“, „Standard-Swish“ und „Umgang mit Kritik“, und beleuchtet ihre Anwendungsmöglichkeiten im Kontext von Persönlichkeitsstörungen.
Schlüsselwörter
Persönlichkeitsstörungen, Sozialpädagogik, Neurolinguistisches Programmieren (NLP), herausforderndes Verhalten, Impulskontrolle, Ressourcenarbeit, Intervention, Coaching-Methode, F61, ICD-10, Anamnese, Psychopathologie, Psychotherapie, Kombinierte Persönlichkeitsstörungen, Verhaltensstörungen, Emotionale Störungen, Denkstörungen, Affektivität, Wahnstörungen, Zwangsstörungen, Angststörungen.
- Quote paper
- Julia Hermani (Author), 2021, Neurolinguistisches Programmieren (NLP) als Unterstützung bei Persönlichkeitsstörungen in der Sozialpädagogik. Hilfe bei Impulskontrollstörungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1312851