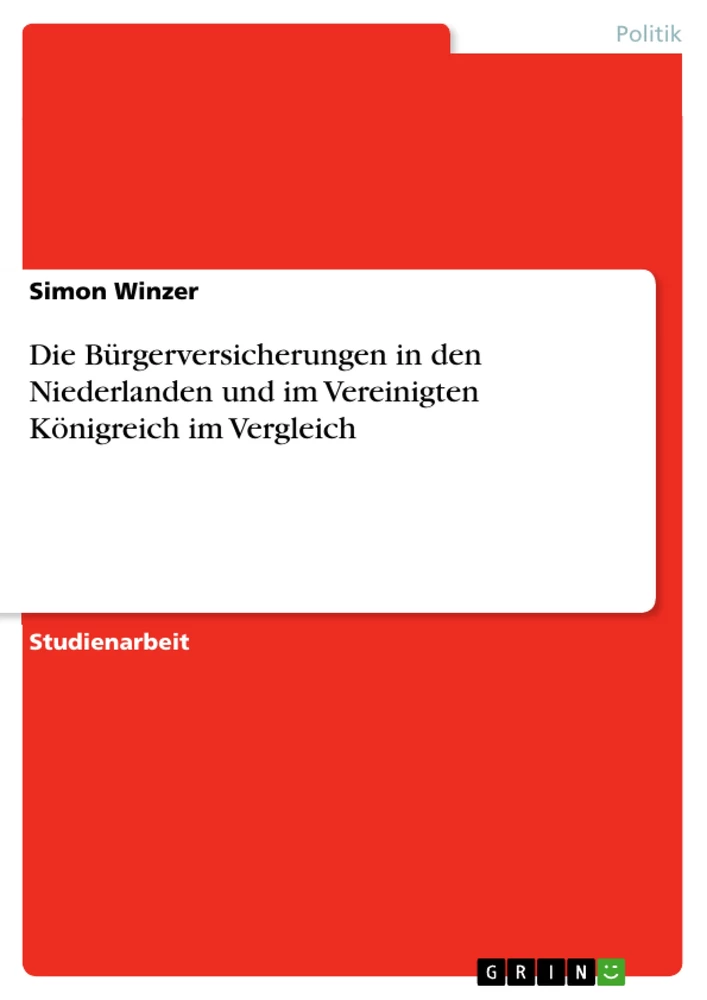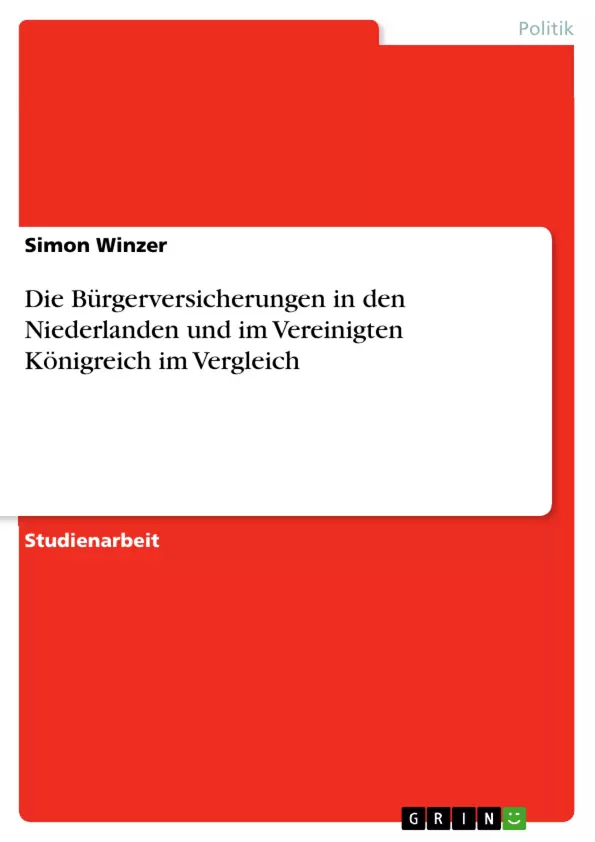Seit Jahren wird in Deutschland über die Einführung einer sogenannten Bürgerversicherung diskutiert. Dabei handelt es sich um ein einheitliches Krankenversicherungssystem, in dem alle Einwohner eines Landes pflichtversichert sind.
In den Niederlanden und im Vereinigten Königreich bestehen derartige Systeme bereits. Diese sind jedoch gegensätzlich konzipiert. Während der ‚National Health Service (NHS)‘ in Großbritannien und Nordirland ein rein steuerfinanziertes sowie gesetzliches System ist, existieren in den Niederlanden private Krankenversicherungsträger. Jeder Einwohner der Niederlande ist verpflichtet, bei einem von ihnen einen Vertrag abzuschließen.
In der vorliegenden Hausarbeit wird untersucht, wie sich die beiden gegensätzlichen Versicherungssysteme auf die medizinische Versorgungsqualität des jeweiligen Landes auswirken. Für die Beantwortung dieser Fragestellung ist beabsichtigt, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Systeme im Rahmen eines Querschnittsvergleichs zu ermitteln und die medizinische Versorgungsqualität im jeweiligen Land anhand einer eigens entwickelten Matrix vergleichend zu bewerten. Aufgrund des begrenzten Umfangs dieser Arbeit und zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit wird dabei lediglich auf die Basisabsicherung beider Systeme eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Analyserahmen
- Bürgerversicherung
- Merkmale einer Krankenversicherung
- Einflussfaktoren auf Krankenversicherungssysteme
- Entwicklung einer Bewertungsmatrix
- Bürgerversicherungssysteme in den Niederlanden und im Vereinigten Königreich
- Bürgerversicherung in den Niederlanden
- Bürgerversicherung im Vereinigten Königreich
- Ländervergleich und Bewertung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert die Bürgerversicherungssysteme in den Niederlanden und im Vereinigten Königreich, um die Auswirkungen auf die medizinische Versorgungsqualität in beiden Ländern zu untersuchen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Systeme im Rahmen eines Querschnittsvergleichs und bewertet die medizinische Versorgungsqualität anhand einer eigens entwickelten Matrix.
- Definition und Charakterisierung des Begriffs "Bürgerversicherung"
- Wesentliche Merkmale von Krankenversicherungssystemen und ihre Einflussfaktoren
- Entwicklung einer Bewertungsmatrix für den Vergleich von Krankenversicherungssystemen
- Deskriptive Beschreibung der Bürgerversicherungssysteme in den Niederlanden und im Vereinigten Königreich
- Vergleichende Analyse und Bewertung der beiden Systeme
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel führt in die Thematik der Bürgerversicherung ein und beleuchtet die aktuelle Debatte in Deutschland. Es werden die Bürgerversicherungssysteme in den Niederlanden und im Vereinigten Königreich als vergleichbare Beispiele vorgestellt.
- Kapitel zwei definiert den Begriff "Bürgerversicherung" und stellt den theoretischen Untersuchungsrahmen vor. Eine Literaturanalyse identifiziert die wichtigsten Merkmale von Krankenversicherungssystemen und erörtert die Einflussfaktoren, die auf sie wirken. Auf dieser Grundlage wird eine Bewertungsmatrix entwickelt.
- Kapitel drei beschreibt detailliert das Krankenversicherungssystem in den Niederlanden und das System im Vereinigten Königreich. Dabei werden die jeweiligen Besonderheiten und Herausforderungen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Bürgerversicherung, Krankenversicherung, Niederlande, Vereinigtes Königreich, medizinische Versorgungsqualität, Ländervergleich, Bewertungsmatrix, Einflussfaktoren, Merkmale, Finanzierungsmodelle, solidarisches System, Gesundheitsleistungen.
- Quote paper
- Simon Winzer (Author), 2022, Die Bürgerversicherungen in den Niederlanden und im Vereinigten Königreich im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1313376