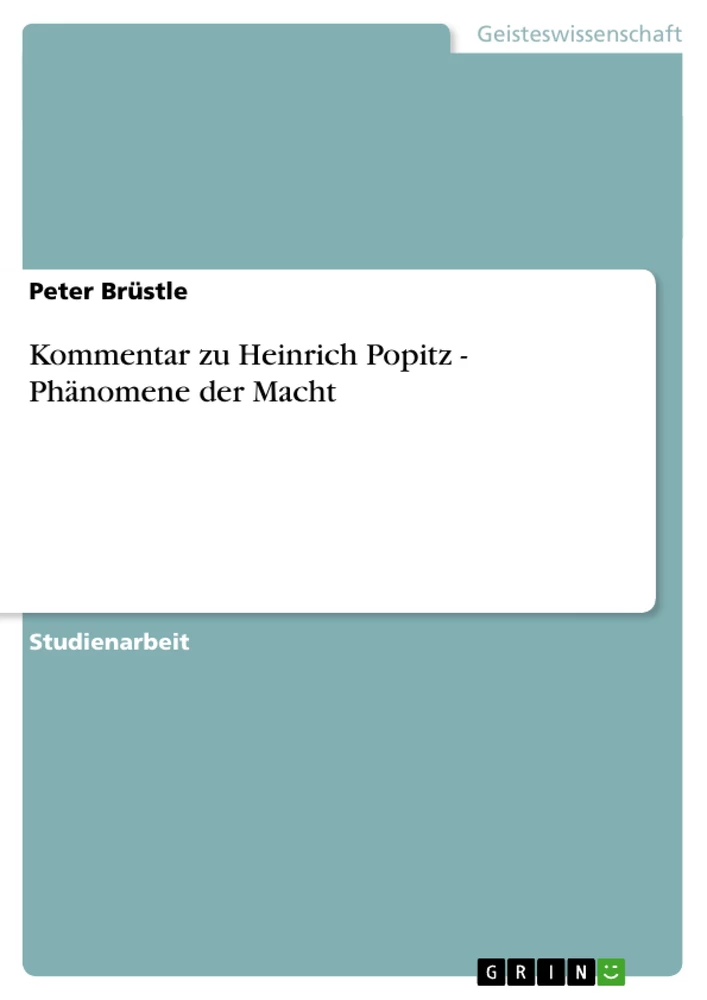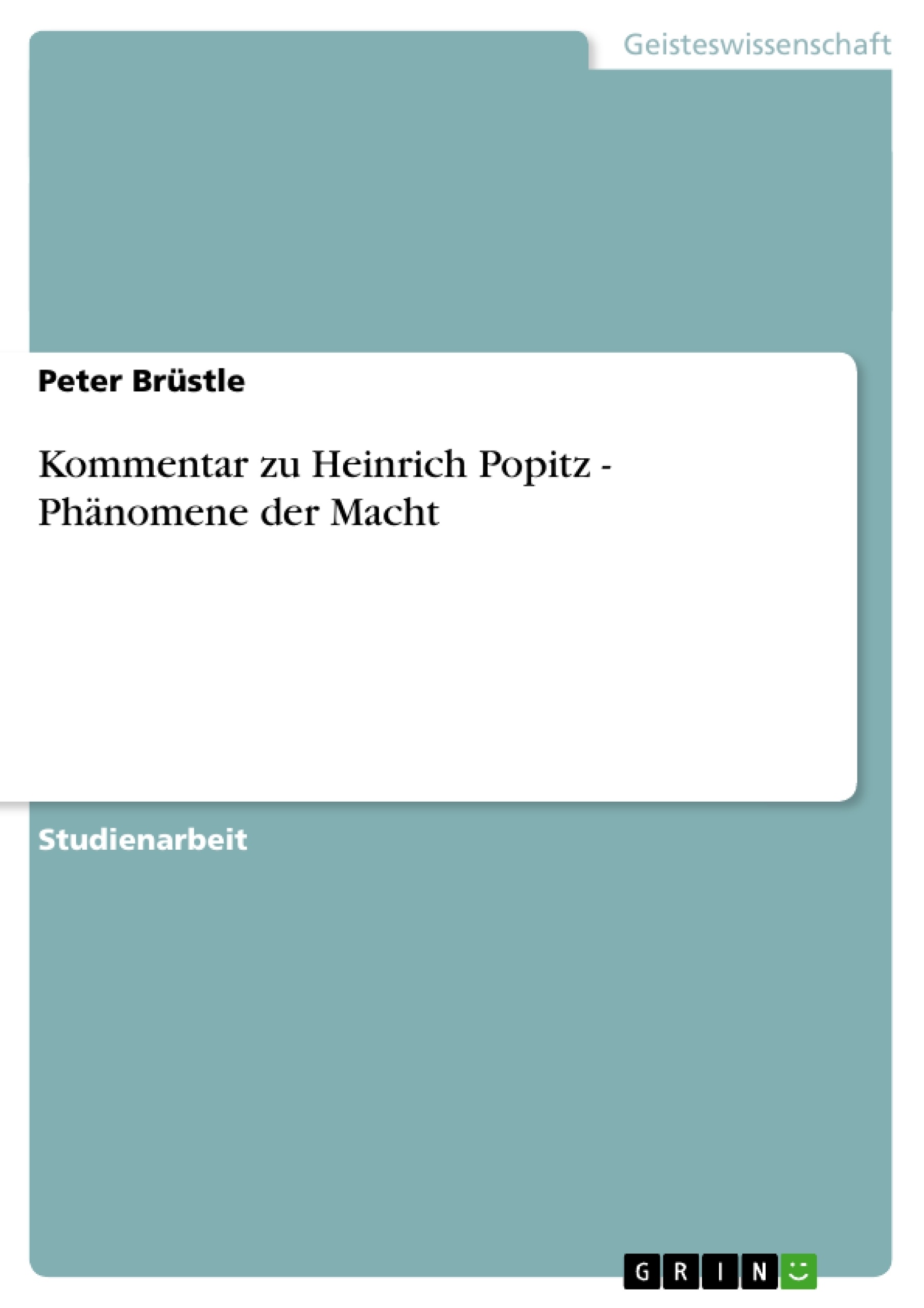Ein Blick auf die Titelseite der Zeit vom 20. Februar 2003 gibt Auskunft über die derzeitige politische Lage bezüglich eines drohenden zweiten Irak-Krieges: "Der kommende Krieg: Europa ist machtlos. Washingtons Rückzug findet nicht statt." Deutschlands Bundeskanzler Gerhard Schröder hat sich dem internationalen Druck gebeugt und der Autorität der USA Zugeständnisse gemacht. Somit schließt er die Anwendung von Gewalt als "ultima ratio", als letztes ordnungsstiftendes Mittel nicht mehr aus. Die USA beharren weiterhin auf ihrer militärischen "Vormachtstellung", die es aufrechtzuerhalten gilt, vor allem angesichts der drohenden Gewalt terroristischer Attentate, der selbst sie ausgesetzt sind. Dagegen hoffen die Millionen von Demonstrierenden der letzten Tage, die Macht der öffentlichen Meinung könne sich doch noch gegen die verschiedenen Interessen der Politik durchsetzen und eine friedliche Lösung des Konflikts erreichen.
Dieser Ausschnitt der gegenwärtigen politischen Lage verdeutlicht die verschiedenen Beziehungen, die die jeweiligen Machttypen miteinander eingehen und macht klar, was für eine Bedeutung dem Begriff der Macht zukommt. Nicht nur allein im Bereich der internationalen Politik, sondern auch in den gewöhnlichen gesellschaftlichen Interaktionen spielt die Erscheinung Macht eine fast allgegenwärtige Rolle. Dieser Auffassung ist jedenfalls Heinrich Popitz, der mit seinem 1992 erschienenen Buch Phänomene der Macht eine gründliche Interpretation des menschlichen Machtbegriffs liefert und untersucht, auf welchen Voraussetzungen dieser beruht. Seine Argumentation geht hauptsächlich von der Annahme aus, daß Macht in der menschlichen Natur liegt und omnipräsent, weil gesellschaftlich bedingt ist. Das kommt auch in dem Gedanken von der "Veralltäglichung zentrierter Herrschaft" in modernen Gesellschaften zum Ausdruck.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil: Macht als alltägliches soziales Phänomen
- II.1 Verletzende Aktionsmacht
- II.2 Instrumentelle Macht
- II.3 Autoritative Macht
- II.4 Datensetzende Macht
- II.5 Stabilisierungsformen von Machtverhältnissen
- III Autoritative Macht im Milgram-Experiment
- IV. Rezensionen
- V. Schlußfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Aufsatz analysiert Heinrich Popitz’ Werk "Phänomene der Macht" und untersucht, wie der Autor den Begriff der Macht in seiner alltäglichen und gesellschaftlichen Dimension beleuchtet. Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung der vier "Grundformen der Macht" und deren Verfestigung in gesellschaftlichen Strukturen.
- Macht als allgegenwärtiges soziales Phänomen
- Die vier Grundformen der Macht: Aktionsmacht, Instrumentelle Macht, Autoritative Macht und Datensetzende Macht
- Die Stabilisierung von Machtverhältnissen
- Die Autoritative Macht im Kontext des Milgram-Experiments
- Rezeption von "Phänomene der Macht" in der Wissenschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt den aktuellen politischen Kontext des drohenden Irak-Krieges 2003 als Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit Machtbegriffen dar. Popitz' Werk wird als grundlegende Interpretation des Machtbegriffs vorgestellt und die Prämissen seiner Argumentation werden erläutert.
Der Hauptteil widmet sich der Analyse von Macht als alltäglichem sozialem Phänomen. Popitz' Definition von Macht als "jeder Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen" (Weber: 28) wird erläutert und die Herausforderungen, die mit einer wissenschaftlichen Analyse von Macht verbunden sind, aufgezeigt. Der Autor identifiziert vier "nicht weiter reduzierbare ... Grundformen der Macht" (23), die in verschiedener Weise mit sozialem Handeln und lebensbestimmenden Abhängigkeiten verbunden sind: Aktionsmacht, Instrumentelle Macht, Autoritative Macht und Datensetzende Macht.
Das Kapitel "Verletzende Aktionsmacht" definiert die ursprünglichste und direkteste Form von Machtausübung als Aktionsmacht oder Verletzungsmacht, die auf der Verletzlichkeit des menschlichen Körpers basiert. Popitz differenziert den Begriff Verletzungsmacht in drei Gruppen, die sich durch Minderung sozialer Teilhabe, materielle Schädigung und körperliche Verletzung auszeichnen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themen des Textes sind: Macht, soziale Interaktion, Aktionsmacht, Instrumentelle Macht, Autoritative Macht, Datensetzende Macht, Machtstrukturen, gesellschaftliche Stabilisierung, Milgram-Experiment, wissenschaftliche Rezeption.
- Quote paper
- Peter Brüstle (Author), 2003, Kommentar zu Heinrich Popitz - Phänomene der Macht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13147