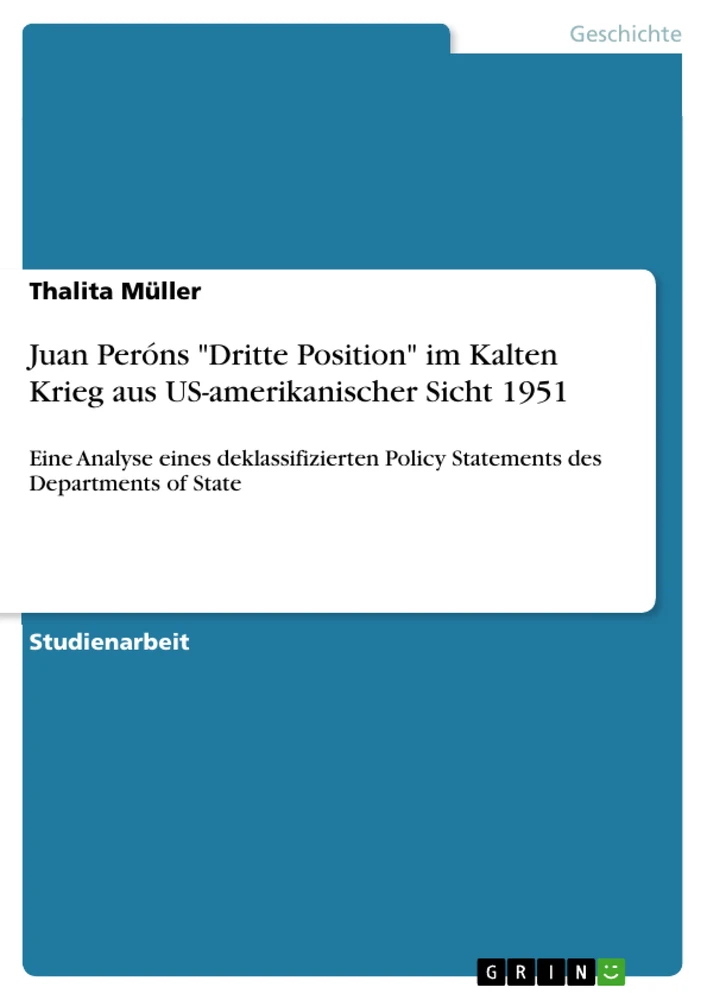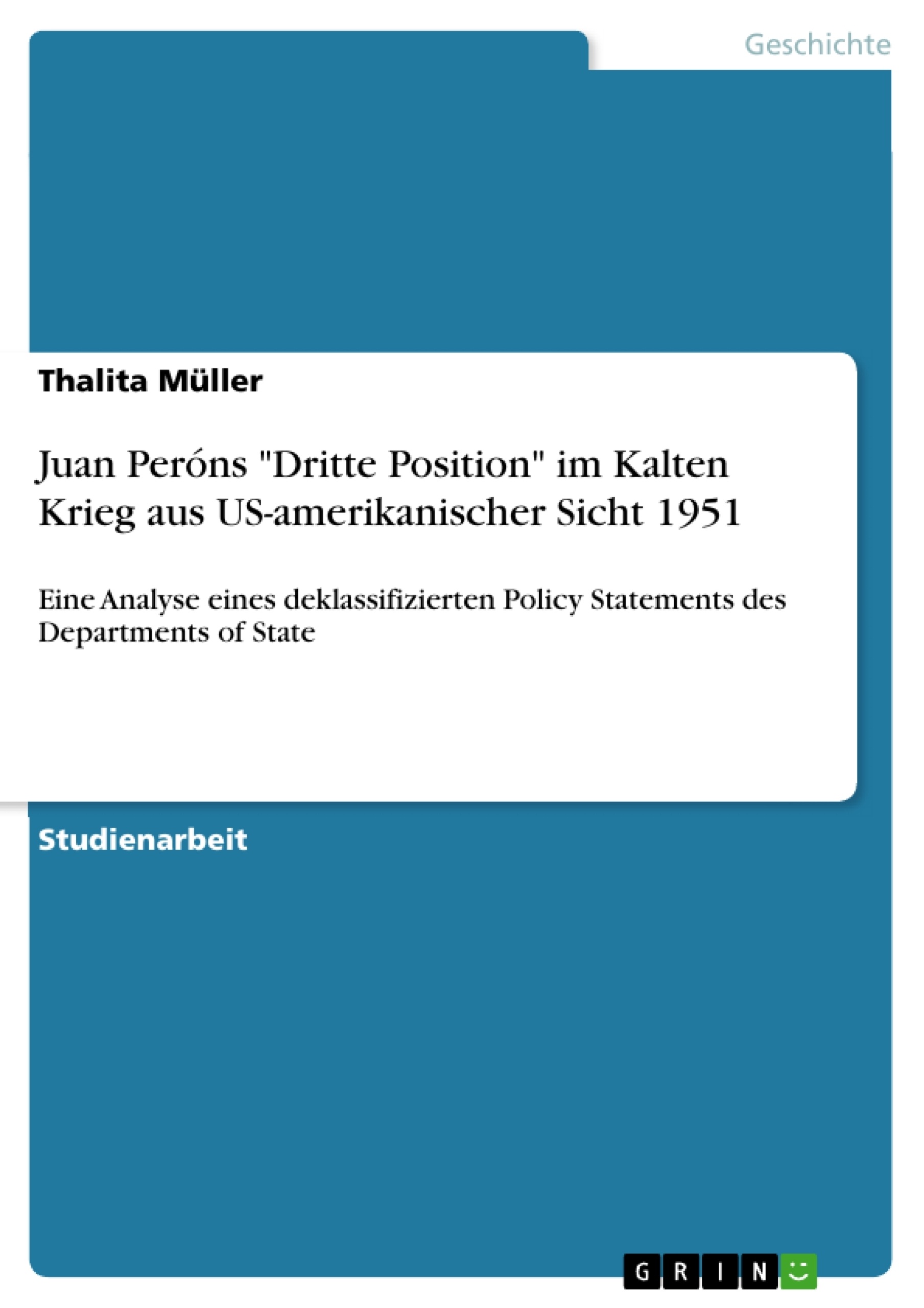Die Arbeit beantwortet die Frage, wie neutral sich Argentinien unter Juan Peróns erster Präsidentschaft im Kalten Krieg nach Einschätzung des Außenministeriums der Vereinigten Staaten im Jahr 1951 verhielt. Dazu wird zunächst kurz ein Kontext zu Juan Peróns Politik in seiner ersten Präsidentschaft gegeben. Danach wird gezeigt, wie die Quelle die Neutralität der Dritten Position inmitten des Kalten Krieges auffasste. Hierbei werden vier Kategorien untersucht: die wirtschaftlichen Beziehungen, die diplomatische Kooperation auf internationaler Bühne sowie die militärische Zusammenarbeit und schließlich die innenpolitische Haltung und öffentliche Stimmung gegenüber den USA in Argentinien.
Dazu soll zunächst der Bericht einer für diese Analyse zuträgliche Reihenfolge wiedergegeben werden, um die Inhalte dann jeweils auf ihre Unparteilichkeit im Ost-West-Konflikt zu untersuchen. Die verwendete untermauernde Sekundärliteratur stammt bewusst zu großen Teilen aus den Federn argentinischer Autoren, da diese in den letzten Jahren ein besonderes Engagement in der Aufarbeitung in ihrer populistischen und diktatorischen Vergangenheit aus multidisziplinären Ansätzen geleistet haben.
Wegen der höchst kritischen Medienberichtung und der öffentlichen Meinung in den USA über Argentinien in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, ist lange davon ausgegangen worden, dass sich Buenos Aires und Washington feindlich gegenüberstanden. Erst jüngste akademische Arbeiten beginnen diese Annahme anzuzweifeln und argumentieren, dass die schlechte Presse damals nicht zwangsläufig die Meinung der politischen Entscheidungsträger wiederspielte. Die bisherige These der Animosität der beiden amerikanischen Staaten geht primär darauf zurück, dass angenommen wurde, dass Washington Argentiniens Neutralität angesichts des Endes der 1940er Jahre anbrechenden Kalten Krieg nicht guthieß.
Inhaltsverzeichnis
- Die Feindlichkeit zwischen Argentinien und den USA zu Beginn des Kalten Krieges - ein Mythos?
- Argentinien unter Juan Peróns erster Präsidentschaft (1946-1952)
- Der Peronismus
- Die „Dritte Position“
- Die faktische Neutralität Argentiniens im Kalten Krieg in der Wahrnehmung des US-amerikanischen Department of States 1951
- Ökonomische Außenbeziehungen
- Diplomatische Kooperation auf internationaler Ebene
- Militärische Zusammenarbeit
- Öffentliche und innenpolitische Stimmung in Argentinien gegenüber den USA
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Neutralität Argentiniens im Kalten Krieg aus der Perspektive des US-amerikanischen Department of State im Jahr 1951, basierend auf einem deklassifizierten Policy Statement.
- Die „Dritte Position“ Juan Peróns als argentinische Alternative zum Westen und Osten
- Die innen- und außenpolitische Ausrichtung Argentiniens unter Perón
- Die Wahrnehmung Argentiniens durch das US-Außenministerium
- Die wirtschaftlichen, diplomatischen und militärischen Beziehungen zwischen Argentinien und den USA
- Die Bedeutung des Peronismus im Kontext des Kalten Krieges
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel hinterfragt die Annahme einer Feindschaft zwischen Argentinien und den USA zu Beginn des Kalten Krieges. Das zweite Kapitel beleuchtet die Politik Argentiniens unter Juan Peróns erster Präsidentschaft, insbesondere den Peronismus und das Konzept der „Dritten Position“. Das dritte Kapitel untersucht die faktische Neutralität Argentiniens im Kalten Krieg aus der Sicht des US-amerikanischen Department of State im Jahr 1951, wobei die wirtschaftlichen, diplomatischen und militärischen Beziehungen sowie die öffentliche Stimmung in Argentinien gegenüber den USA analysiert werden.
Schlüsselwörter
Juan Perón, Peronismus, „Dritte Position“, Kalter Krieg, Argentinien, USA, Neutralität, Außenpolitik, wirtschaftliche Beziehungen, diplomatische Beziehungen, militärische Zusammenarbeit, innenpolitische Stimmung.
Häufig gestellte Fragen
Was war Juan Peróns „Dritte Position“?
Es war Peróns außenpolitisches Konzept, das Argentinien als neutralen Weg zwischen dem westlichen Kapitalismus und dem östlichen Kommunismus positionierte.
Wie sahen die USA Argentiniens Neutralität im Jahr 1951?
Die Arbeit analysiert ein Policy Statement des US-Außenministeriums, um zu klären, wie neutral Argentinien in den Bereichen Wirtschaft, Diplomatie und Militär tatsächlich wahrgenommen wurde.
Gab es eine militärische Zusammenarbeit zwischen den USA und Perón?
Das ist eine der untersuchten Kategorien, um die tatsächliche Unparteilichkeit Argentiniens im Ost-West-Konflikt zu bewerten.
War die Beziehung zwischen Washington und Buenos Aires feindselig?
Obwohl Medienberichte oft Feindseligkeit suggerierten, argumentiert die Arbeit, dass die politische Einschätzung der US-Entscheidungsträger differenzierter war.
Warum wird in der Arbeit verstärkt argentinische Sekundärliteratur genutzt?
Um die multidisziplinäre Aufarbeitung der populistischen und diktatorischen Vergangenheit Argentiniens aus lokaler Perspektive einzubeziehen.
- Citation du texte
- Thalita Müller (Auteur), 2022, Juan Peróns "Dritte Position" im Kalten Krieg aus US-amerikanischer Sicht 1951, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1316021