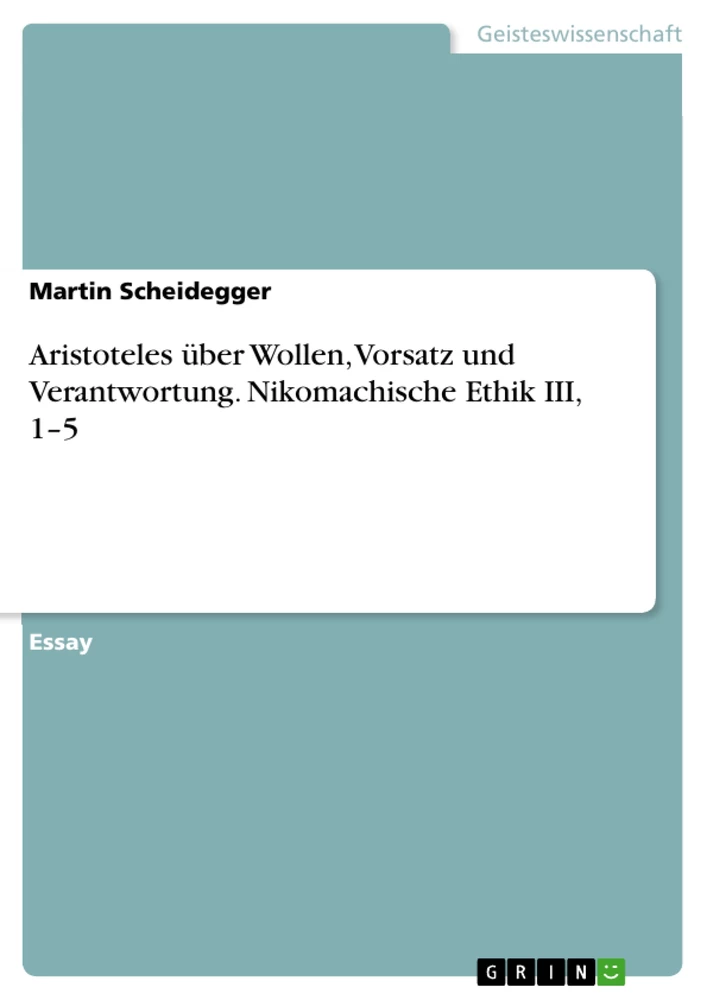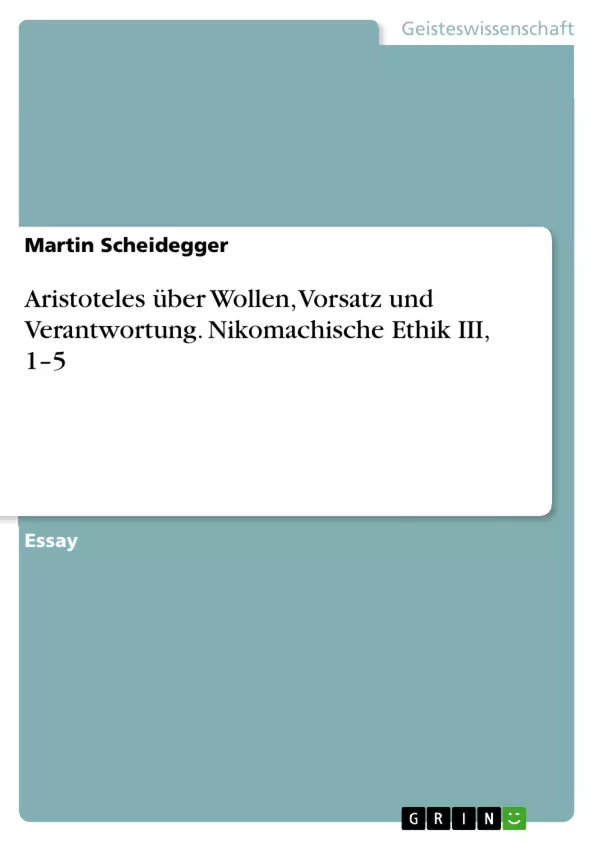Worum geht es in Aristoteles' Untersuchung über Wollen, Vorsatz und Verantwortung (Nikomachische Ethik III, 1-5)?
Aristoteles untersucht die Bedingungen, unter denen Menschen für ihr Handeln verantwortlich gemacht werden können. Er unterscheidet zwischen gewolltem, ungewolltem und gemischtem Verhalten, wobei nur gewolltes Verhalten zu Verantwortlichkeit führt.