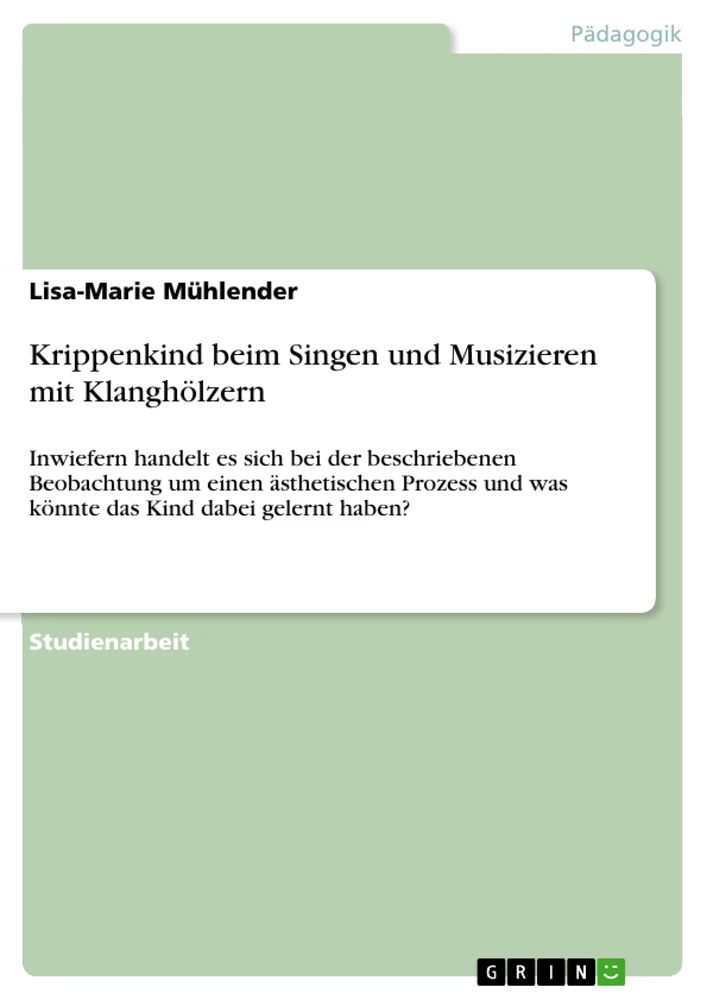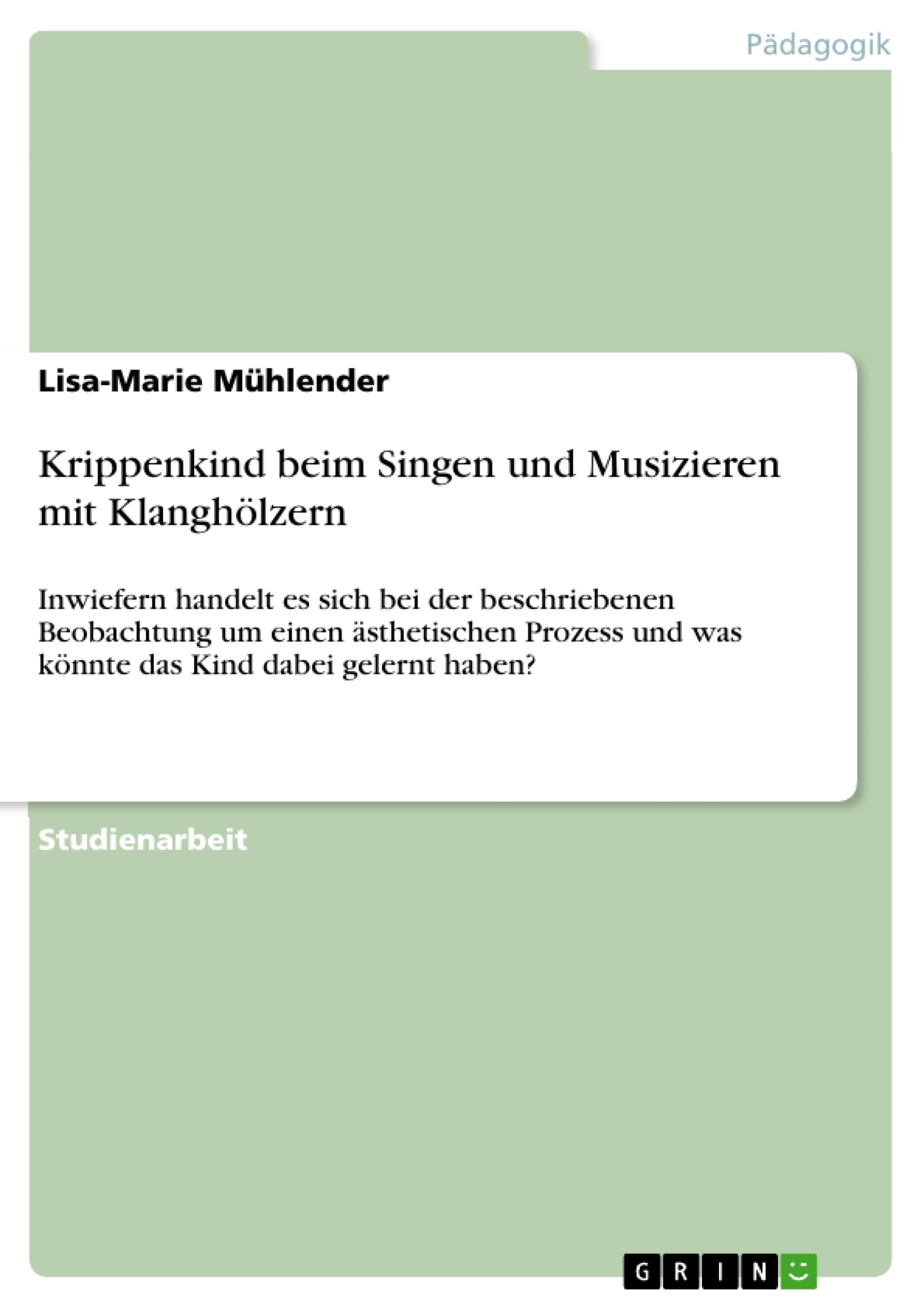Der Autor und Professor für Musikpädagogik Christian Rolle vertritt die Meinung, dass musikalische Bildung nur dann stattfinden kann, „wenn Menschen in musikalischer Praxis ästhetische Erfahrungen machen“. Weiter führt er aus, dass pädagogisches Handeln demnach Räume schaffen sollte, die ästhetische Erfahrungen und Prozesse ermöglichen und anregen. In der vorliegenden Arbeit geht es um musikalisch-ästhetische Bildungsprozesse bei Kindern. Ausgangspunkt ist dabei eine Beobachtung eines 2-jährigen Mädchens, das in einem Musikkurs für Krippenkinder musikalisch tätig ist. Bei der Beobachtung handelt es sich um eine systematische und verdeckte Beobachtung. Das bedeutet, dass die Beobachtung vorher bereits geplant war und die Beobachterin aus der Distanz beobachten konnte. Sie ist selbstverständlich wertfrei und objektiv, das heißt von den Eindrücken der Beobachterin unbeeinflusst, dokumentiert. Außerdem wurde dem Ablaufplan von Strätz und Demandewitz weitestgehend gefolgt: Zunächst wurde ein Anliegen formuliert, dann ein Beobachtungsziel benannt und die Beobachtungsmethode ausgewählt. Anschließend wurde die Beobachtung durchgeführt und dokumentiert und die Ergebnisse analysiert.
Ziel dieser Arbeit ist es zu überprüfen, inwiefern es sich bei der beschriebenen Beobachtung um einen ästhetischen Prozess handelt und was das Kind dabei gelernt haben könnte. Hierfür wird im ersten Teil der Arbeit die ästhetische Bildung vorgestellt. Der Begriff wird eingangs erläutert, dann folgen die Merkmale eines ästhetischen Prozesses und ästhetische Bildungsprozesse in der frühen Kindheit. Aufbauend auf der ästhetischen Bildung wird die Beobachtung detailliert geschildert und im darauffolgenden Kapitel analysiert. Abschließend folgt ein Fazit, in dem die wichtigsten Punkte zusammengefasst und eventuelle Schlussfolgerungen für die Praxis genannt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Ästhetische Bildung
- 2.1 Begriffserklärung
- 2.2 Merkmale eines ästhetischen Prozesses
- 2.3 Ästhetische Bildungsprozesse in der frühen Kindheit
- 3. Beobachtung
- 4. Analyse
- 5. Fazit
- 6. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit musikalisch-ästhetischen Bildungsprozessen bei Kindern im Krippenalter. Sie untersucht die Beobachtung eines 2-jährigen Mädchens in einem Musikkurs und analysiert, ob es sich um einen ästhetischen Prozess handelt und welche Lernerfahrungen das Kind dabei gemacht haben könnte.
- Definition und Merkmale ästhetischer Bildung
- Beschreibung eines ästhetischen Prozesses anhand der Merkmale Selbstaufmerksamkeit, Ausdruckscharakter, Unbestimmtheitscharakter und Vollkommenheitscharakter
- Ästhetische Bildungsprozesse in der frühen Kindheit
- Analyse der beobachteten Situation
- Schlussfolgerungen für die Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und erläutert die theoretische Grundlage, die den Beobachtungen zugrunde liegt. Der Autor Christian Rolle betont die Bedeutung von ästhetischen Erfahrungen für musikalische Bildungsprozesse.
- Kapitel 2: Ästhetische Bildung
Dieses Kapitel definiert den Begriff der ästhetischen Bildung und beleuchtet seine Bedeutung in der frühen Kindheit. Es werden die Merkmale eines ästhetischen Prozesses und deren Bedeutung für die Entwicklung der Kinder erläutert.
- Kapitel 3: Beobachtung
Das Kapitel beschreibt die Beobachtung eines 2-jährigen Mädchens, das in einem Musikkurs für Krippenkinder musikalisch aktiv ist. Die Beobachtung wurde systematisch und verdeckt durchgeführt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit widmet sich den Themen der ästhetischen Bildung, insbesondere in Bezug auf musikalische Erfahrungen in der frühen Kindheit. Im Zentrum steht die Analyse eines Beobachtungsbeispiels, das Einblicke in die Entwicklung und die Lernprozesse von Kindern im Krippenalter ermöglicht. Zentrale Begriffe sind ästhetischer Prozess, Selbstaufmerksamkeit, Ausdruckscharakter, Unbestimmtheitscharakter, Vollkommenheitscharakter, Musikpädagogik und musikalische Bildung.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet ästhetische Bildung bei Kleinkindern?
Es geht um Bildungsprozesse, die durch sinnliche Wahrnehmung und ästhetische Erfahrungen in der Praxis (z.B. Musizieren) angeregt werden.
Welche Merkmale kennzeichnen einen ästhetischen Prozess?
Zentrale Merkmale sind Selbstaufmerksamkeit, Ausdruckscharakter, Unbestimmtheitscharakter und Vollkommenheitscharakter.
Wie wurde das Kind in der Studie beobachtet?
Es wurde eine systematische und verdeckte Beobachtung eines 2-jährigen Mädchens in einem Musikkurs durchgeführt.
Warum sind Klanghölzer für Krippenkinder geeignet?
Sie ermöglichen einfache rhythmische Erfahrungen und fördern die auditive Wahrnehmung sowie die Feinmotorik im Rahmen musikalischer Früherziehung.
Welche Rolle spielt der Pädagoge laut Christian Rolle?
Pädagogen sollten Räume schaffen, die ästhetische Erfahrungen ermöglichen und die Kinder in ihrer musikalischen Praxis anregen.
- Quote paper
- Lisa-Marie Mühlender (Author), 2019, Krippenkind beim Singen und Musizieren mit Klanghölzern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1316473