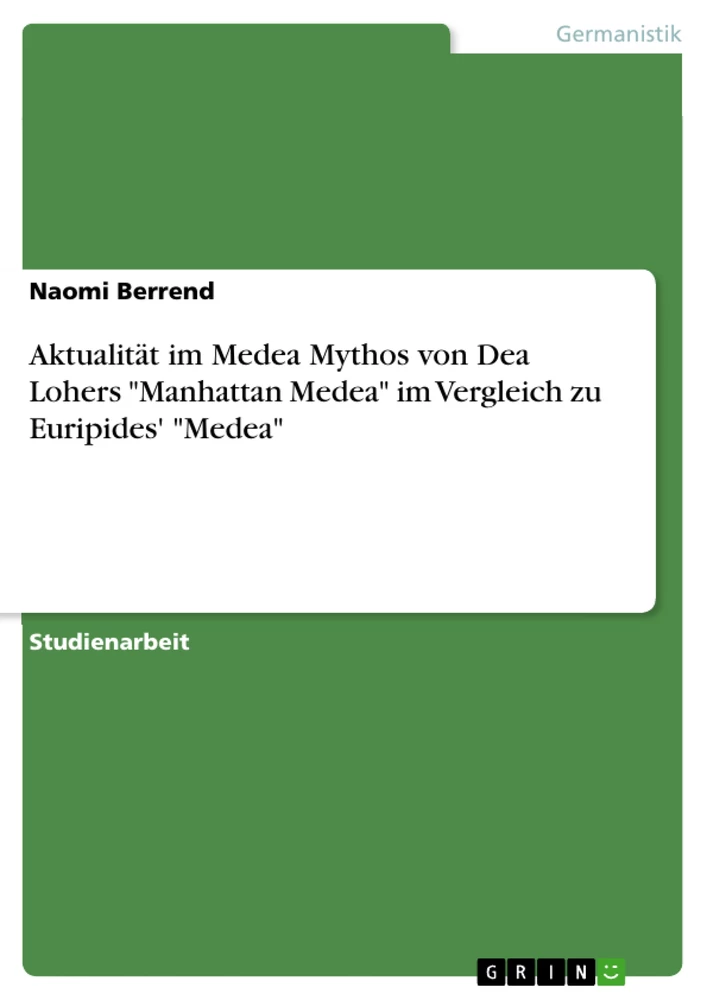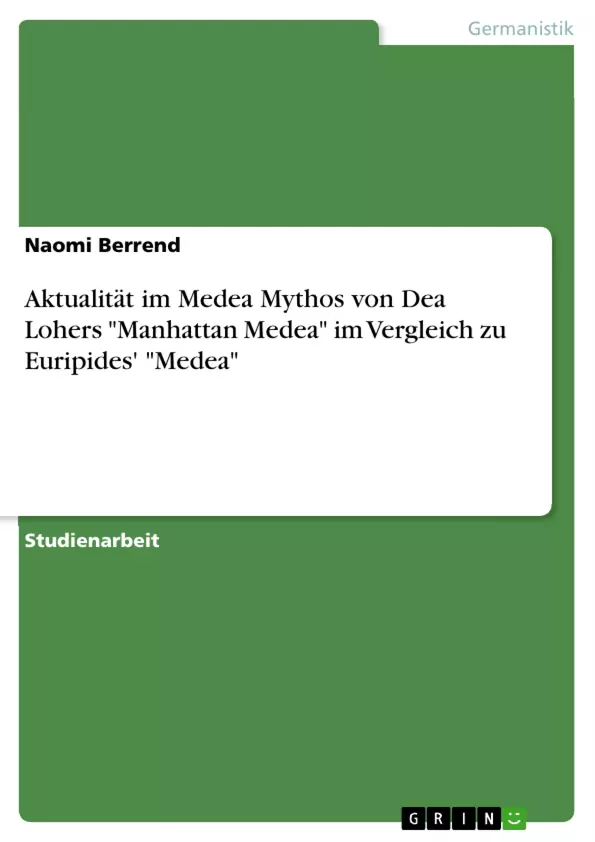Diese Arbeit untersucht den Aspekt der Aktualität im Medea Mythos von Dea Lohers "Manhattan Medea" im Vergleich zu Euripides' "Medea".
Der antike Mythos der Kindermörderin Medea kann bereits auf den griechischen Tragödiendichter Euripides zurückgeführt werden und hat auch daraufhin im Laufe der Weltgeschichte seine tragende Bedeutung nicht einbüßen müssen. Von der antiken Fassung des Euripides von 431 vor Christus bis zur modernen "Manhattan Medea" von Dea Loher aus dem Jahre 1999 lässt sich der Bogen spannen und so die Aspekte der Aktualität und Modernität des Mythos nicht nur veranschaulichen, sondern auch bezeugen. Die Begrifflichkeit des Mythos lässt sich mehrdeutig definieren, wie man im Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft nachlesen kann, denn es ist einerseits eine "erzählende Darstellung von kollektiv bedeutsamen Orten und Figuren oder Naturphänomenen, in aller Regel mit religiöser und kultischer Dimension" , aber es ist auch ein "Weltverhältnis, über dessen Eigenschaften […] immer wieder neu spekuliert wird". Neuinszenierungen und Adaptionen des Mythos, sei es in Form von Roman, Lyrik oder Drama, hat es im Laufe der Geschichte zur Genüge gegeben, um eindeutig verbildlichen zu können, dass dieser Mythos aus der Antike eine zeitlose Relevanz hat und ein gegenwartsbezogenes Interesse aufzeigt.
Die Aktualität des Mythos lässt sich anhand von Dea Lohers "Manhattan Medea" ausführlich begutachten und analysieren. Der Duden, das deutsche Universalwörterbuch, definiert die Begrifflichkeit der Aktualität als "Bedeutsamkeit für die unmittelbare Gegenwart, [als] Gegenwartsbezogenheit [oder] Zeitnähe".
Inhaltsverzeichnis
- Moderne vs. Antike
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Aktualität des Medea-Mythos anhand eines Vergleichs zwischen Euripides' "Medea" und Dea Lohers "Manhattan Medea". Das Ziel ist es, die zeitlose Relevanz des Mythos aufzuzeigen und die Art und Weise zu analysieren, wie Loher den Mythos in einen modernen Kontext überträgt.
- Der Vergleich der modernen und antiken Darstellung des Medea-Mythos
- Die Transformation der Figuren und des Settings in Lohers Stück
- Die Darstellung sozialer und wirtschaftlicher Ungleichheit in "Manhattan Medea"
- Die Aktualisierung des Themas Rache und die Motivationen der Protagonisten
- Die Tragik des Scheiterns und der Aussichtslosigkeit im modernen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Moderne vs. Antike: Der Vergleich zwischen Euripides' "Medea" und Lohers "Manhattan Medea" zeigt eine deutliche Transformation des Settings und der Figuren. Das antike Korinth wird durch das moderne New York ersetzt, der Königspalast durch ein reiches Haus an der 5th Avenue. Die traditionellen Nebenfiguren werden durch Außenseiter der Gesellschaft ersetzt, wie einen Türsteher und einen tauben Transvestiten. Medea und Jason sind keine Mitglieder des Adels, sondern Flüchtlinge aus Mazedonien, die in Amerika nach einem besseren Leben suchen. Während das Setting und die Figuren modernisiert werden, bleibt der Kern der antiken Sage – Flucht, Mord, Ehebruch – erhalten. Loher verzerrt und ironisiert die klassischen Elemente, präsentiert aber gleichzeitig die zeitlose Tragik des menschlichen Scheiterns und der sozialen Ungerechtigkeit. Die Figuren kämpfen mit Armut, Unglück und Ungerechtigkeit, streben nach einem besseren Leben, finden aber nur Aussichtslosigkeit und ein Leben in ständiger Angst vor Armut und Verfolgung. Das Stück beleuchtet die existentielle Tragik von Menschen, die in der Gesellschaft keinen Platz finden und die trotz ihrer Ambitionen an ihren Umständen scheitern. Der Vergleich hebt die zeitlose Natur des Mythos hervor, indem er die zentralen Konflikte in einen neuen Kontext überträgt und damit ihre anhaltende Relevanz betont.
Schlüsselwörter
Medea-Mythos, Euripides, Dea Loher, Manhattan Medea, Aktualität, Moderne, Antike, soziale Ungleichheit, Armut, Flüchtlinge, Tragik, Rache, Außenseiter, gesellschaftliche Verhältnisse, zeitlose Relevanz.
Häufig gestellte Fragen zu: Vergleich von Euripides' "Medea" und Dea Lohers "Manhattan Medea"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht Euripides' "Medea" mit Dea Lohers "Manhattan Medea", um die zeitlose Relevanz des Medea-Mythos aufzuzeigen und die Adaption des Mythos in einen modernen Kontext zu analysieren.
Welche Themen werden im Vergleich behandelt?
Der Vergleich umfasst die Transformation des Settings und der Figuren, die Darstellung sozialer und wirtschaftlicher Ungleichheit in "Manhattan Medea", die Aktualisierung des Themas Rache, die Motivationen der Protagonisten, und die Tragik des Scheiterns und der Aussichtslosigkeit im modernen Kontext.
Wie unterscheidet sich die moderne von der antiken Darstellung des Mythos?
Das antike Korinth wird in Lohers Stück durch das moderne New York ersetzt, der Königspalast durch ein reiches Haus. Die traditionellen Nebenfiguren werden durch Außenseiter der Gesellschaft ersetzt. Medea und Jason sind keine Mitglieder des Adels mehr, sondern Flüchtlinge aus Mazedonien, die in Amerika nach einem besseren Leben suchen. Während das Setting und die Figuren modernisiert werden, bleiben die zentralen Elemente der antiken Sage (Flucht, Mord, Ehebruch) erhalten, jedoch verzerrt und ironisiert.
Welche Rolle spielen soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten in "Manhattan Medea"?
In "Manhattan Medea" kämpfen die Figuren mit Armut, Unglück und Ungerechtigkeit. Das Stück beleuchtet die existentielle Tragik von Menschen, die in der Gesellschaft keinen Platz finden und trotz ihrer Ambitionen an ihren Umständen scheitern. Die soziale und wirtschaftliche Ungleichheit ist ein zentraler Aspekt, der die Handlung und die Motivationen der Figuren prägt.
Wie wird das Thema Rache in den beiden Stücken dargestellt?
Der Vergleich analysiert die Aktualisierung des Themas Rache und untersucht die Motivationen der Protagonisten in beiden Stücken im Kontext der dargestellten sozialen und wirtschaftlichen Umstände. Die zeitlose Natur des Rachemotivs wird im Vergleich hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Medea-Mythos, Euripides, Dea Loher, Manhattan Medea, Aktualität, Moderne, Antike, soziale Ungleichheit, Armut, Flüchtlinge, Tragik, Rache, Außenseiter, gesellschaftliche Verhältnisse, zeitlose Relevanz.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet mindestens ein Kapitel, welches einen Vergleich zwischen der antiken und der modernen Darstellung des Medea-Mythos vornimmt. Weitere Kapitel könnten sich mit den einzelnen Aspekten (z.B. soziale Ungleichheit, Rache, Tragik) auseinandersetzen.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung ist es, die zeitlose Relevanz des Medea-Mythos aufzuzeigen und die Art und Weise zu analysieren, wie Dea Loher den Mythos in einen modernen Kontext überträgt. Der Fokus liegt auf dem Vergleich beider Werke und der Herausarbeitung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede.
- Citation du texte
- Naomi Berrend (Auteur), 2018, Aktualität im Medea Mythos von Dea Lohers "Manhattan Medea" im Vergleich zu Euripides' "Medea", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1318437