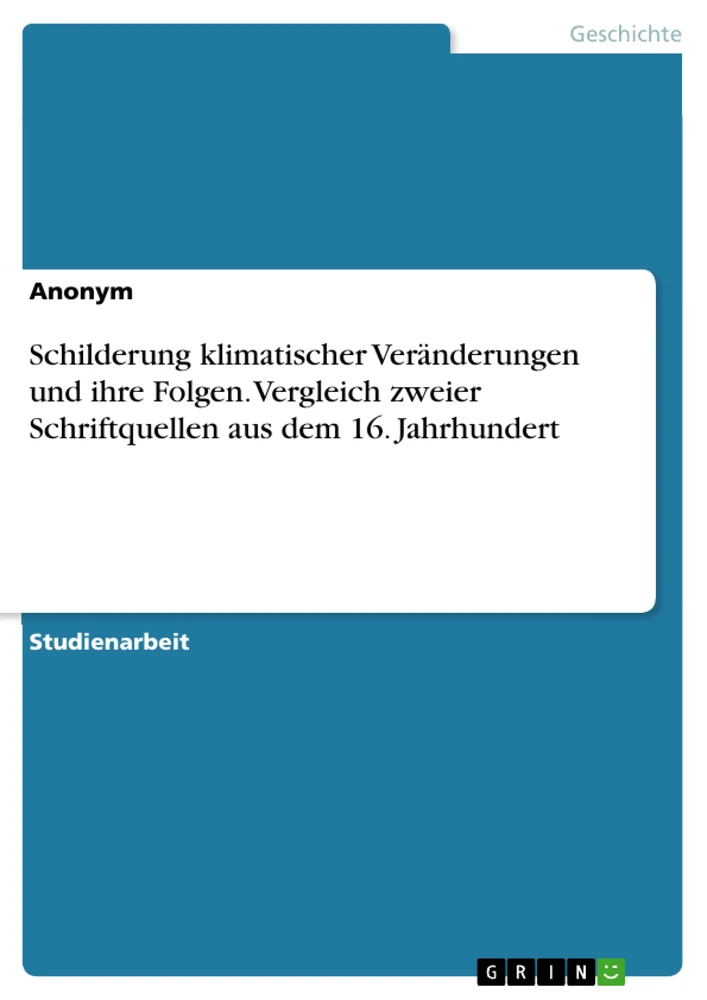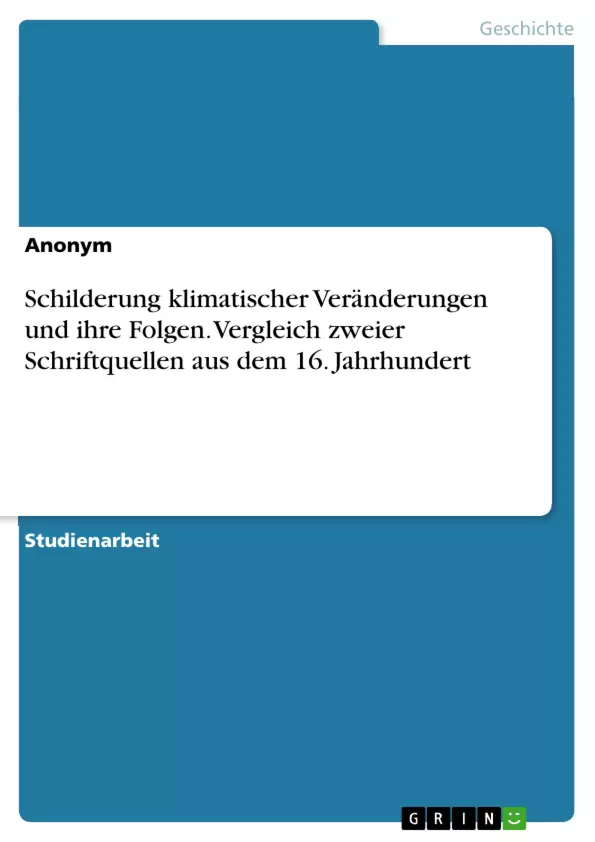In Hinblick auf die Fragestellung sollen in dieser Hausarbeit zunächst die allgemeinen Auswirkungen, der in den Quellen dargestellten Klimaanomalien, mittels des Modells nach Kates skizziert werden. Danach werden die beiden Schriftstücke jeweils einzeln daraufhin untersucht, welche Ursachen für das veränderte Klima benannt werden und wie mit den neuen Umständen umgegangen wird. Hierbei soll der Schwerpunkt bewusst nicht auf dem wirtschaftlichen Aspekt liegen, sondern viel mehr die Implikationen auf das Leben in der Gesellschaft herangezogen werden.
Aufbauend auf die Einzelanalysen erfolgt ein Vergleich der beiden Texte, aus dem hervorgehen soll, inwiefern die sich zeitlich relativ nahen Quellen unterscheiden bzw. ähneln. Im Schluss werden letztlich die Untersuchungsergebnisse zusammengetragen und eine Antwort auf die Fragestellung der Hausarbeit formuliert. Da sehr nah an den vorliegenden Quellen gearbeitet wird und das Augenmerk auf der subjektiven Darstellung der Quellenschreiber liegen soll, trägt Forschungsliteratur zu dem entsprechenden Themenbereich eine nachgeordnete Rolle und wird lediglich stellenweise als Ergänzung oder zur Erläuterung herangeholt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung in die „Kleine Eiszeit“ und Vorstellung der Arbeit
- 2. Quellenanalyse und -vergleich
- 2.1 Wie wirkt sich der Klimawandel aus?
- 2.1.1 „Die Teuerung zu Augsburg“
- 2.1.2 „Wahrhafftige und glaubwirdige Zeyttung“
- 2.2 Womit wird der Klimawandel begründet und wie geht man damit um?
- 2.2.1 „Die Teuerung zu Augsburg“
- 2.2.2 „Wahrhafftige und glaubwirdige Zeyttung“
- 2.3 Quellenvergleich und -interpretation
- 2.1 Wie wirkt sich der Klimawandel aus?
- 3. Beantwortung der Ausgangsfragestellung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der Kleinen Eiszeit (ca. 1300-1850) anhand eines Vergleichs zweier Schriftquellen aus den Jahren 1570/71 und 1583. Ziel ist es, die beschriebenen klimatischen Veränderungen und deren Folgen sowie die gesellschaftlichen Reaktionen darauf zu analysieren. Die Arbeit konzentriert sich dabei weniger auf wirtschaftliche Aspekte, sondern legt den Fokus auf die gesellschaftlichen Implikationen.
- Auswirkungen des Klimawandels auf die Bevölkerung
- Ursachen für den Klimawandel in den Quellen
- Gesellschaftlicher Umgang mit den Folgen des Klimawandels
- Vergleich der beiden Quellen und deren Interpretation
- Subjektivität der quellenbasierten Darstellung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung in die „Kleine Eiszeit“ und Vorstellung der Arbeit: Die Einleitung definiert den Begriff der „Kleinen Eiszeit“ und beschreibt den Forschungsansatz der Arbeit. Sie stellt die beiden ausgewählten Quellen – „Die Teuerung zu Augsburg“ und „Wahrhafftige und glaubwirdige Zeyttung“ – vor und erläutert die Forschungsfrage: Wie werden klimatische Veränderungen und ihre Folgen in diesen Quellen geschildert, und wie geht man damit um? Die Arbeit nutzt das „Ordered Impact Model“ von Kates zur Strukturierung der Analyse und betont die subjektive Natur der Quellenbeschreibungen und deren Abhängigkeit von sozialen Faktoren. Der Fokus liegt auf den gesellschaftlichen, nicht auf den wirtschaftlichen Auswirkungen des Klimawandels. Die Forschungsliteratur spielt eine untergeordnete Rolle, da der Schwerpunkt auf der direkten Quellenanalyse liegt.
2. Quellenanalyse und -vergleich: Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen des Klimawandels anhand des „Ordered Impact Models“ von Kates. Es untersucht zunächst die Darstellung der Klimafolgen in „Die Teuerung zu Augsburg“, die sich direkt auf die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und gesundheitlichen Folgen konzentriert, ohne die klimatischen Anomalien explizit zu beschreiben. Die Analyse identifiziert die betroffenen Bevölkerungsgruppen (Bauern, Kinder, Eltern) und die wirtschaftlichen Konsequenzen (Preissteigerung, Ernteausfälle). Der zweite Teil analysiert die „Wahrhafftige und glaubwirdige Zeyttung“, wobei ein ähnlicher Ansatz zur Analyse der Klimafolgen und Reaktionen verfolgt wird. Das Kapitel gipfelt in einem Vergleich der beiden Quellen, um Ähnlichkeiten und Unterschiede in der Darstellung herauszuarbeiten.
Schlüsselwörter
Kleine Eiszeit, Klimawandel, Quellenanalyse, „Die Teuerung zu Augsburg“, „Wahrhafftige und glaubwirdige Zeyttung“, gesellschaftliche Auswirkungen, Quellenvergleich, subjektive Darstellung, Frühneuzeit.
Häufig gestellte Fragen zu „Analyse zweier frühneuzeitlicher Quellen zur Kleinen Eiszeit“
Welche Quellen werden in dieser Arbeit analysiert?
Die Arbeit analysiert zwei frühneuzeitliche Quellen: „Die Teuerung zu Augsburg“ und „Wahrhafftige und glaubwirdige Zeyttung“. Diese Quellen stammen aus den Jahren 1570/71 und 1583 und beschreiben die Auswirkungen der Kleinen Eiszeit.
Was ist das zentrale Thema der Arbeit?
Das zentrale Thema ist die Untersuchung der Auswirkungen der Kleinen Eiszeit (ca. 1300-1850) auf die Gesellschaft anhand eines Vergleichs der beiden genannten Quellen. Der Fokus liegt dabei auf den gesellschaftlichen Implikationen und weniger auf den wirtschaftlichen Aspekten.
Welche Forschungsfrage wird gestellt?
Die Forschungsfrage lautet: Wie werden klimatische Veränderungen und ihre Folgen in diesen Quellen geschildert, und wie geht man damit um?
Welches Modell wird zur Strukturierung der Analyse verwendet?
Die Arbeit nutzt das „Ordered Impact Model“ von Kates zur Strukturierung der Analyse der Klimafolgen und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft.
Welche Aspekte des Klimawandels werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen des Klimawandels auf die Bevölkerung, die in den Quellen beschriebenen Ursachen des Klimawandels, den gesellschaftlichen Umgang mit den Folgen des Klimawandels, sowie einen Vergleich und die Interpretation der beiden Quellen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Subjektivität der quellenbasierten Darstellung.
Wie werden die Quellen analysiert?
Die Quellen werden mithilfe des „Ordered Impact Model“ analysiert. Es wird untersucht, wie die Klimafolgen in jeder Quelle dargestellt werden, welche Bevölkerungsgruppen betroffen sind und wie die gesellschaftlichen Reaktionen auf die Veränderungen aussehen. Die Analyse umfasst die Identifizierung von wirtschaftlichen Konsequenzen (z.B. Preissteigerungen, Ernteausfälle) und gesundheitlichen Auswirkungen.
Was ist das Ergebnis des Quellenvergleichs?
Das Kapitel zum Quellenvergleich hebt Ähnlichkeiten und Unterschiede in der Darstellung der Klimafolgen und gesellschaftlichen Reaktionen in „Die Teuerung zu Augsburg“ und „Wahrhafftige und glaubwirdige Zeyttung“ hervor. Der genaue Vergleich der Ergebnisse wird im Detail in der Arbeit dargestellt.
Welche Rolle spielt die Literatur in dieser Arbeit?
Die Forschungsliteratur spielt eine untergeordnete Rolle. Der Schwerpunkt liegt auf der direkten Analyse der beiden ausgewählten Quellen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kleine Eiszeit, Klimawandel, Quellenanalyse, „Die Teuerung zu Augsburg“, „Wahrhafftige und glaubwirdige Zeyttung“, gesellschaftliche Auswirkungen, Quellenvergleich, subjektive Darstellung, Frühneuzeit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in drei Kapitel gegliedert: 1. Einführung; 2. Quellenanalyse und -vergleich (inklusive Unterkapiteln zur Analyse jeder Quelle und zum Quellenvergleich); 3. Beantwortung der Ausgangsfragestellung und Ausblick.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2018, Schilderung klimatischer Veränderungen und ihre Folgen. Vergleich zweier Schriftquellen aus dem 16. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1321825