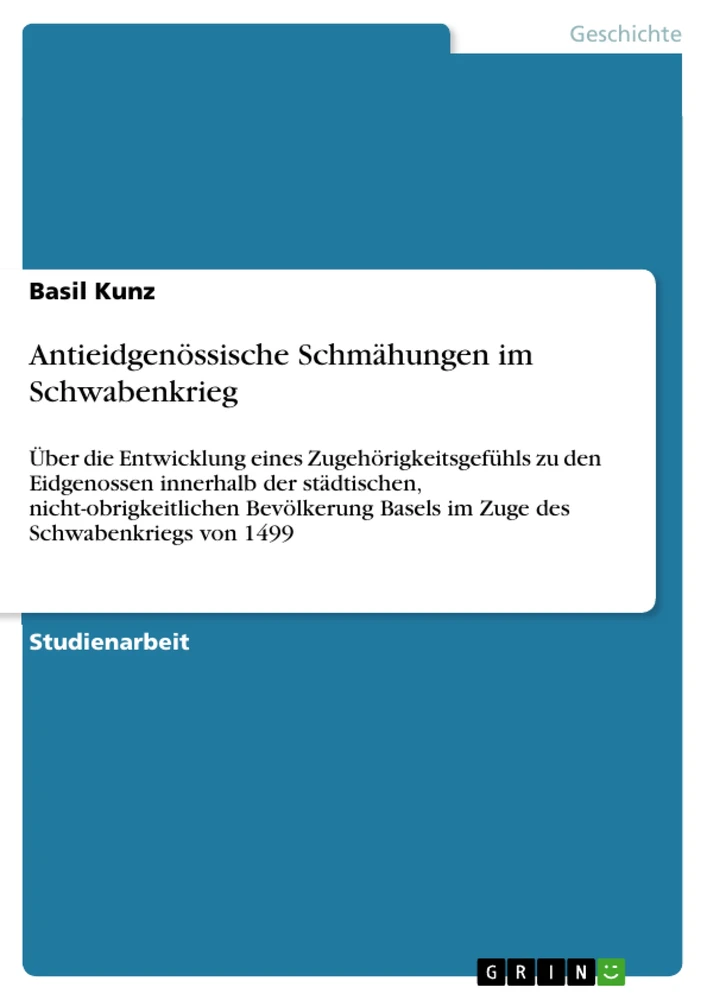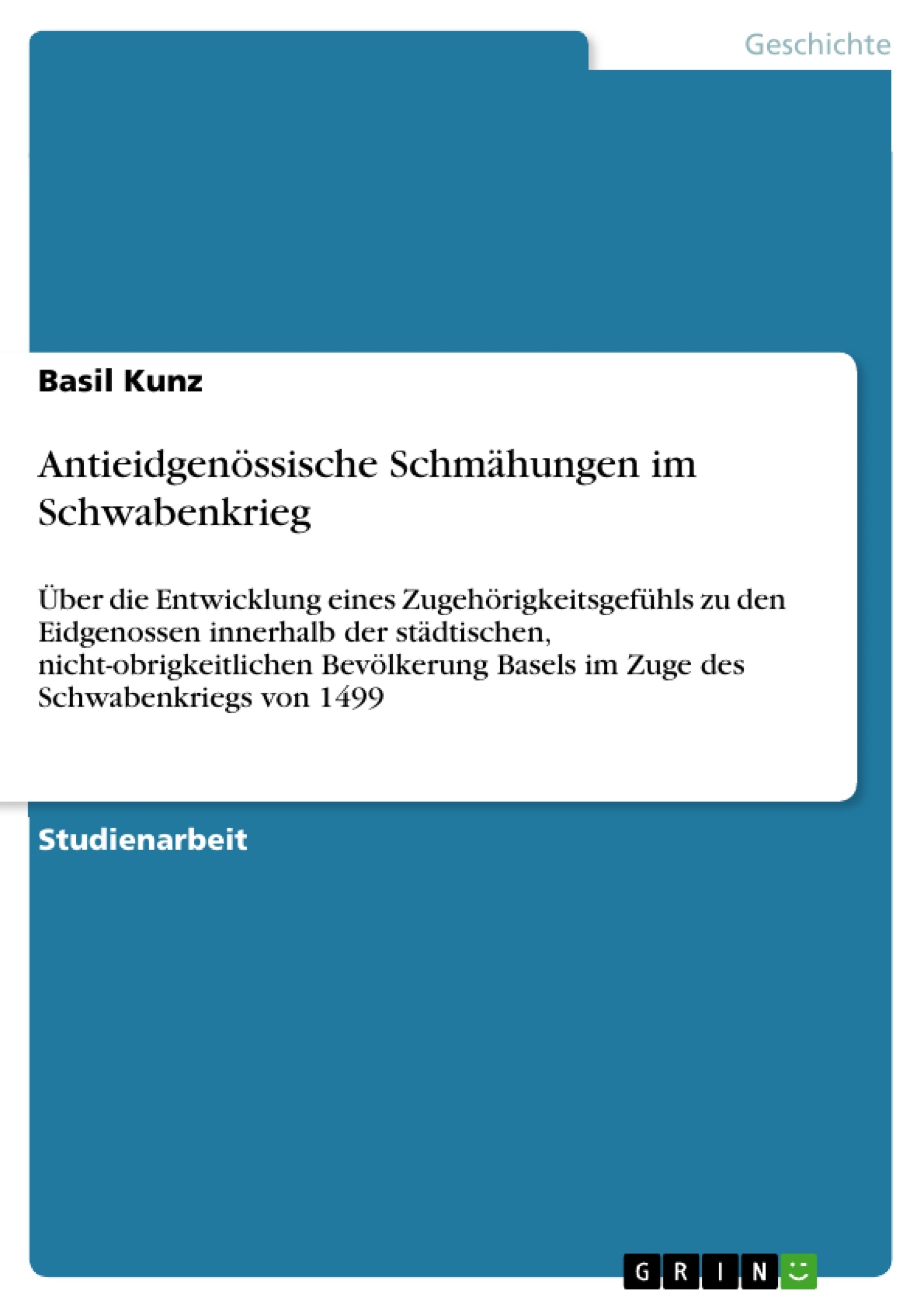Im Jahr 1499 stand die zehnörtige Eidgenossenschaft in einem kriegerischen Konflikt mit dem Hause Habsburg-Österreich – dem Schwabenkrieg –, bei dem es zu häufigen gegenseitigen Schmähungen kam. Diese hatten einen erheblichen Einfluss auf den Selbstvergewisserungs- und Abgrenzungsprozess der Eidgenossen im 15. Jahrhundert. Dabei beschränkte sich deren Einfluss nicht bloss auf die politische Obrigkeit, sondern wirkte sich auch auf private Streitigkeiten innerhalb der spätmittelalterlichen Bevölkerung aus. Die Breitenwirkung solcher Schmähungen ist Thema dieser Arbeit, wobei die städtische Bevölkerung Basels um 1500 im Fokus steht und der Frage nachgegangen wird, ob sich aus Kundschaften eines Nachbarschaftskonflikts, in welchem gegenseitige Schmähungen auf die Konfliktlinien des Schwabenkriegs bezugnehmen, Vorstellungen über ein Zugehörigkeitsgefühl und ein Abgrenzungsbedürfnis innerhalb jener eidgenössischen Gesellschaftsschicht erkennen lassen, die nicht zur politischen bzw. wirtschaftlichen Elite des spätmittelalterlichen Basels gehörten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Schmähungen zur Zeit des Schwabenkriegs und ihre Wirkung auf die Eidgenossen
- <
- Schlussbemerkung...
- Bibliografie
- Quelle..
- Sekundärliteratur.....
- Abstract
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Entwicklung eines Zugehörigkeitsgefühls zu den Eidgenossen innerhalb der städtischen, nicht-obrigkeitlichen Bevölkerung Basels während des Schwabenkriegs von 1499. Die Arbeit analysiert anhand von Quellenmaterial, wie Schmähungen und Beleidigungen, die im Zusammenhang mit dem Krieg ausgetauscht wurden, das Selbstverständnis und die Abgrenzungsprozesse der Basler Bürger beeinflussten.
- Die Rolle von Schmähungen und Beleidigungen im Schwabenkrieg und ihre Auswirkungen auf die soziale und politische Landschaft.
- Die Entstehung eines Zugehörigkeitsgefühls zu den Eidgenossen innerhalb der nicht-obrigkeitlichen Bevölkerungsschicht Basels.
- Die Analyse eines konkreten Falles von Nachbarschaftsstreit aus dem Jahr 1499, der Aufschluss über das Selbstverständnis und die Abgrenzungsprozesse der Basler Bürger bietet.
- Die Untersuchung der Frage, ob sich aus den Zeugenaussagen dieses Falles Schlussfolgerungen über die Identitätsfindung der Basler Bevölkerung im Kontext des Schwabenkriegs ziehen lassen.
- Die Bedeutung von Kundschaften (Zeugenaussagen) als Quelle zur Erforschung der gesellschaftlichen Breitenwirkung von Schmähungen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert den historischen Kontext des Schwabenkriegs von 1499 und beleuchtet die Ursachen und Voraussetzungen des Konflikts. Sie setzt den Fokus auf die soziale Dimension des Konflikts und die Rolle von Schmähungen und Beleidigungen. Die Einleitung führt zudem die Forschungsfrage ein, die sich mit der Entwicklung eines Zugehörigkeitsgefühls zu den Eidgenossen innerhalb der nicht-obrigkeitlichen Bevölkerung Basels beschäftigt.
Die Arbeit analysiert einen konkreten Fall von Nachbarschaftsstreit, der sich vermutlich am Ende des Jahres 1499 zugetragen hat. Die Analyse der Zeugenaussagen (Kundschaften) soll Aufschluss darüber geben, wie die politischen Verwerfungen des Schwabenkriegs in den privaten Diskurs der Basler Bürger eingebunden waren. Die Ergebnisse werden in Bezug auf die Forschungsfrage interpretiert und diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Schwabenkrieg, Zugehörigkeitsgefühl, Abgrenzungsprozesse, Schmähungen, Beleidigungen, Kundschaften, Nachbarschaftsstreit, Basler Gesellschaft, Identität, Selbstverständnis, Eidgenossenschaft und der Geschichte des Spätmittelalters.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielten Schmähungen im Schwabenkrieg von 1499?
Schmähungen dienten als Mittel der Abgrenzung und Identitätsfindung zwischen den Eidgenossen und dem Hause Habsburg-Österreich und beeinflussten sogar private Nachbarschaftskonflikte.
Wie wirkten sich diese Beleidigungen auf die Basler Bevölkerung aus?
Sie förderten ein Zugehörigkeitsgefühl zur eidgenössischen Gesellschaft, selbst bei Bürgern, die nicht zur politischen oder wirtschaftlichen Elite Basels gehörten.
Was sind „Kundschaften“ im historischen Kontext?
Kundschaften sind Zeugenaussagen, die in dieser Arbeit als Quelle dienen, um die Breitenwirkung politischer Konflikte im Alltag der spätmittelalterlichen Bevölkerung zu untersuchen.
Welcher konkrete Fall wird in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit analysiert einen Nachbarschaftskonflikt in Basel, bei dem sich die Kontrahenten gegenseitig mit Bezug auf die Ereignisse des Schwabenkriegs (z. B. die Schlacht bei Dornach) beleidigten.
Was war das Ziel des Abgrenzungsprozesses der Eidgenossen?
Der Prozess diente der Selbstvergewisserung der eidgenössischen Identität gegenüber äußeren Feinden und der Festigung des inneren Zusammenhalts während kriegerischer Auseinandersetzungen.
- Citation du texte
- Basil Kunz (Auteur), 2022, Antieidgenössische Schmähungen im Schwabenkrieg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1322471