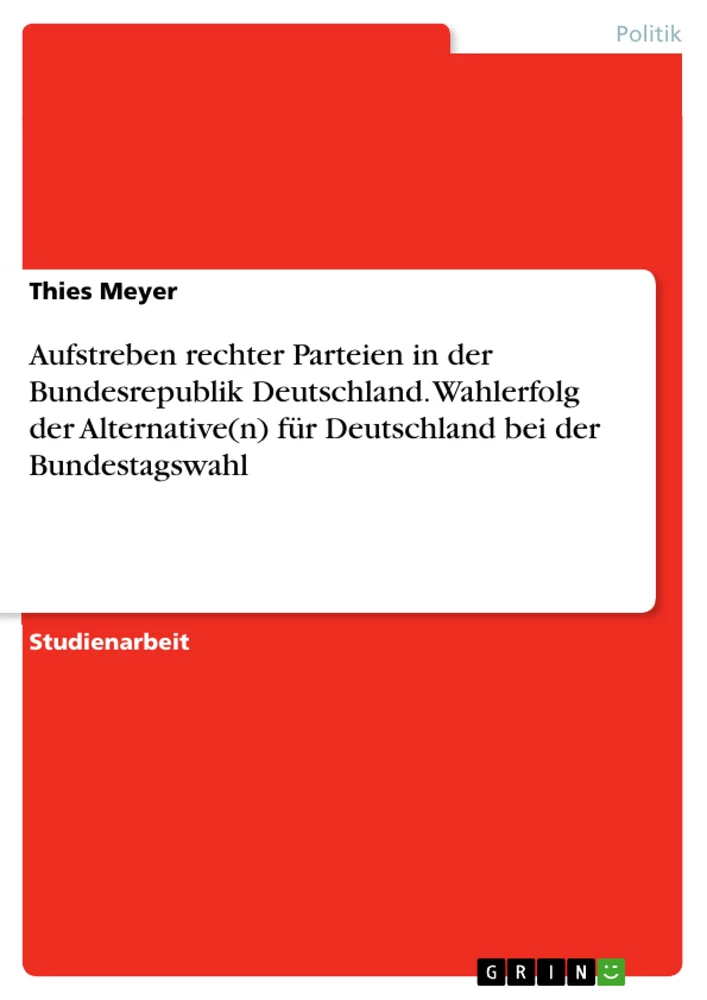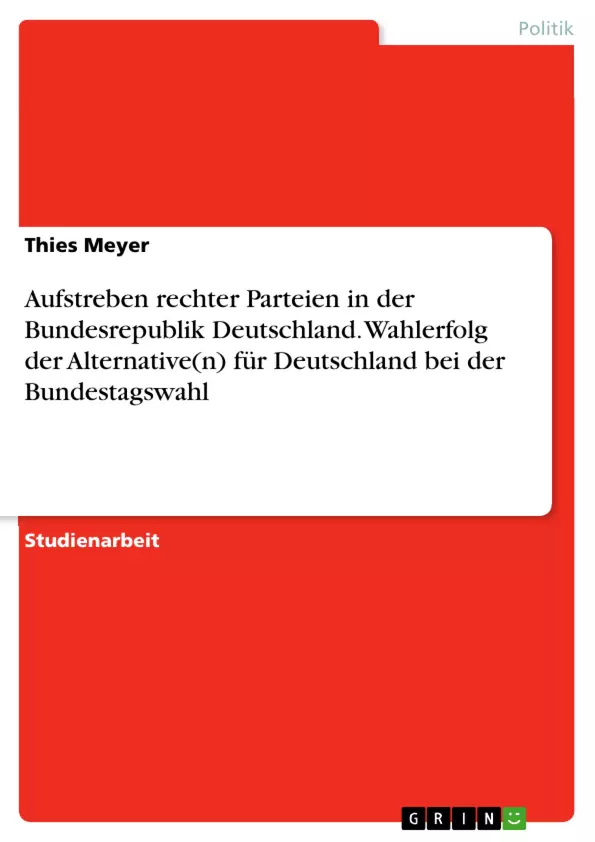Mit dem Titel „Das Aufstreben rechter Parteien in der Bundesrepublik Deutschland: Der Wahlerfolg der Alternative[n] für Deutschland bei der Bundestagswahl 2017“ soll in der Hausarbeit eine nach wie vor im Politikalltag aktuelle, präsente Thematik im Kontext von Parteienforschung beleuchtet werden.
Interessant ist eine Analyse dieser politischen Entwicklungen insofern, um die hinter dem gelungenen AfD-Bundestagseinzug versteckten Gründe zu erforschen. Im Fokus soll dabei der Aspekt populistischer, nationalistischer Gesinnung stehen und inwieweit diese eine Relevanz für Wähler hatte, der AfD bei den Bundestagswahlen 2017 mit ihrer Stimme zum Wahlerfolg zu verhelfen. Die vorläufige Fragestellung für meine Hausarbeit lautet daher: Inwiefern konnte die Alternative für Deutschland bei der Bundestagswahl 2017 den erstmaligen Einzug in den Deutschen Bundestag durch die Thematisierung von nationalistischen Einstellungen erreichen?
Der Reiz an dem Thema hat vielschichtige Gründe. Zum einen lassen sich nicht nur deutschland-, sondern auch europaweit allgemeine Tendenzen des zunehmenden Wahlerfolgs radikaler, populistischer Parteien vom rechten Wählerrand feststellen. Auch in der Bundesrepublik Deutschland zeichnen sich derartige Entwicklungen ab. Die Alternative für Deutschland (AfD) gehört in deren Parteienspektrum zwar zu den eher jüngeren Parteien, jedoch wurde sie durch regelmäßige Wahlerfolge in alle deutschen Landesparlamente gewählt und ist auch auf Bundesebene ein ernstzunehmender Gegenspieler für die “etablierten Parteien“ wie Union oder SPD.
In Bezug auf die Parteienforschung und Politikwissenschaft drehen sich die Diskussionen um eine zunehmend rechtslastige Verschiebung des Parteiensystems. Mit der national-konservativen AfD konnte sich in jüngster Vergangenheit eine Partei vom rechten Wählerrand bundesweit in der deutschen Parteienlandschaft ansiedeln und die national-konservative Lücke im System füllen. Die Forschung beschäftigt sich außerdem damit, inwiefern sich dies nachhaltig negativ auf das Wahlverhalten auswirken wird oder wie solche Parteien aus Unzufriedenheiten in der Gesellschaft Potenzial schöpfen und profitieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Rahmen und Literaturbericht
- 2.1 Methodisches Vorgehen
- 2.2 Issue-Voting
- 2.3 Rechtsextreme Einstellungen
- 2.4 Forschungsstand zur AfD
- 3. Analyse des Wahlverhaltens und der Einstellungen der AfD-Wähler bei der Bundestagswahl 2017
- 3.1 Issue-Voting bei AfD-Wählern
- 3.2 Migrationsfeindlichkeit als Dimension rechtsextremer Einstellungen
- 4. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht den Wahlerfolg der Alternative für Deutschland (AfD) bei der Bundestagswahl 2017 und analysiert die Rolle des Themas Migration bei der Wahlentscheidung der AfD-Wähler. Insbesondere wird die Frage beleuchtet, ob sich das Wahlverhalten der AfD-Wähler auf rechtsextreme Einstellungen zurückführen lässt.
- Der Einfluss des Themas Migration auf das Wahlverhalten der AfD-Wähler bei der Bundestagswahl 2017.
- Die Rolle von rechtsextremen Einstellungen im Wahlverhalten der AfD-Wähler.
- Die Bedeutung von Issue-Voting und die Analyse von emotional bedingten Einstellungsmerkmalen.
- Die Analyse von Wählermotiven und Ursachen für die Wahlentscheidung.
- Die Einordnung der AfD im deutschen Parteiensystem und die wissenschaftliche Diskussion ihrer Radikalität.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Hausarbeit beschäftigt sich mit der Einleitung und stellt die Fragestellung sowie die Forschungsmethodik vor. Das zweite Kapitel präsentiert den theoretischen Rahmen und den Literaturbericht. Hier werden wichtige Konzepte, wie Rechtsextremismus und Issue-Voting, definiert und der Forschungsstand zur AfD zusammengefasst. Das dritte Kapitel analysiert das Wahlverhalten der AfD-Wähler bei der Bundestagswahl 2017 und untersucht die Rolle von Issue-Voting und rechtsextremen Einstellungen. Das vierte und letzte Kapitel fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und zieht Schlussfolgerungen.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit befasst sich mit den Themen Rechtsextremismus, Issue-Voting, Migrationsfeindlichkeit, Wahlverhalten, AfD, Bundestagswahl 2017, Parteiensystem und Radikalität. Die Arbeit analysiert die Bedeutung von rechtsextremen Einstellungen im Wahlverhalten der AfD-Wähler und die Rolle des Themas Migration bei der Wahlentscheidung.
Häufig gestellte Fragen
Warum war die AfD bei der Bundestagswahl 2017 so erfolgreich?
Der Erfolg basierte maßgeblich auf der Thematisierung von Migration und nationaler Identität sowie der Nutzung von Unzufriedenheit mit den etablierten Parteien.
Was versteht man unter „Issue-Voting“ im Kontext der AfD?
Wähler entscheiden sich primär aufgrund eines spezifischen Themas (hier: Migrationspolitik) für eine Partei, statt aus einer langfristigen Parteibindung heraus.
Spielen rechtsextreme Einstellungen bei AfD-Wählern eine Rolle?
Die Arbeit analysiert, inwieweit Migrationsfeindlichkeit als Dimension rechtsextremer Einstellungen den Wahlerfolg begünstigt hat.
Wie wird die AfD im deutschen Parteiensystem eingeordnet?
Sie wird als national-konservative bis rechtspopulistische Partei gesehen, die eine Lücke am rechten Rand des Spektrums gefüllt hat.
Welchen Einfluss haben Emotionen auf die Wahlentscheidung?
Emotionale Einstellungsmerkmale wie Angst vor Identitätsverlust oder Wut auf das „Establishment“ waren zentrale Motive für viele AfD-Wähler.
- Quote paper
- Thies Meyer (Author), 2021, Aufstreben rechter Parteien in der Bundesrepublik Deutschland. Wahlerfolg der Alternative(n) für Deutschland bei der Bundestagswahl, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1326508