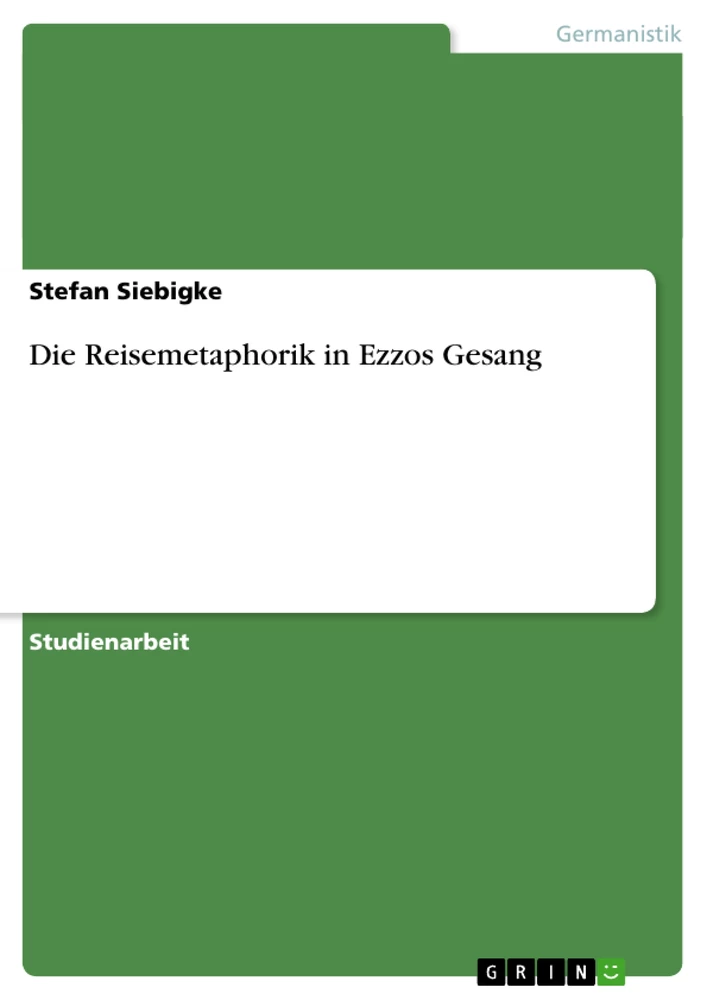Ezzos Lied von den Wundern Christi (auch bekannt als ‚Die vier Evangelien’, Von dem Anegenge’ oder ‚Lied von der Erlösung’) war und ist für die Medi-aevistik von herausragender Bedeutung. Als reine Auftragsarbeit des Bischofs Gunther von Bamberg um 1060 entstanden, entwickelte es sich schnell zum beliebten Kreuzfahrerlied – vielleicht der erste überlieferte frühmittelhochdeut-sche Gassenhauer.
Den Inhalt bildet das Erlösungswerk Christi, wie der katholische Gottesdienst es von Ostern bis Weihnachten liturgisch darstellt. Diese Tatsache hat auf die Architektur des Werkes Einfluss genommen. Ezzo hält sich an die Dramaturgie der Bibel, beginnt jedoch nach der Einleitung mit der Lobpreisung Christi als Licht der Welt, bevor er zurückgreift auf den Ungehorsam Adam und Evas.
Das Lied wirft noch heute viele Fragen auf. So erscheint es z.B. widrig, die ungleich langen Strophen als gesungene Darbietung zu präsentieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Metaphorik
- Definition und Funktion von Metaphern
- Gleichnis/Vergleich, Metapher, Allegorie und Symbol – eine Abgrenzung
- Metapher und Allegorie in frühmittelhochdeutschen Dichtungen
- Ursprung des Ezzoliedes
- Zur Entstehung des Ezzoliedes
- Die beiden Fassungen
- Die Metaphorik der Reise im Ezzolied
- Die zu behandelnden Strophen
- Weg, Land und rotes Taufmeer
- Die Schiffsallegorese
- Die Heimat
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Reisemetaphorik in Ezzos Gesang, einem frühmittelhochdeutschen Gedicht aus dem 11. Jahrhundert. Ziel ist es, die Bedeutung der Reisemetaphorik im Kontext des Werkes zu untersuchen und ihre Funktion für die Vermittlung der christlichen Botschaft zu beleuchten.
- Die Funktion von Metaphern in der frühmittelhochdeutschen Literatur
- Die Reisemetaphorik als Mittel der Veranschaulichung und Interpretation
- Die Bedeutung der Reisemotive im Ezzolied
- Die Rolle der Schiffsallegorese in der Darstellung der christlichen Botschaft
- Die Verbindung von Reise und Erlösung im Ezzolied
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und stellt das Ezzolied als ein wichtiges Zeugnis frühmittelhochdeutscher Literatur vor. Sie beleuchtet die Bedeutung des Werkes für die Mediaevistik und stellt die Forschungsfrage nach der Bedeutung der Reisemetaphorik im Ezzolied.
Das Kapitel "Metaphorik" definiert den Begriff der Metapher und erläutert ihre Funktion in der Literatur. Es werden verschiedene Definitionen und Ansätze zur Interpretation von Metaphern vorgestellt, wobei der Fokus auf der historischen Entwicklung des Metaphernbegriffs liegt. Zudem wird die Metapher von anderen sprachlichen Tropen wie Gleichnis, Allegorie und Symbol abgegrenzt.
Das Kapitel "Ursprung des Ezzoliedes" beleuchtet die Entstehung des Werkes und seine beiden Fassungen. Es werden die historischen und literarischen Hintergründe des Ezzoliedes erläutert, um den Kontext für die Analyse der Reisemetaphorik zu schaffen.
Das Kapitel "Die Metaphorik der Reise im Ezzolied" analysiert die Reisemetaphorik im Ezzolied. Es werden die relevanten Strophen des Werkes untersucht und die Bedeutung der Reisemotive wie Weg, Land, rotes Taufmeer und Schiff interpretiert. Der Fokus liegt auf der Schiffsallegorese und ihrer Funktion für die Darstellung der christlichen Botschaft.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Reisemetaphorik, das Ezzolied, frühmittelhochdeutsche Literatur, Schiffsallegorese, christliche Botschaft, Erlösung, Metapher, Allegorie, Symbol, Reisemotive, Weg, Land, rotes Taufmeer, Heimat.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ezzolied?
Das Ezzolied ist ein frühmittelhochdeutsches Gedicht aus dem 11. Jahrhundert, das das Erlösungswerk Christi beschreibt.
Welche Rolle spielt die Reisemetaphorik in diesem Werk?
Die Reise dient als Metapher für den Weg zur Erlösung, wobei Motive wie Weg, Land und Heimat zentral sind.
Was bedeutet "Schiffsallegorese"?
Es ist die bildhafte Darstellung der Kirche oder des menschlichen Lebens als Schiff, das durch die Gefahren der Welt zum sicheren Hafen Gottes steuert.
Warum wurde das Ezzolied als Kreuzfahrerlied beliebt?
Obwohl als Auftragsarbeit entstanden, bot es durch seine liturgische Dramaturgie und die Reisemotive eine starke Identifikationsfläche für Kreuzfahrer.
In welchen Fassungen ist das Ezzolied überliefert?
Es existieren zwei Hauptfassungen, die sich in Umfang und sprachlicher Ausformung unterscheiden.
- Arbeit zitieren
- Stefan Siebigke (Autor:in), 2003, Die Reisemetaphorik in Ezzos Gesang, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133173