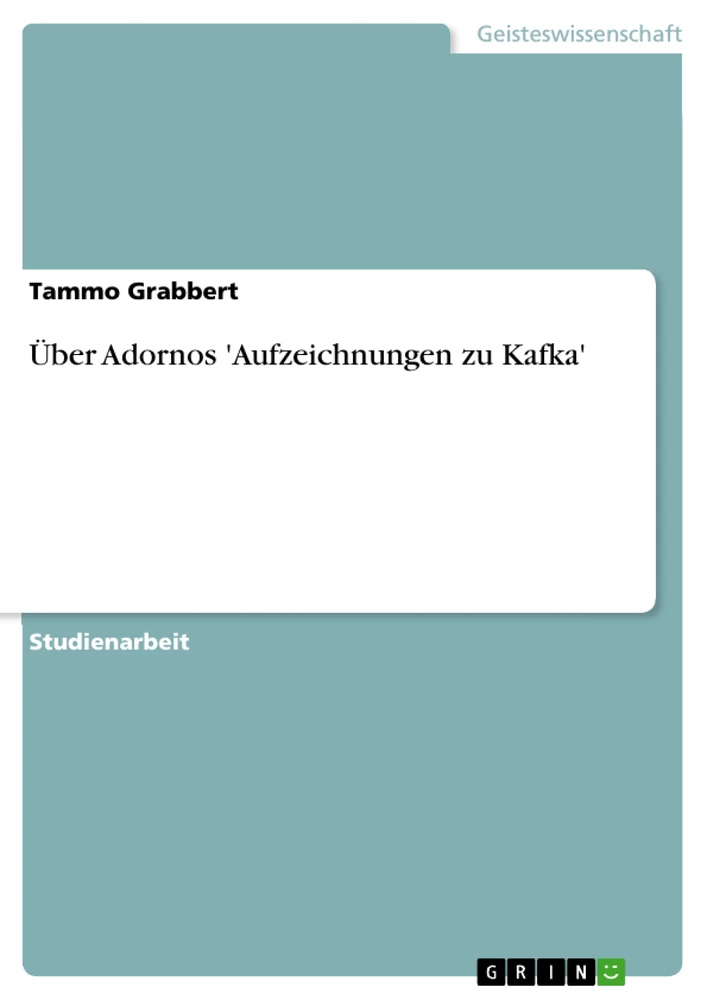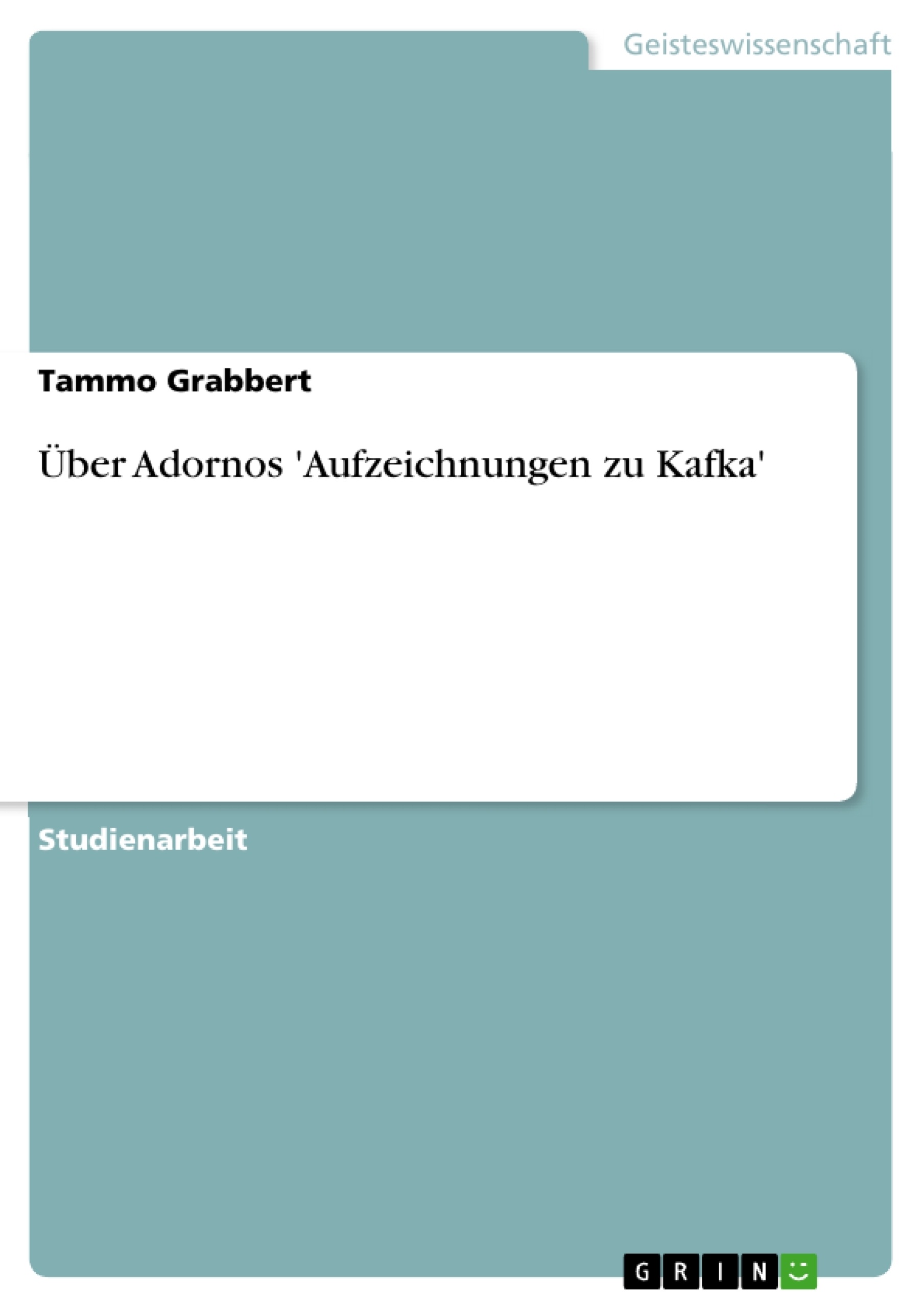Theodor W. Adorno schrieb in den Jahren 1942 bis 1953 ein Essay „Aufzeichnungen zu Kafka“, welches 1953 in „Die neue Rundschau“ publiziert wurde. Dieses Essay ist Gegenstand meiner vorliegenden Arbeit, in der ich den Fragestellungen nachgehen möchte, wie Adorno Kafka interpretiert hat, und was ihm an dessen Werk besonders wichtig war.
Ich werde mich hierbei vor allem um die inhaltlichen Aspekte kümmern und nur gelegentlich Anmerkungen und Erläuterungen aus anderen Quellen heranziehen.
Zur Gliederung ist zu sagen, daß ich nicht streng chronologisch den Inhalt der einzelnen (neun) Kapitel wiedergeben werde, sondern mich nach thematischen
Gesichtspunkten ausrichte. Dies ergibt sich aus der Tatsache, daß einige Themen in verschiedenen Kapiteln abgehandelt werden, die nicht in jedem Fall direkt aufeinander folgen, was wohl in dem Kontext gesehen werden muß, daß das verhältnismäßig kleine Werk (40 Seiten) über einen Zeitraum von elf Jahren hinweg entstanden ist.
Inhaltsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit Theodor W. Adornos Essay „Aufzeichnungen zu Kafka", der 1953 in „Die neue Rundschau" publiziert wurde. Ziel der Arbeit ist es, Adornos Interpretation von Kafkas Werk zu analysieren und die Aspekte hervorzuheben, die ihm besonders wichtig waren. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf die inhaltlichen Aspekte und bezieht nur gelegentlich Anmerkungen und Erläuterungen aus anderen Quellen ein.
- Adornos Interpretation von Kafkas Werk
- Die Bedeutung von Kafkas Prosa für Adorno
- Kafkas Kritik am Kapitalismus und an der bürgerlichen Gesellschaft
- Kafkas Verhältnis zur Psychoanalyse
- Kafkas stilistische Methoden und deren Ursprung
Zusammenfassung der Kapitel
-
Adorno kritisiert die gängigen Fehlinterpretationen von Kafkas Werk und betont die Komplexität und Schwierigkeit seiner Prosa. Er widerlegt die gängigen Einordnungen Kafkas in literarische Richtungen wie den Existentialismus und betont die Bedeutung von Kafkas „déjà vu"-Effekt, der den Leser zum Nachdenken und zu Deutungsversuchen zwingt.
-
Adorno fordert den Leser auf, Kafkas Texte wörtlich zu nehmen, um dem Vieldeutigen gerecht zu werden. Er bezieht sich dabei auf Cocteau, der die Gefahr der Traumdeutung für die Wirkung des Befremdlichen hervorhebt. Adorno zeigt, wie Kafkas „Prozeß" die eigentliche Handlung des Romans durch einen eingemengten Traum des Protagonisten als Realität definiert.
-
Adorno analysiert Kafkas Verhältnis zur Psychoanalyse und widerlegt die Behauptung, dass seine Geschichten lediglich psychologischen Charakter hätten. Er stellt Parallelen zwischen Freuds „Totem und Tabu" und Kafkas „Prozeß" her und weist auf die gemeinsame Kritik an der Illusion von individueller Selbstbestimmung hin. Adorno kritisiert jedoch auch Kafkas Tendenz, die Psychoanalyse allzu wörtlich zu nehmen, wodurch die Entstehung von Neuem verhindert wird.
-
Adorno untersucht Kafkas Motiv der „verewigten Gesten" und analysiert die Verschmelzung von Beständigem und Flüchtigem in seinen Werken. Er zeigt, wie Kafkas Motiv der Gleichheit oder Ähnlichkeit in der Paarung von Figuren die Last der Individuation verstärkt. Adorno bezieht sich dabei auf Marcel Proust, der das Unbehagen beschreibt, das entsteht, wenn man auf seine Ähnlichkeit mit einem fremden Verwandten aufmerksam gemacht wird.
-
Adorno analysiert Kafkas Motiv des entfremdeten Subjekts und zeigt, wie Kafka die Entfremdung in seiner Prosa thematisiert. Er kritisiert die Subjektivität als Dogma und bemängelt die Unfähigkeit des innerlich verschlossenen Subjekts, sich von Äußerlichkeiten beeinflussen zu lassen. Adorno betont, dass Kafkas Bilder oft trist und trostlos sind und als Reaktion auf die grenzenlose Macht der Herrschenden verstanden werden können.
-
Adorno analysiert Kafkas Prophezeiungen eines (nationalsozialistischen) Terrors und stellt Parallelen zwischen Kafkas Welt und der des Dritten Reichs her. Er zeigt, wie Kafkas Werke Elemente des Terrors, der Folter und der willkürlichen Verhaftung aufgreifen und die Ideologie des Nationalsozialismus kritisieren. Adorno sieht in Kafkas Figuren eine Kritik am deutschen Bürgertum, das die Errichtung von Konzentrationslagern zugelassen hat.
-
Adorno untersucht Kafkas „Ich"-Skepsis und zeigt, wie seine Werke die Illusion von individueller Selbstbestimmung auflösen. Er analysiert Kafkas Motiv der „Ichfremdheit" und stellt es in Beziehung zum Konflikt zwischen individuellem Charakter und Sozialcharakter. Adorno betont, dass Kafkas Werke die negativen Aspekte der Realität offenlegen und die gesellschaftlichen Illusionen aufdecken.
-
Adorno analysiert Kafkas Affinität zu Abenteuergeschichten und zeigt, wie er die Technik der Aneinanderreihung einzelner Episoden in seinen Werken verwendet. Er stellt Parallelen zu Kriminalromanen her und zeigt, wie Kafkas Werk die Grenze zwischen dem Außergewöhnlichen und dem Gewöhnlichen verwischt.
-
Adorno beschreibt Kafka als Aufklärer, der sich von der Illusion des Subjekts distanzierte und Mythen zu überprüfen versuchte. Er analysiert Kafkas „Prozeß" als Beispiel für die Entlarvung des mythischen Charakters des Gesetzes. Adorno kritisiert jedoch auch die Monotonie in Kafkas Werk, die auf Kosten der Anschaulichkeit geht.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Franz Kafka, Theodor W. Adorno, Kritische Theorie, Literaturinterpretation, „Aufzeichnungen zu Kafka", „déjà vu", Entfremdung, Kapitalismuskritik, bürgerliche Gesellschaft, Psychoanalyse, Stilistik, Mythenkritik, „Prozeß", „Schloß", „Amerika".
- Arbeit zitieren
- Diplom Sozialwissenschaftler Tammo Grabbert (Autor:in), 2000, Über Adornos 'Aufzeichnungen zu Kafka', München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133826