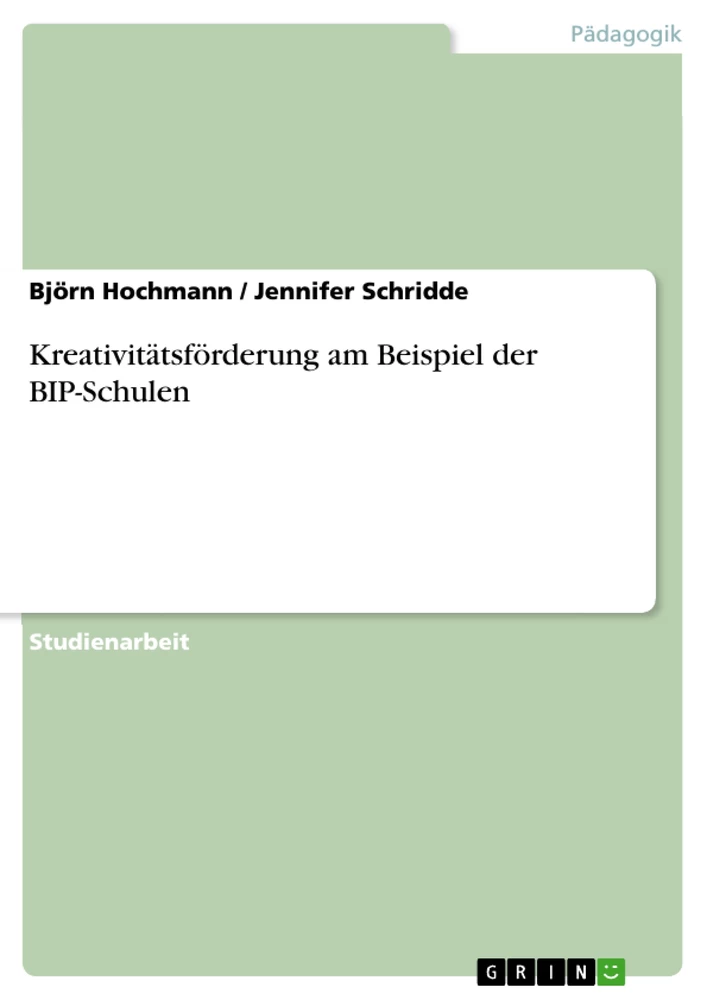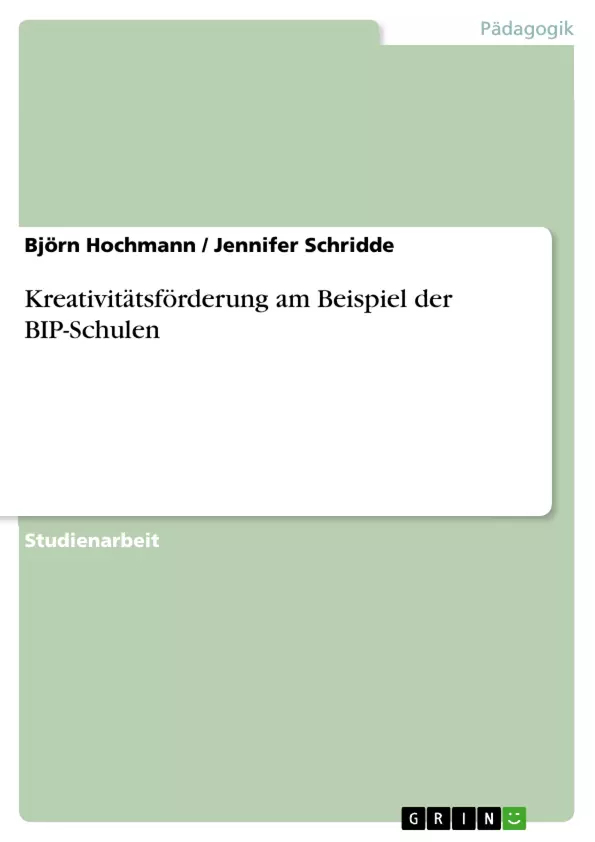Es gibt Modewörter, die verschwinden genauso schnell, wie sie gekommen sind. So dachte man vielleicht auch schon vor Jahrzehnten über den Begriff „Kreativität“. Nur hält sich dieses Modewort seit Jahrzehnten in unserem Sprachgebrauch, sodass man kaum noch von einem Modewort sprechen kann und es scheint, als ob die Hochkonjunktur noch gar nicht erreicht sei. Es vergeht kaum ein Monat, ohne dass ein Politiker in den Nachrichten mit Nachdruck mehr "Kreativität" in deutschen Schulen fordert. Ja, es wird sogar in unserem doch so arg gebeutelten Schulsystem nach PISA und anderen "Tests" von „Kreativitätsförderung“ gesprochen.
Die "Kreativitätswelle" bringt einige Probleme mit sich. Wer oder Was ist denn eigentlich kreativ? Was steckt hinter "Kreativität"? Zwei Pädagogen aus den neuen Ländern, Gerlinde und Hans-Georg Mehlhorn, beschäftigen sich schon seit geraumer Zeit mit dem Begriff der "Kreativität". Sie gründeten 1997 in Leipzig ihre erste „Kreativitätsschule“ für Schüler, wo Fächer wie „Entedecken, Erfinden, Erforschen“ oder „Schach“ auf dem Stundenplan stehen. Ziel sei es, die Kreativität von Kindern zu fördern.
In dieser Arbeit wird der Begriff "Kreativität" näher untersucht: Nach einer kurzen wissenschaftlichen Diskussion und Definition von "Kreativität" werden die Kreativitätsschulen der Mehlhorns (s. o.) kritisch beäugt: Wie und Was wird unterrichtet? Welches sind die Leitfäden der Kreativitätsschulen? Wie sieht die Infrastruktur einer solchen Schule aus? Diese Reflexion nimmt die Kreativitätsschulen sowohl aus subjektiver als auch aus wissenschaftlicher Sicht unter die Lupe und geht so der Frage nach, ob Kreativität lern- bzw. lehrbar ist.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Kreativität – ein schillernder Begriff
2.1 Versuch einer Definition
3. Kreativitätsschule: Die BIP-Schule
3.1 Was wäre wenn
Eine Idee nimmt ihren Lauf: Das Leipziger Projekt
3.2 Die BIP-Schulen heute – Vorstellung eines Schulkonzeptes
3.3 Erfolge und Ergebnisse der BIP-Schule
3.4 Standorte BIP-Einrichtungen sowie Lehrerausbildung
4. Kritik
4.1 Kritik der Autoren an den BIP-Schulen
4.2 Ist Kreativität le(h)r (n)bar?
5. Fazit
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Es gibt Modewörter, die verschwinden genauso schnell, wie sie kamen. So dachten vielleicht auch schon vor Jahrzehnten einige Menschen über den Begriff „Kreativität“. Nur hält sich dieses „Modewort“ seit Jahrzehnten in unserem Sprachgebrauch und es scheint so, als ob die Hochkonjunktur noch nicht erreicht ist. Es vergeht kaum ein Monat, ohne dass ein Politiker in den Nachrichten mit Nachdruck mehr Kreativität in deutschen Schulen fordert. Ja, es wird sogar in unserem doch so arg gebeutelten Schulsystem nach PISA von „Kreativitätsförderung“ gesprochen. Es kommt auch immer gut, wenn ich in meiner Bewerbung vollmündig verkünde wie kreativ ich doch bin und auflisten kann, in wie vielen „Kreativitätskursen“ ich mich weitergebildet habe. Oder sollte man besser sagen mich kreativer gemacht habe?
Die Kreativitätswelle bringt einige Probleme mit sich. Wer oder Was ist denn eigentlich kreativ? Was steckt hinter Kreativität? Zwei Pädagogen aus den neuen Ländern, Gerlinde und Hans-Georg Mehlhorn, beschäftigen sich schon seit geraumer Zeit mit dem Begriff der Kreativität. Sie gründeten 1997 in Leipzig ihre erste „Kreativitätsschule“ für Schüler, wo Fächer wie „Entedecken, Erfinden, Erforschen“ oder „Schach“ auf dem Stundenplan stehen. Ziel ist es, die Kreativität von Kindern zu fördern. Im Mittelteil dieser Arbeit (3.) sollen die Kreativitätsschulen der Mehlhorns vorgestellt werden. Wie und Was wird unterrichtet? Welches sind die Leitfäden der Kreativitätsschulen? Wie sieht die Infrastruktur einer solchen Schule aus? Zuvor beschäftigt sich Punkt 2 aber damit, was eigentlich der Begriff Kreativität umreißt, welche Ränder er berührt und wie Kreativität konnotiert wird. Nach dem schon angesprochen Hauptteil (Mehlhornschulen) erfolgt unter Punkt 4 die Beurteilung der Mehlhornschulen. Der erste Teil der Kritik (4.1) ist aus Sicht der Autoren dieser Arbeit geschrieben und er beurteilt viele kleine Details an den Schulen sowohl positiv als auch negativ. Diese Kritik ist eine rein subjektive. Der zweite Teil (4.2) der Kritik nimmt die Kreativitätsschulen aus wissenschaftlicher Sicht unter die Lupe und geht auch der Frage nach, ob Kreativität lern- und lehrbar ist. Die Arbeit schließt mit einem Fazit unter Punkt 5.
2. Kreativität – ein schillernder Begriff
Wir haben dich weder als einen Himmlischen noch als einen Irdischen, weder als einen Sterblichen, noch als einen Unsterblichen geschaffen, damit du als dein eigener, vollkommen frei und ehrenhalber schaltender Bildhauer und Dichter dir selbst die Form bestimmst, in der du zu leben wünscht. Es steht dir frei, in die Unterwelt des Viehs zu entarten. Es steht dir ebenso frei, in die höhere Welt des Göttlichen dich durch den Entschluß [sic!] deines eigenen Geistes zu erheben.[1]
Diese Worte legt Pico della Mirandola im Jahre 1486 zur Glanzeit der italienischen Renaissance in seiner berühmten Schrift „De dignitate hominis“ seinem Gott in dem Mund, als er zu „Adam“ spricht. Heute würde man sagen, Adam soll „kreativ“ sein, seinen eigenen Weg, seinen eigenen Lebensstil finden. Was steckt eigentlich hinter diesem, in unserer Zeit so inflationär gebrauchten, Terminus „Kreativität“?
Wer oder Was ist heute nicht alles kreativ! Längst hat die Werbung diesen leuchtenden und doch so tautologischen Begriff für sich entdeckt, längst hat er Einzug in alle Wissenschaften erhalten. Kreativität ist geradezu zu einem Zauber- und Modewort geworden. Woran liegt das? Mit Kreativität assoziiert jedes Individuum etwas anderes. Für den einen ist Kreativität Hoffnung, die Erfüllung der Sehnsüchte, ein anderer verbindet mit Kreativität einen neuen Weg, vielleicht einen verheißungsvollen, aber ungewissen Weg zu gehen. Für viele Menschen bedeutet Kreativität auch immer ein Schaffensprozess, aber darauf wird noch einzugehen sein. Kreativität heißt aber auch, betreten einer terra incognita. Das „Neue“ ist nach Adorno mit „dem Tod verschwistert“, es ist als Kryptogramm ein Bild des Untergangs.[2] Es ist bekannt, dass sich viele gesellschaftliche Gruppen mit Neuerungen nicht immer leicht tun. Kreativität hat demnach immer eine positive, für manche aber auch eine negative Konnotation. Aber überall dort, wo heute Kreativität als Schlagwort genutzt wird, sollen bestimmte Impulse freigesetzt werden. Notorische Nutzer des Begriffs wollen mit damit etwas Bestimmtes erreichen – in diesem Feld wird der Ausruf Kreativität stets positiv konnotiert. Gerhard Plumpe führt dieses Phänomen auf die „semantische Beliebigkeit“[3] des Wortes zurück. „ ‚Kreativität’ – das ist die Richtung für das Positive in der demokratischen Industriegesellschaft.“[4]
Wenn man sich etymologisch versucht, dem Begriff Kreativität zu nähern, wird man auf das lateinische creare, creator stoßen. Das Verb creare bedeutet schöpfen, neu schaffen, creator (= Schöpfer) ist das dazugehörige Substantiv.[5] Das Wort Kreativität wird seit dem 19. Jahrhundert in der Alltagssprache genutzt. Zum ersten Mal taucht der Begriff „creativity“ in der Wissenschaft in einer schriftlichen Arbeit 1950 bei Joy Paul Guilford auf (publiziert in: American Psychologist 5 1950. S. 444-454) Von diesem Zeitpunkt ausgehend verbreitete sich der Begriff über die Psychologie interdisziplinär und unaufhaltsam.[6] Jede Wissenschaft proklamiert nun die Nutzung des Begriffs als ihr Eigen. Alle sprechen über Kreativität; nur in jedem Wissenschaftszweig schwingt etwas anderes in diesem Wort mit.
Ohne, dass bisher genau geklärt wurde, was Kreativität eigentlich ist, ist klar, dass es einen Prozess gibt, wie immer man ihn auch bezeichnen will, der Neues schafft. Woher kommen die Innovationen in Wissenschaft und Technik? Warum entstehen neuen Künste? Woher kommen neue Ideologien in Politik, Philosophie und Soziologie? Wie entstehen neue Kulturphänomene? Woher kommt Epochen machendes? Dies alles hat irgendwie mit Kreativität zu tun. Will man eine Definition von Kreativität geben, so muss nach der Quelle und Motivation, nach der innovativen Kraft im Menschen suchen. Zu dieser gehören nach philosophisch-traditioneller Einsicht Verstand, Phantasie und Vernunft:
Phantasie ist das ingeniöse, dynamische, entgrenzende Vermögen, Verstand das ordnende und Vernunft das eingrenzende, Phantasie und Verstand gleichermaßen kontrollierende Vermögen. Alle zusammen kann man sehen als die kreative In- stanz im Bewußtsein [sic!] des Menschen.[7]
Vernunft ist an dieser Stelle besonders hervorzuheben, weil ohne Vernunft, Kreativität in Spinnerei und Verrücktheit übergeht.
Anthropologisch betrachtet, ist Kreativität nichts anderes als die Reaktion des Homo Sapiens auf Herausforderungen von innen und außen und sich verändernden Umweltbedingungen. Es geht um Adaption bzw. darum, dort wo sich der Mensch nicht anpassen kann, sich die Konditionen selbst zu verändern.[8] Es steht die akademische Frage im Raum, ob der Mensch die Verhältnisse macht oder die Verhältnisse den Menschen.[9] Riedl geht so weit, dass er in diesem Zusammenhang vom „Sein oder Nichtsein“[10] spricht.
2.1 Versuche einer Definition
Definitionen haben immer das Problem, dass sie entweder zu eng gefasst sind, so dass wichtige Aspekte fehlen, dafür aber verständlich und übersichtlich sind. Oder eine Definition ist so umfassend, dass sie verbal nur äußerst komplex geäußert werden kann und ohne ein Fremdwörterlexikon für den gemeinen Leser nicht zu verstehen ist. Man könnte sich jetzt leicht aus der Affäre ziehen, indem man sagt, dass es der Wissenschaft bis heute nicht gelungen ist, eine schlüssige und allgemein verständliche Definition von Kreativität zu geben. Aber das ist nicht unser Anspruch! Ziel dieses Abschnittes ist es also, eine Definition zu finden, die erstens ohne Fremdwörter auskommt und zweitens über wenige Zeilen geht, so dass sie ohne weiteres nachzuvollziehen ist.
Es mag jetzt paradox klingen, wenn wir an dieser Stelle proklamieren, dass eine genaue Definition von Kreativität nicht möglich ist, weil Kreativität für jeden etwas anderes bedeutet (siehe 2.) bzw. weil Kreativität eine der komplexesten menschlichen Eigenschaften ist.[11] Für das Anliegen dieser Arbeit ist eine genaue Definition auch unwichtig. Deswegen behelfen wir uns eines kleinen Tricks. Die Definition, die wir geben werden, bezieht sich auf den kreativen Menschen, denn nur um den geht es.
Zuvor müssen allerdings noch einige Überlegungen extrahiert werden: Aus den verschiedenen Definitionsversuchen lassen sich in der Literatur drei Ebenen erkennen: Die kreative Persönlichkeit, der kreative Prozess und das kreative Produkt.[12]
Ein Geistesblitz muss allerdings nicht auf wenige kreative, geniale Persönlichkeiten beschränkt sein. Gewiss gibt es die hoch begabten Menschen, Experten mit starkem Willen, die außergewöhnliche Leistungen erzielen. Auf solche Personen legt die angestrebte Definition ihren Fokus. Nur besitzen kreative Menschen spezielle Merkmale: Sie verfügen über angeborene Begabungen und Talente (vgl. 4.2), sie weisen eine starke Entwicklungsdynamik auf, deren Fehlen auch durch noch so intensive Lernanstrengungen von durchschnittlich begabten Menschen nicht kompensiert werden kann. Diese geistigen Potentiale bringen völlig neue Ideen und Werke hervor, die von der Nachwelt als besonders wertvoll und bedeutsam deklariert werden. Diese genialen neuen Erkenntnisse und Zeugnisse sind in der Regel nicht das Ergebnis kleinschrittiger, systematischer und fleißiger Detailarbeit, sondern das Resultat von Stadien des schöpferischen Aktes:
Zum diesem kreativen Prozess (der das Produkt hervorbringt) ist zu sagen, dass er in mehrere Phasen eingeteilt werden kann: Das erste Stadium ist oftmals eine lange erfolglose Suche nach der Lösung der gestellten Aufgabe. Diese Phase bezeichnet man als Präparation. Auf die Präparation erfolgt die Inkubation: Diese Phase ist dadurch gekennzeichnet, dass ein unbewusstes Fortwirken des Problems von statten geht. Darauf folgt der plötzliche Einfall, verbunden mit dem Gefühl der Selbstgewissheit (Illumination). Das letzte Stadium ist die Beweisführung oder Ausführung dessen, was man als richtige Lösung des Problems zu kennen glaubt (Verifikation).
Ein Produkt (Gestaltung, Idee etc.) wird dann als kreativ angesehen, wenn es über das Bekannte weit hinausgeht, wenn es überraschend ist. Wenn dann noch ein Experte diesem Produkt einen außerordentlichen Wert zuschreibt, ist es allgemein als kreativ anzusehen.[13]
In der Regel führt konvergentes (übereinstimmendes) Denken zum Erfolg. In Bezug auf Kreativität ist aber divergentes (unterschiedliches) Denken von besonderem Interesse. Folgende Indikatoren werden dem wichtigen divergenten Denken zugeordnet:[14]
- Sensibilität gegenüber Problemen: Damit ist die Fähigkeit gemeint, Probleme überhaupt zu erkennen oder Bestehendes zu verbessern.
- Flüssigkeit des Denkens: Dies ist die Menge der Ideen, die in Summa in Korrelation mit der Zeit produziert werden können.
- Flexibilität des Denkens: Hiermit ist die Leichtigkeit gemeint, mit der divergentes Denken Verbindungen zu anderen Ordnungen, Systemen herstellt. Es werden Informationen aufgenommen und modifiziert.
- Originalität des Denkens: Dies stellt das eigentlich Neue da, das noch nie in dieser Form da gewesene.
All diese begrifflichen Bestimmungen dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass auf wissenschaftlichen Wege nicht eindeutig zu klären ist, wie man zu dem wird, was man kreativ nennt (vgl. 4.2). Klar ist aber, dass Kreativitätsförderung in der Schule deklaratives Wissen (gewusst was) mit prozeduralem Wissen (gewusst wie) verknüpfen muss, damit kreative Persönlichkeiten entstehen bzw. sich entwickeln können[15]. Das heißt, dass die Kluft zwischen Theorie und Praxis überwunden werden muss. Es muss eine Vernetzung der einzelnen Komponenten des Wissens sowohl intra- als auch transdisziplinär erfolgen: Das erworbene Wissen muss an lebensnahe und soziale Situationen angepasst und genutzt werden.[16] Wer oder was ist also nun kreativ, was versteckt sich hinter Kreativität: Der kreative Mensch
ist dadurch kreativ, daß [sic!] er dieses Wissen in neuartiger Weise zusammen- setzt bzw. verfügbar macht, so daß [sic!] zumindest Teilerfolge sichtbar werden. Kreative sind die Leute, denen noch etwas Brauchbares einfällt, wenn anderen die Ideen ausgegangen sind.[17]
Mit dieser Definition von Kreativität wird der weitere Verlauf dieser Arbeit operieren. Zum Abschluss und zum besseren Verständnis zeigt die folgende Skala, wie Kreativität einzuschätzen ist[18]:
[...]
[1] Pico della Mirondola, Giovanni (1486): Über die Würde des Menschen. Übersetzt und herausge-
geben von Herbert Werner Rüssel. Zürich: Manesse 1988. S. 10f.
[2] vgl.: Adorno, Theodor W.: Ästhetische Theorie. 10. Auflage. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1990. S.
38.
[3] Plumpe, Gerhard: Das Interesse am Mythos. In: Zeitschrift für wissenschaftliche Pädagogik 65
(1989). S. 157.
[4] Ränsch-Trill, Barbara: Kreativität – Über Möglichkeiten und Grenzen eines attraktiven Begriffs.
In: >>Kreativität<<. Phänomen-Begriff-sportwissenschaftliche Aktualität. Hrsg. von Barbara
Ränsch-Trill. Sankt Augustin: Academia Verlag 1999. S. 1-16. S. 3.
[5] vgl.: http://de.wikipedia.org/wiki/Kreativit%C3%A4t ( vom 16.01.2007) Vielleicht ist das
Modewort Kreativität doch nicht so wissenschaftlich etabliert, wie oben angedeutet? Die neueste
Ausgabe des Dudens Herkunftswörterbuch (4. Auflage 2006!) hält es jedenfalls nicht für nötig
„Kreativität“ aufzunehmen. vgl.: Duden: Das Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen
Sprache. 4.Auflage. Dudenverlag: Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich 2006.
[6] vgl.: Ränsch-Trill: Kreativität. 1999. S. 3
[7] ebd. S. 5
[8] vgl.: ebd. S. 4f.
[9] Weinert, Franz Emanuel: Das Individuum. In: Wie kommt das Neue in die Welt. Hrsg. von Hein-
rich von Pierer und Bolko Oetinger. München u. Wien: Carl Hanser Verlag 1997. S. 201-208. S.
201.
[10] Riedl, Rupert: Die Ordnung des Lebendigen – Systembedingungen der Evolution. Hamburg u.
Berlin: Parey Buchverlag 1975.
[11] vgl.: Roth Gerhard: Über mögliche neurobiologische Grundlagen von Kreativität. In: >>Kreati-
vität<<. Phänomen-Begriff-sportwissenschaftliche Aktualität. Hrsg. von Barbara
Ränsch-Trill. Sankt Augustin: Academia Verlag 1999. S. 37-44. S. 38.
[12] vgl.: Weinert: Das Individuum. 1997. S. 202ff. Sowie vgl. Kaulfuß, Ralf u.a.: Kreativität im
Unterricht. Hrsg. Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung München. Mün-
chen: Copyprint GmbH 2001 (=Arbeitskreis Gymnasium und Wirtschaft e. V.). S. 10.
[13] vgl.: ebd.
[14] vgl. ebd. S. 204 (Weinert nach Guilford).
[15] Ob kreative Personen „entstehen können“, wird noch zu klären sein.
[16] vgl.: ebd. S. 10f.
[17] Roth: Über mögliche neurobiologische Grundlagen von Kreativität. S. 38.
[18] eine genaue Definition von „dumm“, „normal“ etc. wird absichtlich ausgespart, um nicht ins
Unendliche zu gelangen. Ebenso ist der „Geniale“ ausgeklammert.
- Arbeit zitieren
- Björn Hochmann (Autor:in), Jennifer Schridde (Autor:in), 2007, Kreativitätsförderung am Beispiel der BIP-Schulen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/134280