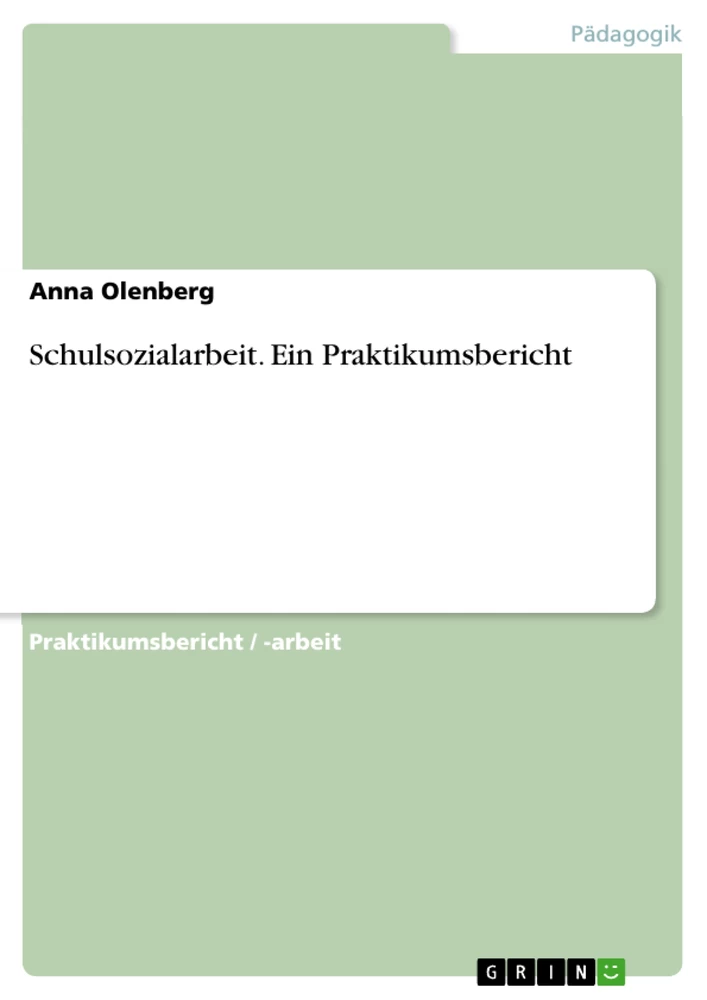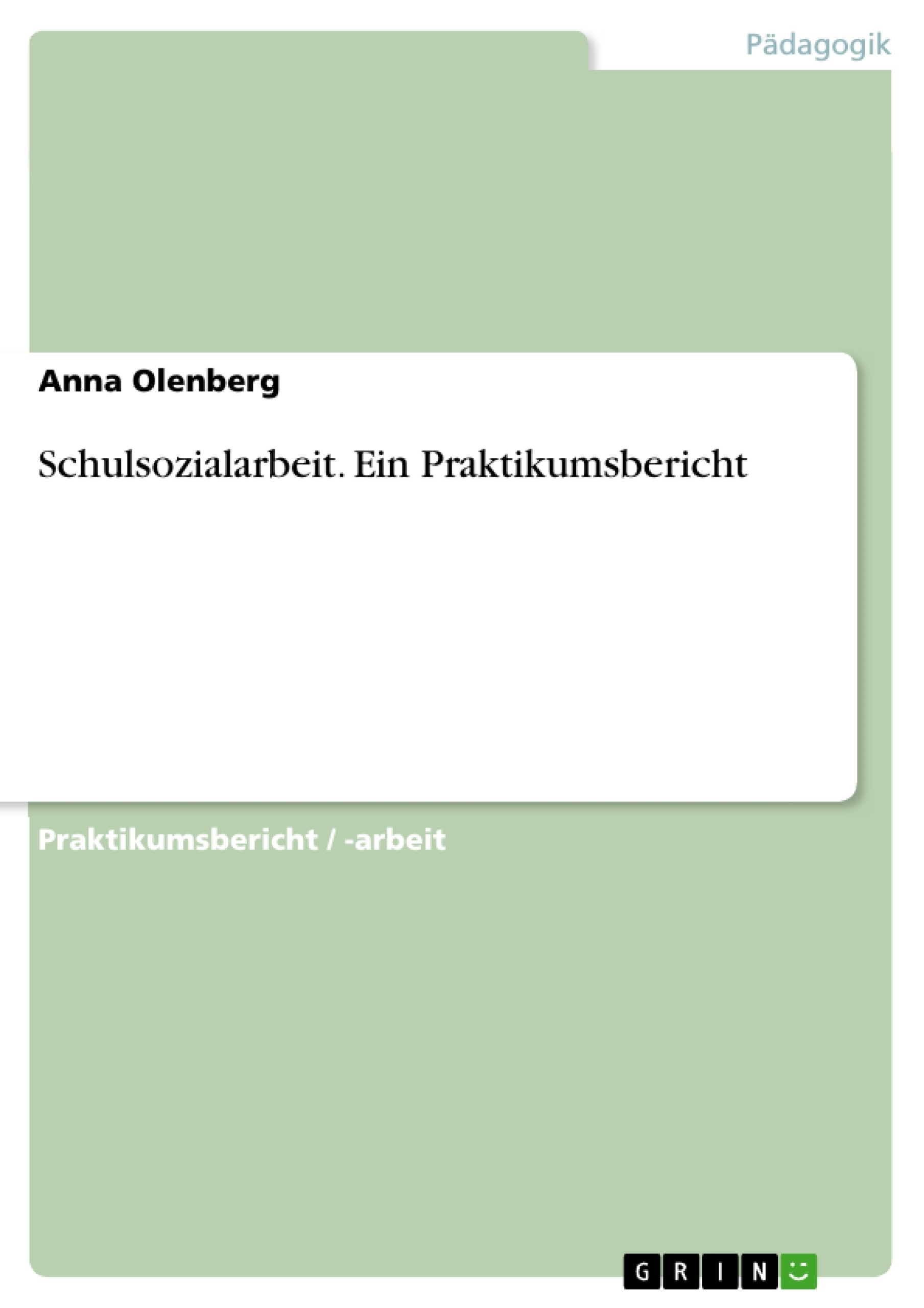Bei einem Blick in die Schulchronik erkennt man die bewegte Vergangenheit dieser Schule. 1950 entsteht die Bürgerschule (Volksschule) in der Lüttich-Kaserne. Im Jahre 1952 führt die Raumnutzung durch belgische Truppen zu einem Umzug. Ein weiterer Umzug in Pavillons der Hupfeldschule 1953 hält die Schulentwicklung in Unruhe. Ein dritter Umzug 1956 ist aus heutiger Sicht ein wichtiger Schritt nach vorne gewesen. Die Bürgerschule Eugen-Richter-Straße zieht in ein eigenes Gebäude. Sie trägt seitdem den Namen „Schule Am Heideweg“. Seitdem gib es viele Veränderungen. Durch den neu entstandenen Stadtteil Marbachshöhe, der zu Hälfte dem Schulbezirk der Grundschule Am Heideweg zugeordnet wird, gehen die Schülerzahlen weiter in die Höhe. Im Jahr 2003 entsteht ein weiterer Anbau.
Im Obergeschoss der Schule entsteht ein großzügiger Mehrzweckraum, im ersten Stockwerk kommen zwei neue Klassenräume hinzu und im Erdgeschoss zieht die GfK (Gesellschaft zur Förderung von Kinderbetreuung e.V.) mit ihren Angeboten für die „Betreute Grundschule“ und den Hort ein. In Zusammenarbeit von Lehrern, Kinder, der UNI-GHK, dem Kinderbüro der Stadt und dem Spielmobil Rote Rübe sowie Eltern und Förderverein wird das Schulgebäude überwiegend nach den Wünschen der Kinder umgestaltet. [...]
Inhaltsverzeichnis
1 Geschichte
2 Rechtsform
3 Die Grundschule Am Heideweg
4 Ziele der Grundschule
5 Förderverein
6 Schulhof
7 Schülerbibliothek
8 Hort „Calluna“
9 Meine Rolle
10 Reflexion der berufspraktischen Studien
10.1 Kollegium und Ansprechpersonen
10.2 Praxisanleiter
11 Resümee
Im vorliegenden Bericht schreibe ich aufgrund der Einfachheit in der männlichen Form. Selbstverständlich ist damit immer auch das weibliche Pendant gemeint.
1 Geschichte
Bei einem Blick in die Schulchronik erkennt man die bewegte Vergangenheit dieser Schule. 1950 entsteht die Bürgerschule (Volksschule) in der Lüttich-Kaserne. Im Jahre 1952 führt die Raumnutzung durch belgische Truppen zu einem Umzug. Ein weiterer Umzug in Pavillons der Hupfeldschule 1953 hält die Schulentwicklung in Unruhe. Ein dritter Umzug 1956 ist aus heutiger Sicht ein wichtiger Schritt nach vorne gewesen. Die Bürgerschule Eugen-Richter-Straße zieht in ein eigenes Gebäude. Sie trägt seitdem den Namen „Schule Am Heideweg“. Seitdem gib es viele Veränderungen. Durch den neu entstandenen Stadtteil Marbachshöhe, der zu Hälfte dem Schulbezirk der Grundschule Am Heideweg zugeordnet wird, gehen die Schülerzahlen weiter in die Höhe. Im Jahr 2003 entsteht ein weiterer Anbau.
Im Obergeschoss der Schule entsteht ein großzügiger Mehrzweckraum, im ersten Stockwerk kommen zwei neue Klassenräume hinzu und im Erdgeschoss zieht die GfK (Gesellschaft zur Förderung von Kinderbetreuung e.V.) mit ihren Angeboten für die „Betreute Grundschule“ und den Hort ein. In Zusammenarbeit von Lehrern, Kinder, der UNI-GHK, dem Kinderbüro der Stadt und dem Spielmobil Rote Rübe sowie Eltern und Förderverein wird das Schulgebäude überwiegend nach den Wünschen der Kinder umgestaltet.
2 Rechtsform
Rechtsgrundlage ist das Hessische Schulgesetz. Darüber hinaus prägen gesellschaftliche und pädagogische Anforderungen (12. Jugendbericht, PISA-Studie, Bildungs- und Erziehungsplan) und politische Vorgaben (U-Plus, selbstständige Schule) die Entwicklung der Schule.
3 Die Grundschule Am Heideweg
Das Einzugsgebiet der Schule erstreckt sich vom Bahnhof Wilhelmshöhe bis zum Herkules. Es umfasst das Drusseltal, die Marbachshöhe, das Flüsseviertel, den Brasselsberg und reicht bis zum Ortsrand von Nordhausen. Zurzeit werden ca. 300 Kinder in 12 Klassen, jeder Jahrgang ist dreizügig, von 13 Lehrkräften unterrichtet. Zeitweilig kommen Vertretungslehrer, Praktikanten und Lehrkräfte in der Ausbildung hinzu. Der Religionsunterricht liegt zum Teil in den Händen der Gemeindereferentin der Fatimakirche sowie der Pfarrer der Christus- und Emmausgemeinde. Zwei Lehrerinnen des Beratungs- und Förderzentrums der Astrid-Lindgren-Schule unterstützen Kinder und Lehrkräfte in vier Integrationsklassen.
Neben der Schule gehören auch der (im Schulgebäude befindliche) Hort „Calluna“, sowie der Förderverein der Schule zum Wirkungsraum der Praxisstelle. Die Kooperation in vielen Angelegenheiten innerhalb der Schule (Hort, Kollegium, Elternschaft) und die Vernetzung mit anderen Institutionen (Kirchengemeinden, Kindergärten, Jugendamt) gewinnt an Bedeutung. Darüber hinaus sind Honorarkräfte in der Bibliothek und in pädagogischen Projekten (Konfliktprävention, Schulchor) tätig. Die Grundschule Am Heideweg befindet sich in einem sozial ehr ausgeglichenem Umfeld. Das Klientel besteht überwiegend aus Akademikern, wie zum Beispiel Lehrer, Ärzte, Sozialpädagogen und Rechtsanwälten. Problemlagen ergeben sich aus Vernachlässigungen aber auch durch Eltern, die einen besonders hohen Anspruch an die Schule formulieren. Grundsätzlich ist die Elternschaft sehr engagiert und mitwirkungsbereit, was wiederum besondere Anforderungen an die Zusammenarbeit bedeutet.
4 Ziele der Grundschule
Eine differenzierte, breit angelegte Förderung jedes einzelnen Kindes in der Gemeinschaft soll die Kultur der Schule durchgängig auszeichnen.
Eine so verstandene Schulkultur ist Leistungskultur: individuelle Förderung im Unterricht, Förderung durch Zusatzangebote, z.B. auch in Arbeitsgruppen
Umgangskultur: Respekt, Tolerant, eine hohe Konfliktfähigkeit, Höflichkeit, Achtung vor sich selbst und den anderen
5 Förderverein
Der Verein unterstützt die pädagogische Arbeit in Schule und Hort und fördert das Zusammenwirken von Kollegium, Eltern und Kindern. Er setzt sich gegenüber der Öffentlichkeit und der Politik für die Schule ein und trägt zu einer positiven Entwicklung der Schule bei. Ein Förderverein kann manche Dinge freier und unabhängiger machen als die Schulleitung oder der Elternbeirat, insbesondere wenn es um das Einwerben finanzieller Mittel geht. Er kann steuerwirksame Spendenquittungen ausstellen und vereinzelt bestimmte Fördermittel beantragen. Wenn für die Schule nur die – immer knapper werdenden – öffentlichen Mittel zur Verfügung stünden, sähe es etwas ärmer aus: keine Seilbahn, keine Schaukeln, kein Klettergerüst, usw. Und es gäbe keinen Solidaritätsfond, aus dem bei Bedarf z.B. Klassenfahrten einzelner Kinder unterstützt werden können. Neben dem Geld, das bei Schulfesten oder Veranstaltungen eingenommen wird, sichern die Mitgliedsbeiräte die Finanzen des Fördervereins. Zurzeit hat der Förderverein 90 Mitglieder; in erste Linie Eltern, aber auch das gesamte Kollegium.
[...]
- Arbeit zitieren
- Anna Olenberg (Autor:in), 2008, Schulsozialarbeit. Ein Praktikumsbericht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/134417