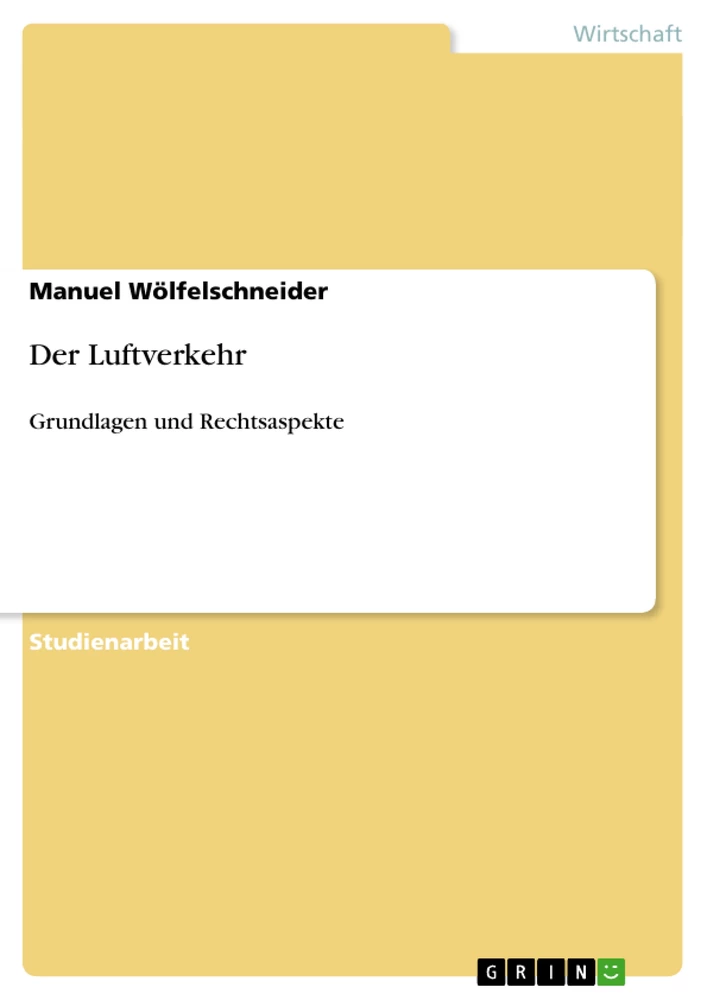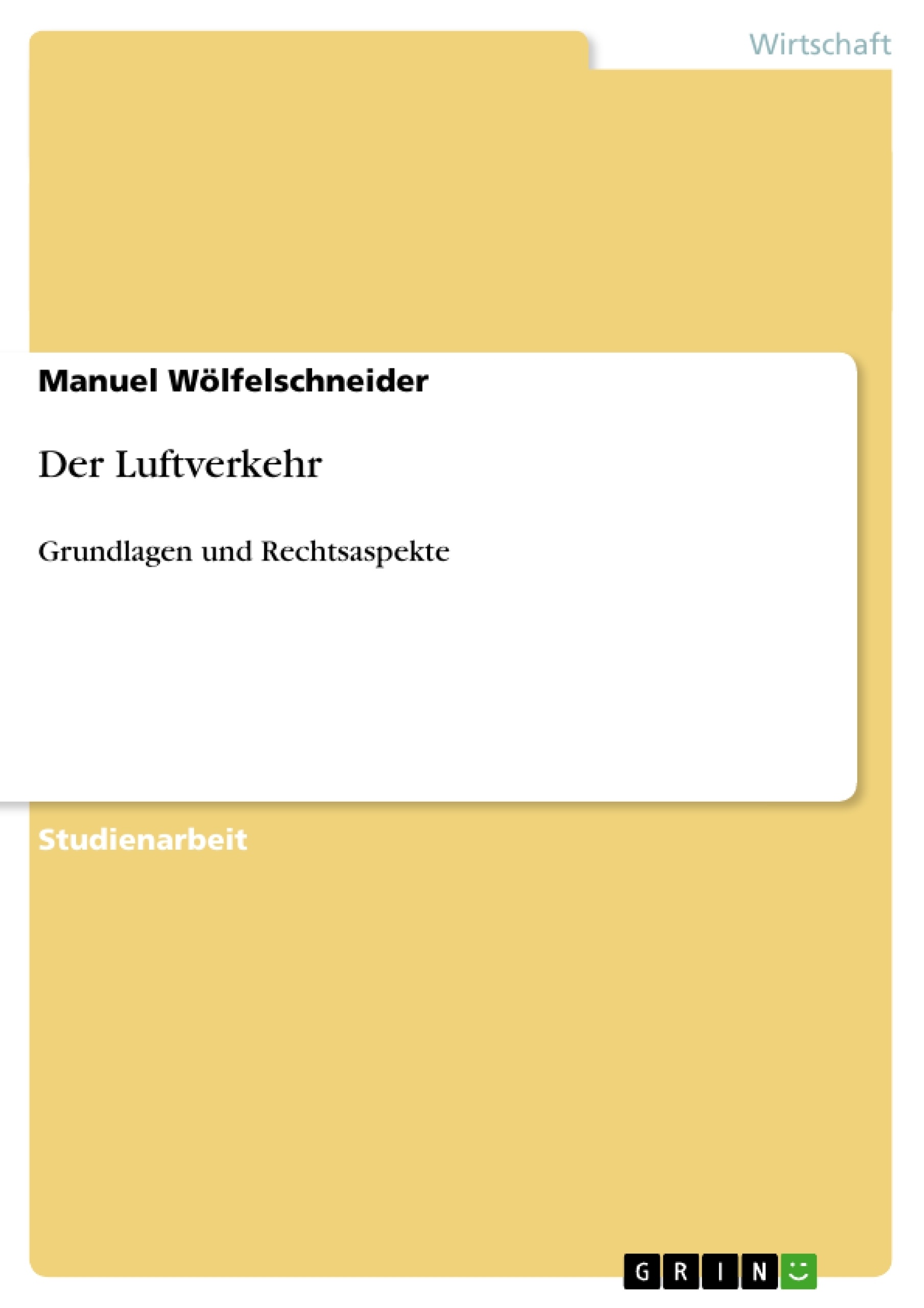Das Luftverkehrsrecht stellt ein sehr umfangreiches aber auch komplexes Rechtsgebiet dar,
dessen besondere Problematik sich vor allem aus seiner internationalen Einbindung ergibt.
Die Orientierung in der Vielzahl von nationalen und internationalen Gesetzestexten,
Richtlinien und Verordnungen ist darüber hinaus für das Verständnis des Themas essentiell.
Die Schwierigkeit dieser Arbeit bestand deshalb auch darin, aus den unzähligen Literatur- und
Gesetzestexten das herauszufiltern und aufzuarbeiten, was für das Verständnis des
Luftverkehrrechtes wesentlich ist. Diese Arbeit versucht daher auch keinen Anspruch auf
Vollständigkeit zu erheben, sondern verfolgt letztendlich das Ziel neben der Darlegung der
wichtigsten Rechtsaspekte auch auf einige Grundlagen des Luftverkehrs einzugehen.
Zu Beginn der Arbeit soll der Begriff des Luftverkehrsrechts erläutert und in den Gesamtkontext
eingeordnet werden. Dabei werden sowohl die rechtlichen Rahmenbedingungen des
Luftverkehrs als auch das deutsche, internationale und europäische Luftverkehrsrecht
betrachtet. Der 3. Abschnitt beschäftigt sich primär mit dem Luftverkehr. Dort wird neben der
„Freiheit des Luftraums“ auch der Begriff des Luftfahrzeugs definiert sowie die
Möglichkeiten des Verkehrs und die Flugsicherheit hervorgehoben. Die Ausgestaltung der
Haftung und alle dazugehörigen Besonderheiten sind Schwerpunkt des darauf folgenden
Kapitels. Dabei wird auf zwei verschieden Haftungspflichten eingegangen. Das Bestehen von
Regelungen und Richtlinien führt leider oftmals dazu diese zu vernachlässigen oder gar zu
brechen. Drohende Straf- und Bußgeldvorschriften können die Folge sein. Kapitel 5
beschäftigt sich abschließend mit diesem Thema.
[...]
GLIEDERUNG
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Glossar
1 Einleitung
2 Die Systematik des Luftverkehrsrechts
2.1 Rechtliche Rahmenbedingungen des Luftverkehrs
2.2 Das deutsche Luftverkehrsrecht
2.3 Das internationale Luftverkehrsrecht
2.4 Das supranationale Luftverkehrsrecht
3 Der Luftverkehr
3.1 Die Freiheit des Luftraums
3.2 Der Begriff des Luftfahrzeugs
3.3 Pflichten der Teilnehmer am Luftverkehr
3.4 Streckennetze des Luftraums
3.5 Flugplankoordinierung, Flugsicherung & Luftaufsicht
4 Haftpflicht im Luftverkehrsrecht
4.1 Das Haftungssystem des Luftverkehrsgesetzes
4.2 Haftung für Personenschäden
4.3 Haftung bei internationaler Luftbeförderung
4.4 Ausschluss der Haftung
5 Straf- und Bußgeldvorschriften
5.1 Ordnungswidrigkeiten
5.2 Luftverkehrsgefährdung
5.3 Weitere Straftatbestände
6 Abschließende Betrachtung
Anhang
Literatur- und Quellenverzeichnis
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Abbildung 1: Darstellung der rechtlichen Grundlagen des Luftverkehrs
Abbildung 2: Point – to – point – Verbindung
Abbildung 3: Hub – and – spoke – Verbindung
Abbildung 4: Netzwerkverbindungen
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
GLOSSAR
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 EINLEITUNG
Das Luftverkehrsrecht stellt ein sehr umfangreiches aber auch komplexes Rechtsgebiet dar, dessen besondere Problematik sich vor allem aus seiner internationalen Einbindung ergibt. Die Orientierung in der Vielzahl von nationalen und internationalen Gesetzestexten, Richtlinien und Verordnungen ist darüber hinaus für das Verständnis des Themas essentiell.
Die Schwierigkeit dieser Arbeit bestand deshalb auch darin, aus den unzähligen Literatur- und Gesetzestexten das herauszufiltern und aufzuarbeiten, was für das Verständnis des Luftverkehrrechtes wesentlich ist. Diese Arbeit versucht daher auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, sondern verfolgt letztendlich das Ziel neben der Darlegung der wichtigsten Rechtsaspekte auch auf einige Grundlagen des Luftverkehrs einzugehen.
Zu Beginn der Arbeit soll der Begriff des Luftverkehrsrechts erläutert und in den Gesamt-kontext eingeordnet werden. Dabei werden sowohl die rechtlichen Rahmenbedingungen des Luftverkehrs als auch das deutsche, internationale und europäische Luftverkehrsrecht betrachtet. Der 3. Abschnitt beschäftigt sich primär mit dem Luftverkehr. Dort wird neben der „Freiheit des Luftraums“ auch der Begriff des Luftfahrzeugs definiert sowie die Möglichkeiten des Verkehrs und die Flugsicherheit hervorgehoben. Die Ausgestaltung der Haftung und alle dazugehörigen Besonderheiten sind Schwerpunkt des darauf folgenden Kapitels. Dabei wird auf zwei verschieden Haftungspflichten eingegangen. Das Bestehen von Regelungen und Richtlinien führt leider oftmals dazu diese zu vernachlässigen oder gar zu brechen. Drohende Straf- und Bußgeldvorschriften können die Folge sein. Kapitel 5 beschäftigt sich abschließend mit diesem Thema.
2 DIE SYSTEMATIK DES LUFTVERKEHRSRECHTS
Die Abgrenzung des Begriffes Luftverkehrsrecht ist in der Praxis nicht immer ganz einfach. Aufgrund seiner zahlreichen Berührungspunkte mit anderen Rechtsgebieten ist das Luftverkehrsrecht äußerst komplex und wird in vielen Teilbereichen von höherrangigen Gesetzen[3] überlagert. Nichts desto trotz fallen unter den Begriff des Luftverkehrsrechts primär sämtliche Rechtsvorschriften, die sich auf die Luftfahrt beziehen.
2.1 RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN DES LUFTVERKEHRS
Das Luftverkehrsrecht lässt sich nach dem Geltungsbereich grob einteilen in das nationale und internationale sowie ferner nach dem Regelungsgegenstand in das öffentliche und private Luftrecht. Das private Luftverkehrsrecht regelt im Wesentlichen Haftungs- und Versicherungsfragen, die in Zusammenhang mit dem Betrieb eines Luftfahrzeuges auftreten können. Dazu zählen beispielsweise Fragen der Haftung für Schäden durch Absturz, Zusammenstoß oder sonstige Unfälle von Luftfahrzeugen. Aber auch nachbarrechtliche Fragen zwischen Anliegern und Flugplatz sind Gegenstand des privaten Luftverkehrrechts.
Hiervon abzugrenzen ist das öffentliche Luftverkehrsrecht, welches aufgrund von Sicherheitsgründen einer tiefgründigeren öffentlich-rechtlichen Regelung bedarf. Hinsichtlich der Zulassung von Luftfahrtgeräten beispielsweise oder dem Betrieb von Flughäfen bestehen Genehmigungsvorschriften, die dieses Recht regelt.
Während das deutsche Luftverkehrsrecht Vorgänge innerhalb des deutschen Luftraums regelt, befasst sich das internationale Luftverkehrsrecht mit Rechtsbeziehungen, die bei grenzüberschreitenden Flügen auftreten. Abbildung 1 gibt einen Überblick über die rechtlichen Grundlagen des Luftverkehrs. Neben den oben erwähnten Einteilungen zeigt die Abbildung eine weitere Aufspaltung der internationalen Rechtsvorschriften des öffentlichen Luftverkehrs in bilaterale und multilaterale Abkommen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Darstellung der rechtlichen Grundlagen des Luftverkehrs
Multilaterale Abkommen sind „völkerrechtliche Verträge, die zwischen mehreren souveränen Staaten abgeschlossen werden“.[4] Sie sollen ein geordnetes Miteinander zwischen den entsprechenden Vertragspartnern gewährleisten, da dies im innerstaatlichen Recht der einzelnen souveränen Vertragsstaaten nicht geregelt ist. Das bekannteste multilaterale Abkommen ist das Chicagoer Abkommen, auch „Convention on International Civil Aviation“ genannt, welches 1944 auf einer Konferenz von Chicago aufgesetzt wurde und erste Regelungen bezüglich internationaler Überflugs-, Flug- und Landerechten beinhaltete. Das Abkommen „regelt die Rechte und Pflichten der Vertragsstaaten für den Bereich des internationalen Luftverkehrs und ist gleichzeitig die Verfassung der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation[5] (ICAO[6] )“.[7] Eckpunkt der Verfassung ist beispielsweise die uneingeschränkte Souveränität, die jedem Staat, in Bezug auf den Luftraum über seinem Hoheitsgebiet, obliegt (Artikel 1). Ebenso beinhaltet dieses Abkommen das Prinzip der Chancengleichheit, welches jedem Staat das gleiche Recht zur Teilnahme am internationalen Luftverkehr einräumt (Artikel 5 ff.). Die Bundesrepublik Deutschland ist seit dem Jahre 1956 Mitglied der ICAO. Bis heute haben 189 Staaten das Chicagoer Abkommen ratifiziert.[8]
Neben multilateralen Abkommen haben viele souveräne Staaten zahlreiche bilaterale Abkommen geschlossen, die insbesondere Fragen des gegenseitigen Ein- und Ausflugs von Luftfahrzeugen regeln.[9] Bilaterale Abkommen entsprechen größtenteils dem Vertragstypus der multilateralen Abkommen, jedoch mit dem Unterschied, dass die wechselseitige Gewährleistung von Verkehrsrechten nur zwischen zwei ausgesuchten Vertragspartnern erfolgt. Soll beispielsweise ein internationaler Luftverkehr zwischen zwei Staaten, von denen einer Nicht-EU-Staat ist, stattfinden, so wird dafür grundsätzlich ein bilaterales Abkommen ausgehandelt.[10] „Abgesehen vom nichtgewerblichen Luftverkehr basiert der internationale Luftverkehr i.d.R. auf solchen bilateralen Abkommen“.[11]
2.2 DAS DEUTSCHE LUFTVERKEHRSRECHT
Wie bereits erwähnt ist das Luftrecht generell ein sehr komplexes Rechtsgebiet, dessen internationale Verflechtung das Hauptproblem bei Rechtsfragen darstellt. Seiner Natur nach ist der Luftverkehr auf Grenzüberschreitung angelegt und bedarf daher neben nationalen Regelungen oftmals Gesetze auf internationaler Ebene. „Dem nationalen Luftverkehrsrecht kommt daher primär die Aufgabe zu, diese internationalen Regelungen in deutsches Recht umzusetzen bzw. die Rechtsfragen bei Flügen ohne Auslandsberührung zu regeln“.[12]
Das deutsche Luftverkehrsrecht ist also prinzipiell verantwortlich für alle Vorgänge, die den deutschen Luftraum betreffen. Grundlage des gesamten deutschen Luftverkehrsrechts ist hier das Grundgesetz. Gemäß Art. 73 Nr. 6 GG hat der Bund die ausschließliche Gesetzgebungs-kompetenz über den Luftverkehr, was bedeutet, dass die Bundesländer über eine derartige Kompetenz nur verfügen, wenn sie durch ein Bundesgesetz dazu ermächtigt sind (Art. 71 GG). Neben dem Grundgesetz bildet das Luftverkehrsgesetz (LuftVG) den nationalen Rahmen für die Luftfahrt in Deutschland.[13] Es enthält die wichtigsten luftrechtlichen Vorschriften, wird aber darüber hinaus noch durch weitere luftfahrtrelevante Verordnungen und Gesetze ergänzt. Die wichtigsten Verordnungen zum Luftverkehrsgesetz sind die Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO), das Luftsicherheitsgesetz (LuftSiG), die Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO) und das Flugunfall-Untersuchungs-Gesetz (FlUUG).[14]
2.3 DAS INTERNATIONALE LUFTVERKEHRSRECHT
Wie schon bekannt, untergliedert sich der öffentliche Teil des internationalen Luftverkehrsrechts in bilaterale und multilaterale Abkommen. Die für den Luftverkehr wichtigsten Vorschriften weist das bereits erwähnte Chicagoer Abkommen auf, ohne das ein moderner internationaler Luftverkehr undenkbar wäre.
Einen sehr bedeutenden Teil des Chicagoer Abkommens stellen die Freiheiten der Luft dar. Diese so genannten „Freedoms of the air“ sind Verkehrsrechte, auf deren Grundlage der internationale Luftverkehr abgewickelt wird. Im Rahmen des Chicagoer Abkommens wurden folgende Verkehrrechte zwischen Heimat- und Fremdstaaten vereinbart:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Fluggesellschaft eines Landes erhält Die Fluggesellschaft erhält das Recht zur
das Recht, das Hoheitsgebiet eines nichtgewerblichen Zwischenlandung (Tanken,
fremden Staates ohne Landung zu Reparatur, Wechsel Flugpersonal) in einem
überfliegen (Überflugsrecht). fremden Staat. Fluggäste, Fracht und Post dürfen
dabei weder abgesetzt noch aufgenommen werden (Technische Rechte).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Fluggesellschaft erhält das Recht, Die Fluggesellschaft erhält das Recht, Fluggäste,
Fluggäste, Fracht und Post aus dem Fracht und Post im Vertragsstaat aufzunehmen
Heimatstaat in einen fremden Staat zu und in den Heimatstaat zu befördern transportieren (Direktverkehr). (Direktverkehr).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Fluggesellschaft erhält das Recht, Die Fluggesellschaft erhält das Recht, Fluggäste,
Fluggäste, Fracht und Post zwischen Fracht und Post in einem Vertragsstaat
zwei Vertragsstaaten gewerblich zu aufzunehmen und nach einer Zwischenlandung
befördern, wobei der Flug entweder im Heimatstaat in einen Drittstaat weiterzu-
im Heimatstaat beginnen oder enden befördern und umgekehrt (Transitverkehr).
muss (Unterwegsverkehr).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Fluggesellschaft erhält das Recht, Die Fluggesellschaft erhält das Recht, Fluggäste,
Fluggäste, Fracht und Post zwischen Fracht und Post zwischen zwei Orten innerhalb
fremden Staaten zu transportieren, ohne eines fremden Staates zu befördern, aber in
dass auf diesem Flug der Heimatstaat Verbindung mit dem Heimatstaat (Kabotage- berührt wird (Exterritorialverkehr). recht[15] ).[16]
[...]
[1] http://de.wikipedia.org/wiki/Kabotage
[2] Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/OWiG
[3] Höherrangige Gesetze können in diesem Fall beispielsweise das Zivilrecht und im besonderen Maße das Schadenersatzrecht oder auch das Öffentliche Recht sein.
[4] Sterzenbach, R./Conrady, R. (2003), Seite 66.
[5] Die ICAO wurde durch Artikel 43 des Chicagoer Abkommens 1944 ins Leben gerufen.
[6] Vgl. Glossar.
[7] Luftverkehrsrecht – Ein Überblick (2003), Seite 3.
[8] Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/International_Civil_Aviation_Organization
[9] Vgl. Giemulla, E./Schmid, R. (1997), Band 1.1, Einleitung, Seite 14.
[10] Vgl. Luftverkehrsrecht – Ein Überblick (2003), Seite 3.
[11] Giemulla, E./Schmid, R. (1997), Band 1.1, Einleitung, Seite 14.
[12] Giemulla, E./Schmid, R. (1997), Band 1.1, Einleitung, Seite 2.
[13] Vgl. Giemulla, E./Schmid, R. (1997), Band 1.1, Einleitung, Seite 11.
[14] vgl. Anhang 1
[15] Vgl. Glossar
[16] Abbildungen und Erläuterungen in Anlehnung an die Präsentation der Hochschule Heilbronn zum Thema „Luftverkehr“ (2006), Seite 18/19.
Häufig gestellte Fragen
Was umfasst das Luftverkehrsrecht?
Es umfasst sämtliche Rechtsvorschriften, die sich auf die Luftfahrt beziehen, unterteilt in nationales, internationales und supranationales (EU-) Recht.
Was ist das Chicagoer Abkommen?
Das Abkommen von 1944 ist die Grundlage der internationalen Zivilluftfahrt und regelt Überflugs-, Flug- und Landerechte sowie die Souveränität des Luftraums.
Wie ist die Haftung im Luftverkehr geregelt?
Die Haftung ist im Luftverkehrsgesetz (LuftVG) sowie in internationalen Abkommen (z. B. Montrealer Übereinkommen) geregelt, insbesondere für Personen- und Sachschäden.
Was versteht man unter den „Freiheiten der Luft“?
Dies sind Verkehrsrechte (Freedoms of the air), die festlegen, welche Staaten unter welchen Bedingungen den Luftraum anderer Staaten nutzen dürfen.
Welche Rolle spielt die ICAO?
Die International Civil Aviation Organization (ICAO) ist die Organisation, die die Einhaltung der internationalen Standards im Luftverkehr überwacht.
- Arbeit zitieren
- Manuel Wölfelschneider (Autor:in), 2007, Der Luftverkehr, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/134869