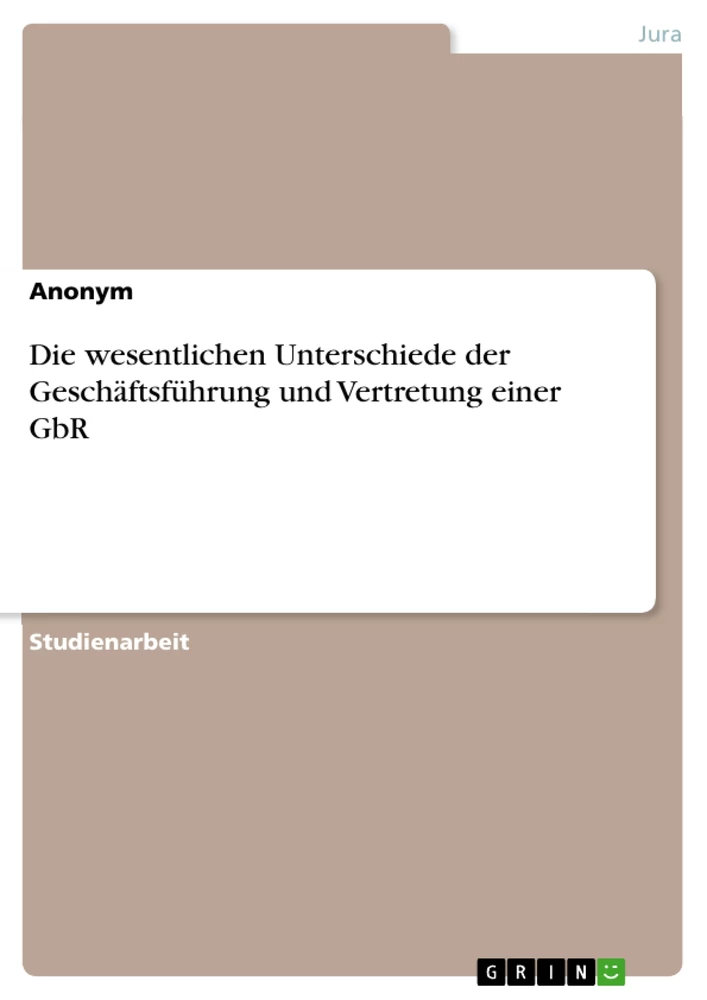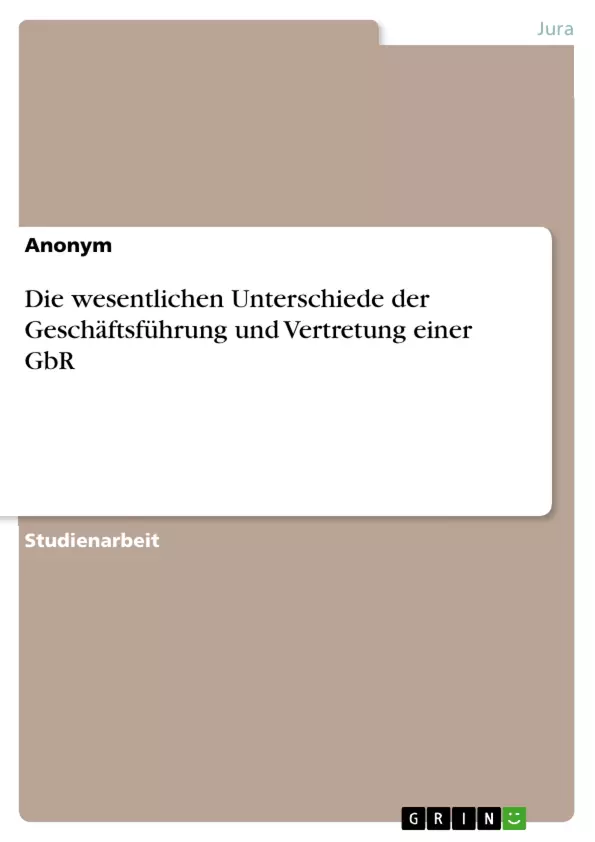Das Ziel dieser Seminararbeit ist, die Charakteristika der Geschäftsführung einer GbR aufzuzeigen und Begrifflichkeiten zu präzisieren.
Bei der weitverbreiteten Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR oder auch BGB-Gesellschaft) handelt es sich um die Grundform der Personengesellschaften, die gleichzeitig auch die Basis für Gesellschaftsformen wie die OHG oder KG bildet. Die grundlegenden Regelungen für die GbR finden sich in den §§ 709 bis 740 BGB und sind oft dispositiv anwendbar. Da bei der Gestaltung des Gesellschaftsvertrags breiter Handlungsspielraum besteht, kann er flexibel an die Bedürfnisse der jeweiligen Gesellschaft angepasst werden.
Aufgrund ihrer weiten Definition existieren in der Geschäftswelt zahlreiche Ausprägungsformen der GbR. Beispiele hierfür sind Sozietäten, Freiberufler oder auch projektbezogene Kooperationen im Baugewerbe, die häufig als BGB-Gesellschaften organisiert sind. Auch Wohn- oder Fahrgemeinschaften sind regelmäßig Gesellschaften bürgerlichen Rechts.
Zu den konstituierenden Merkmalen einer GbR zählt, wie deren Geschäftsführung ausgestaltet ist. In diesem Zusammenhang werden in der Praxis wesentliche Begriffe wie „Geschäftsführung“ und „Vertretung“ der GbR oftmals falsch verwendet.
Hierzu wird in Kapitel 2 zunächst der Begriff und Gegenstand der „Geschäftsführung“ näher erläutert. Darauf aufbauend werden die Teilbereiche der Geschäftsführung - "Geschäftsführungsbefugnis" und "Vertretungsmacht" – erörtert, Unterschiede herausgearbeitet und dem Innen- und Außenverhältnis der GbR zugeordnet (Kapitel 3, 4 und 5).
Anhand eines Fallbeispiels wird in Kapitel 6 die Problematik der Haftung der Gesellschafter in der GbR bei unterschiedlicher Ausgestaltung von Geschäftsführung und Vertretung analysiert. Dies geschieht unter Anwendung des BGH Beschlusses vom 09.06.2008, II ZR 268/07 und des BGH Urteils vom 24.09.2013, II ZR 391/12.
In Kapitel 7 wird ein Fazit gezogen. Abschließend wird ein Ausblick auf die Einführung eines Gesellschaftsregisters gegeben, welche das Ziel verfolgt, bestehende Defizite in der Publizität der GbR zu beheben.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Geschäftsführung
- 2.1 Grundlagengeschäfte
- 2.2 Gegenstand der Geschäftsführung
- 3 Geschäftsführungsbefugnis
- 3.1 Grundsatz der Selbstorganschaft
- 3.2 Arten der Geschäftsführungsbefugnis
- 3.2.1 Gesamtgeschäftsführung
- 3.2.2 Mehrheitliche Geschäftsführung
- 3.2.3 Einzelgeschäftsführung mehrerer oder einzelner Gesellschafter
- 3.2.4 Gesamtgeschäftsführung Einzelner
- 3.2.5 Sonstige Gestaltungsmöglichkeiten
- 4 Vertretungsmacht
- 4.1 Umfang der Vertretungsmacht
- 4.2 Grundsatz der Selbstorganschaft
- 4.3 Überschreitung der Vertretungsmacht
- 5 Gegenüberstellung der Begriffe „Geschäftsführungsbefugnis“ und „Vertretungsmacht“
- 6 Haftung in der GbR
- 6.1 Definition und Gegenstand der Haftung
- 6.2 Haftung der GbR Gesellschafter bei unterschiedlicher Ausgestaltung der Geschäftsführung und Vertretung
- 7 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die wesentlichen Unterschiede zwischen Geschäftsführung und Vertretung in einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR). Ziel ist es, die rechtlichen Grundlagen beider Bereiche zu klären und die Konsequenzen unterschiedlicher Ausgestaltungen für die Haftung der Gesellschafter aufzuzeigen.
- Unterschiede zwischen Geschäftsführungsbefugnis und Vertretungsmacht
- Relevanz des Grundsatzes der Selbstorganschaft
- Arten der Geschäftsführungsbefugnis (Gesamt-, Mehrheits-, Einzelgeschäftsführung)
- Haftung der Gesellschafter bei unterschiedlicher Ausgestaltung von Geschäftsführung und Vertretung
- Konsequenzen der Überschreitung der Vertretungsmacht
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Einleitung dient der Einführung in das Thema und der Definition des Problems: die Unterscheidung zwischen Geschäftsführung und Vertretung in einer GbR und deren Auswirkungen auf die Haftung der Gesellschafter. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und die Vorgehensweise bei der Bearbeitung der Fragestellung.
2 Geschäftsführung: Dieses Kapitel legt die Grundlagen der Geschäftsführung in einer GbR dar. Es behandelt die Grundlagengeschäfte und den Gegenstand der Geschäftsführung, wobei der Fokus auf den Aktivitäten liegt, die die Gesellschafter zur Erreichung des Gesellschaftszwecks durchführen. Hier wird die Unterscheidung zwischen internen und externen Handlungen der GbR erläutert. Die Kapitel 2.1 und 2.2 bilden den Grundstein für das Verständnis der komplexeren Aspekte der Geschäftsführungsbefugnis und der Vertretungsmacht.
3 Geschäftsführungsbefugnis: Dieses Kapitel analysiert die rechtlichen Regelungen und verschiedenen Arten der Geschäftsführungsbefugnis in einer GbR. Es erklärt den Grundsatz der Selbstorganschaft und detailliert die Möglichkeiten der Gesamt-, Mehrheits- und Einzelgeschäftsführung, einschließlich der Ausgestaltungsoptionen für die Befugnisse einzelner Gesellschafter. Die verschiedenen Arten der Geschäftsführungsbefugnis werden im Detail erläutert und durch Beispiele veranschaulicht, um die praktischen Auswirkungen der unterschiedlichen Regelungen aufzuzeigen. Der Fokus liegt auf den Konsequenzen dieser unterschiedlichen Modelle für die interne Organisation und die Entscheidungsfindung in der GbR.
4 Vertretungsmacht: In diesem Kapitel wird der Umfang der Vertretungsmacht der Gesellschafter einer GbR untersucht. Der Grundsatz der Selbstorganschaft wird im Kontext der Vertretungsmacht erneut beleuchtet, und die Konsequenzen einer Überschreitung der Vertretungsmacht werden umfassend analysiert. Der Fokus liegt auf den externen Handlungen der GbR und den damit verbundenen rechtlichen und finanziellen Folgen für die Gesellschafter. Das Kapitel beleuchtet die Unterschiede zwischen der internen Entscheidungsfindung (Geschäftsführung) und dem Handeln gegenüber Dritten (Vertretung).
5 Gegenüberstellung der Begriffe „Geschäftsführungsbefugnis“ und „Vertretungsmacht“: Dieses Kapitel vergleicht und kontrastiert die Begriffe "Geschäftsführungsbefugnis" und "Vertretungsmacht", um die feinen Unterschiede und die jeweiligen rechtlichen Implikationen deutlich zu machen. Es werden die Überschneidungen und die voneinander abweichenden Bereiche beider Konzepte detailliert untersucht. Dies ist zentral, um die möglichen Haftungsrisiken für die Gesellschafter zu verstehen.
6 Haftung in der GbR: Dieses Kapitel befasst sich mit der Haftung der Gesellschafter in einer GbR, insbesondere im Kontext der unterschiedlichen Ausgestaltungen der Geschäftsführung und Vertretung. Es beschreibt die verschiedenen Arten der Haftung und deren jeweilige Konsequenzen. Der Fokus liegt darauf, wie die Gestaltung der Geschäftsführungsbefugnis und der Vertretungsmacht die individuelle Haftung der Gesellschafter beeinflusst. Der Abschnitt 6.2 beleuchtet die komplexen Wechselwirkungen zwischen den internen Regeln der GbR und den externen Haftungsfolgen.
Schlüsselwörter
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), Geschäftsführung, Vertretungsmacht, Selbstorganschaft, Haftung, Gesellschafter, Geschäftsführungsbefugnis, Gesamtgeschäftsführung, Mehrheitliche Geschäftsführung, Einzelgeschäftsführung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Geschäftsführung und Vertretungsmacht in der GbR
Was ist der Hauptgegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die wesentlichen Unterschiede zwischen Geschäftsführung und Vertretungsmacht in einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) und die daraus resultierenden Haftungsfolgen für die Gesellschafter. Sie klärt die rechtlichen Grundlagen beider Bereiche und zeigt die Konsequenzen unterschiedlicher Ausgestaltungen auf.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt unter anderem die Unterschiede zwischen Geschäftsführungsbefugnis und Vertretungsmacht, die Relevanz des Grundsatzes der Selbstorganschaft, verschiedene Arten der Geschäftsführungsbefugnis (Gesamt-, Mehrheits- und Einzelgeschäftsführung), die Haftung der Gesellschafter bei unterschiedlicher Ausgestaltung von Geschäftsführung und Vertretung sowie die Konsequenzen einer Überschreitung der Vertretungsmacht.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Geschäftsführung (inkl. Grundlagengeschäfte und Gegenstand der Geschäftsführung), Geschäftsführungsbefugnis (inkl. verschiedener Arten der Geschäftsführungsbefugnis), Vertretungsmacht (inkl. Umfang und Konsequenzen der Überschreitung), Gegenüberstellung von Geschäftsführungsbefugnis und Vertretungsmacht, Haftung in der GbR und schließlich Fazit und Ausblick. Jedes Kapitel fasst die wesentlichen Aspekte des jeweiligen Themas zusammen.
Was versteht man unter Geschäftsführungsbefugnis in einer GbR?
Die Geschäftsführungsbefugnis regelt, wer innerhalb der GbR berechtigt ist, Geschäfte im Namen der Gesellschaft zu tätigen. Die Seminararbeit erläutert den Grundsatz der Selbstorganschaft und beschreibt verschiedene Arten der Geschäftsführungsbefugnis: Gesamtgeschäftsführung, Mehrheitliche Geschäftsführung und Einzelgeschäftsführung. Die verschiedenen Modelle und deren Auswirkungen auf die interne Organisation und Entscheidungsfindung werden detailliert dargestellt.
Was ist die Vertretungsmacht in einer GbR?
Die Vertretungsmacht beschreibt die Befugnis, die GbR nach außen hin zu vertreten und im Namen der Gesellschaft rechtsgeschäftlich mit Dritten zu handeln. Die Arbeit untersucht den Umfang der Vertretungsmacht, den Grundsatz der Selbstorganschaft in diesem Kontext und die Konsequenzen, wenn die Vertretungsmacht überschritten wird. Der Fokus liegt auf den externen Handlungen der GbR und den damit verbundenen rechtlichen und finanziellen Folgen.
Wie unterscheidet sich die Geschäftsführungsbefugnis von der Vertretungsmacht?
Ein separates Kapitel widmet sich dem Vergleich und der Gegenüberstellung von Geschäftsführungsbefugnis und Vertretungsmacht. Es werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Konzepte herausgearbeitet, um die jeweiligen rechtlichen Implikationen und die möglichen Haftungsrisiken für die Gesellschafter deutlich zu machen.
Welche Rolle spielt die Haftung der Gesellschafter?
Die Haftung der Gesellschafter in einer GbR ist ein zentrales Thema der Arbeit. Es wird erläutert, wie die Ausgestaltung der Geschäftsführungsbefugnis und der Vertretungsmacht die individuelle Haftung der Gesellschafter beeinflusst. Besonders der Abschnitt 6.2 beleuchtet die komplexen Wechselwirkungen zwischen den internen Regeln der GbR und den externen Haftungsfolgen.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Seminararbeit relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), Geschäftsführung, Vertretungsmacht, Selbstorganschaft, Haftung, Gesellschafter, Geschäftsführungsbefugnis, Gesamtgeschäftsführung, Mehrheitliche Geschäftsführung und Einzelgeschäftsführung.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Die Arbeit enthält eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels, welche die Inhalte und die zentralen Ergebnisse prägnant beschreibt.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2022, Die wesentlichen Unterschiede der Geschäftsführung und Vertretung einer GbR, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1351248