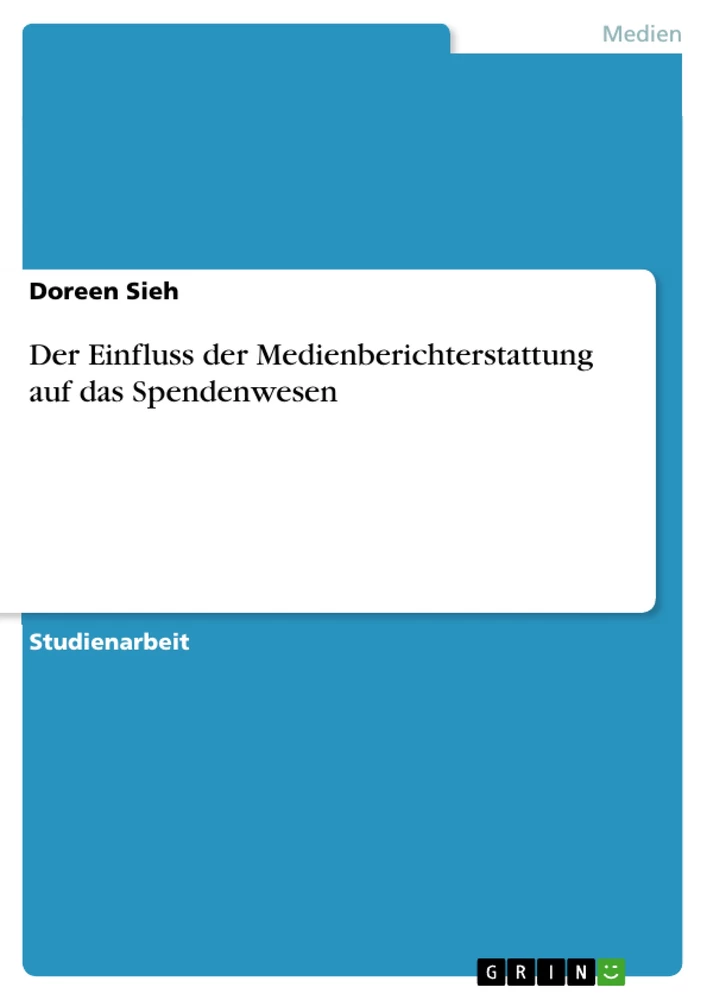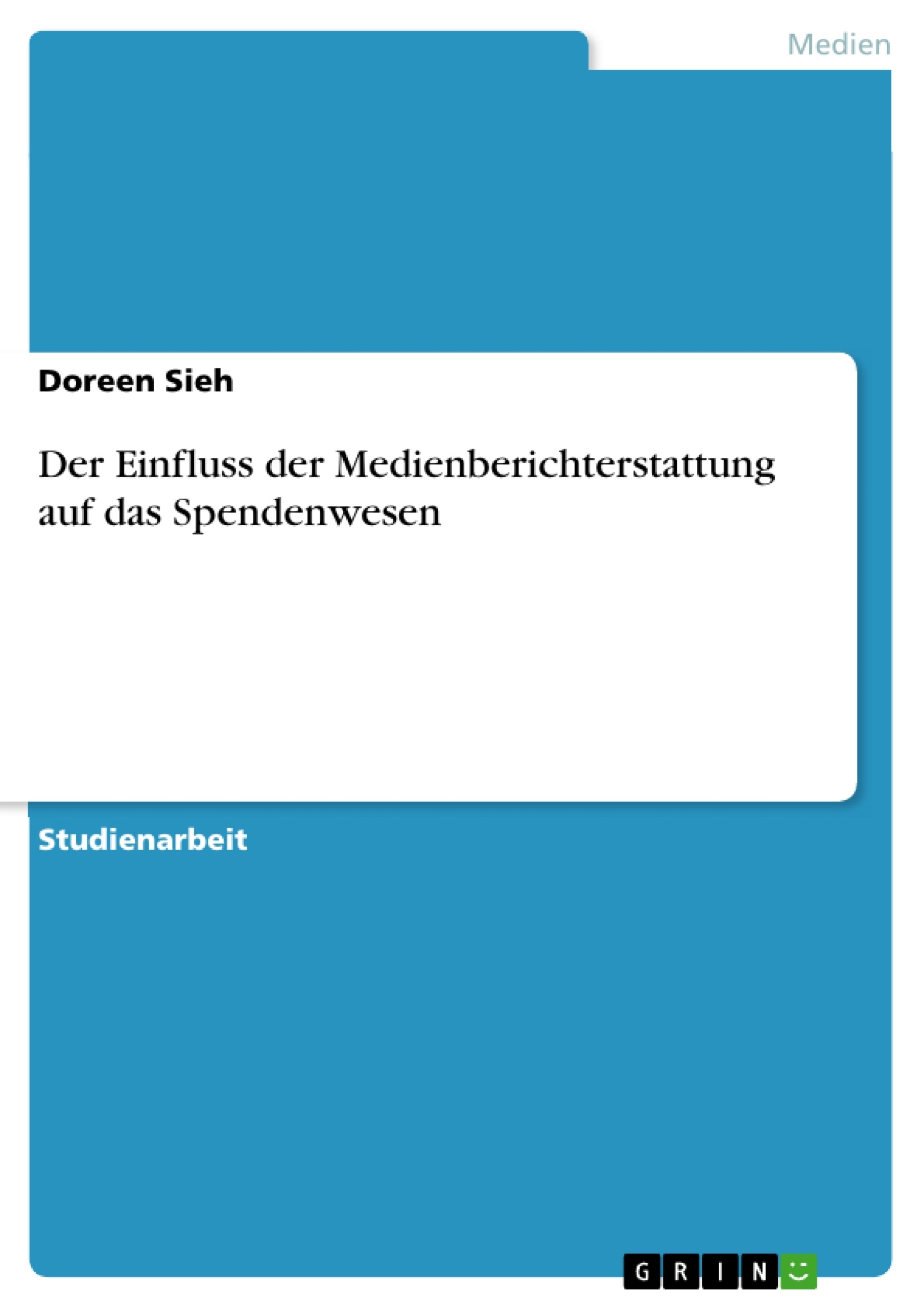Die Macht der Medien ist groß, heißt es im Volksmund. Nachrichten von Kriegen, Hitzewellen, Hungersnöten und Flutkatastrophen aus aller Welt erreichen uns täglich in unseren Wohnzimmern und beeinflussen unser Denken und Handeln. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Spendenbereitschaft in Deutschland nach Katastrophenereignissen. Als Beispiele sollen hier die Elbe-Hochwasser-Katastrophe 2002 und die Tsunami-Flut-Katastrophe 2004 herangezogen werden. Die Frage lautet: Inwieweit beeinflusst die Medienberichterstattung das Spendenverhalten? Ausgehend von der Definition und der Funktion der Medien soll auf die Katastrophenberichterstattung allgemein eingegangen werden. Im Folgenden wird das Spendenwesen in Deutschland beleuchtet. Den Kern der Arbeit bilden dann die Ausführungen zu den beiden Katastrophen in Zusammenhang mit der Darstellung zur damaligen Situation der Berichterstattung und dem jeweiligen erzielten Spendenvolumen. Die Zusammenfassung soll zeigen, ob und inwieweit die zusammengetragenen Fakten den Verdacht untermauern, dass ein großes Medieninteresse auch eine erhöhte Spendenbereitschaft nach sich zieht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.a) Definition Medien
- 1.b) Funktion der Medien
- 2. Krisen- und Katastrophenberichterstattung
- 3. Das Spendenwesen in Deutschland
- 4. Fallbeispiele
- 4.a) Die Elbe-Hochwasser-Katastrophe 2002
- 4.b) Medienberichterstattung und Spendeneinnahmen
- 4.c) Die Tsunami-Flut-Katastrophe 2004
- 4.d) Medienberichterstattung und Spendeneinnahmen
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss der Medienberichterstattung auf die Spendenbereitschaft in Deutschland im Kontext von Naturkatastrophen. Die Elbe-Hochwasserkatastrophe 2002 und die Tsunami-Katastrophe 2004 dienen als Fallbeispiele. Ziel ist es, den Zusammenhang zwischen Medieninteresse und Spendenvolumen zu analysieren.
- Definition und Funktion von Medien
- Krisen- und Katastrophenberichterstattung und ihre Auswirkungen
- Das deutsche Spendenwesen und seine Organisationsstrukturen
- Analyse der Medienberichterstattung zu den Fallbeispielen
- Zusammenhang zwischen Medienaufmerksamkeit und Spendenhöhe
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach dem Einfluss der Medienberichterstattung auf das Spendenverhalten in Deutschland nach Katastrophen dar. Die Elbe-Hochwasserkatastrophe 2002 und die Tsunami-Katastrophe 2004 werden als Fallstudien angekündigt. Es wird die Bedeutung der Medien im Kontext von Krisen und Katastrophen hervorgehoben und die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung des Themas betont. Die Arbeit verspricht eine Analyse der Spendenbereitschaft im Lichte der jeweiligen Medienberichterstattung.
1.a) Definition Medien: Dieses Kapitel widmet sich der Definition des Begriffs „Medien“. Es wird die Schwierigkeit, eine allgemein gültige Definition zu finden, aufgezeigt und verschiedene Ansätze, wie die von Peter Hunziker mit seinen drei Medienarten (primäre, sekundäre, tertiäre Medien) und Marie Luise Kiefer mit ihrer Beschreibung von Medien als Kommunikationskanälen, vorgestellt. Die Diskussion der verschiedenen Definitionen verdeutlicht die Komplexität des Begriffs und legt die Grundlage für die weitere Analyse der Medienwirkung.
1.b) Funktion der Medien: Aufbauend auf den vorherigen Definitionen wird hier die Funktion der Medien beleuchtet. Die Kommunikation wird als primäre Funktion herausgestellt, ergänzt um weitere Funktionen wie politische Bildung, Meinungsbildung, soziale Integration und Unterhaltung. Die Ausführungen von Kiefer und Hunziker werden herangezogen, um die Rolle der Medien in der Gesellschaft und ihre Auswirkungen auf die öffentliche Meinung zu verdeutlichen. Die Komplexität des Mediensystems und seine Bedeutung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt werden hervorgehoben.
2. Krisen- und Katastrophenberichterstattung: Dieses Kapitel behandelt die besondere Rolle der Medien bei der Berichterstattung über Krisen und Katastrophen. Die Medien werden als globale Informations- und Meinungsbildner dargestellt, gleichzeitig aber auch als Wirtschaftsunternehmen, die im Wettbewerb um Zuschauerzahlen stehen. Der mögliche Konflikt zwischen journalistischer Verantwortung und wirtschaftlichen Interessen wird angesprochen, ebenso die Gefahr von Sensationalisierung und der Einfluss der Berichterstattung auf die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung. Die Notwendigkeit redaktioneller Richtlinien und eine ausgewogene, differenzierte Berichterstattung werden betont.
3. Das Spendenwesen in Deutschland: Das Kapitel beschreibt die Struktur des deutschen Spendenwesens, indem es zwischen staatlichen und nicht-staatlichen Organisationen unterscheidet. Die unterschiedlichen Finanzierungsmodelle und die Bedeutung von Spenden für die Arbeit der Nichtregierungsorganisationen werden erklärt. Der starke Wettbewerb unter den Organisationen und die Bedeutung des DZI-Spendensiegels zur Gewährleistung von Seriosität werden erläutert. Schließlich werden statistische Daten zur durchschnittlichen Spendenhöhe in Deutschland präsentiert.
4. Fallbeispiele: Dieses Kapitel stellt die Fallstudien der Elbe-Hochwasserkatastrophe 2002 und der Tsunami-Katastrophe 2004 vor, jedoch ohne detaillierte Zusammenfassungen der Ereignisse selbst zu liefern, im Sinne der Aufgabenstellung. Es konzentriert sich auf die Analyse der Medienberichterstattung und deren möglicher Einfluss auf die Spendenbereitschaft in beiden Fällen. Die Zusammenfassung dieser Kapitel würde die detaillierten Analysen der Medienberichterstattung und deren Wirkung auf das Spendenverhalten enthalten.
Schlüsselwörter
Medienberichterstattung, Spendenwesen, Katastrophen, Naturkatastrophen, Elbe-Hochwasser 2002, Tsunami 2004, Spendenbereitschaft, Medienwirkung, öffentliche Meinung, Hilfsbereitschaft, soziale Verantwortung, Medienökonomie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Einfluss der Medienberichterstattung auf die Spendenbereitschaft in Deutschland nach Naturkatastrophen
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss der Medienberichterstattung auf die Spendenbereitschaft der Bevölkerung in Deutschland im Kontext von Naturkatastrophen. Als Fallbeispiele dienen die Elbe-Hochwasserkatastrophe 2002 und die Tsunami-Katastrophe 2004.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Ziel ist die Analyse des Zusammenhangs zwischen dem Medieninteresse an den Katastrophen und dem resultierenden Spendenvolumen. Die Arbeit beleuchtet die Definition und Funktion von Medien, die Besonderheiten der Krisenberichterstattung, das deutsche Spendenwesen und schließlich den konkreten Einfluss der Medienberichterstattung auf die Spendenbereitschaft in den beiden Fallbeispielen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einführung, die die Forschungsfrage und die Fallbeispiele vorstellt; ein Kapitel zur Definition und Funktion von Medien; ein Kapitel zur Krisen- und Katastrophenberichterstattung; ein Kapitel zum deutschen Spendenwesen; und abschließend ein Kapitel mit den Fallbeispielen Elbe-Hochwasser 2002 und Tsunami 2004, wo die Medienberichterstattung und die Spendenbereitschaft analysiert werden.
Wie werden Medien definiert?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Definitionen von „Medien“, unter anderem die Ansätze von Peter Hunziker (primäre, sekundäre, tertiäre Medien) und Marie Luise Kiefer (Medien als Kommunikationskanäle). Es wird die Komplexität des Begriffs und die Schwierigkeit, eine allgemein gültige Definition zu finden, herausgestellt.
Welche Funktionen haben Medien?
Die Arbeit beschreibt die Funktionen von Medien als Kommunikationskanäle, einschließlich politischer Bildung, Meinungsbildung, sozialer Integration und Unterhaltung. Die Rolle der Medien in der Gesellschaft und ihre Auswirkungen auf die öffentliche Meinung werden hervorgehoben.
Wie wird die Krisen- und Katastrophenberichterstattung behandelt?
Das Kapitel zur Krisenberichterstattung beleuchtet die Rolle der Medien als globale Informations- und Meinungsbildner, berücksichtigt aber auch den wirtschaftlichen Aspekt (Wettbewerb um Zuschauerzahlen) und die mögliche Gefahr von Sensationalisierung. Die Notwendigkeit einer ausgewogenen und verantwortungsvollen Berichterstattung wird betont.
Was wird über das deutsche Spendenwesen dargestellt?
Das Kapitel zum Spendenwesen beschreibt die Struktur des deutschen Spendenwesens, unterscheidet zwischen staatlichen und nicht-staatlichen Organisationen und erläutert verschiedene Finanzierungsmodelle. Der Wettbewerb unter den Organisationen und die Bedeutung des DZI-Spendensiegels werden thematisiert, sowie statistische Daten zur durchschnittlichen Spendenhöhe in Deutschland.
Wie werden die Fallbeispiele behandelt?
Die Fallbeispiele Elbe-Hochwasser 2002 und Tsunami 2004 konzentrieren sich auf die Analyse der jeweiligen Medienberichterstattung und deren Einfluss auf die Spendenbereitschaft. Die Ereignisse selbst werden nicht detailliert zusammengefasst, sondern der Fokus liegt auf der Medienwirkung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Medienberichterstattung, Spendenwesen, Katastrophen, Naturkatastrophen, Elbe-Hochwasser 2002, Tsunami 2004, Spendenbereitschaft, Medienwirkung, öffentliche Meinung, Hilfsbereitschaft, soziale Verantwortung, Medienökonomie.
- Arbeit zitieren
- Doreen Sieh (Autor:in), 2009, Der Einfluss der Medienberichterstattung auf das Spendenwesen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136172