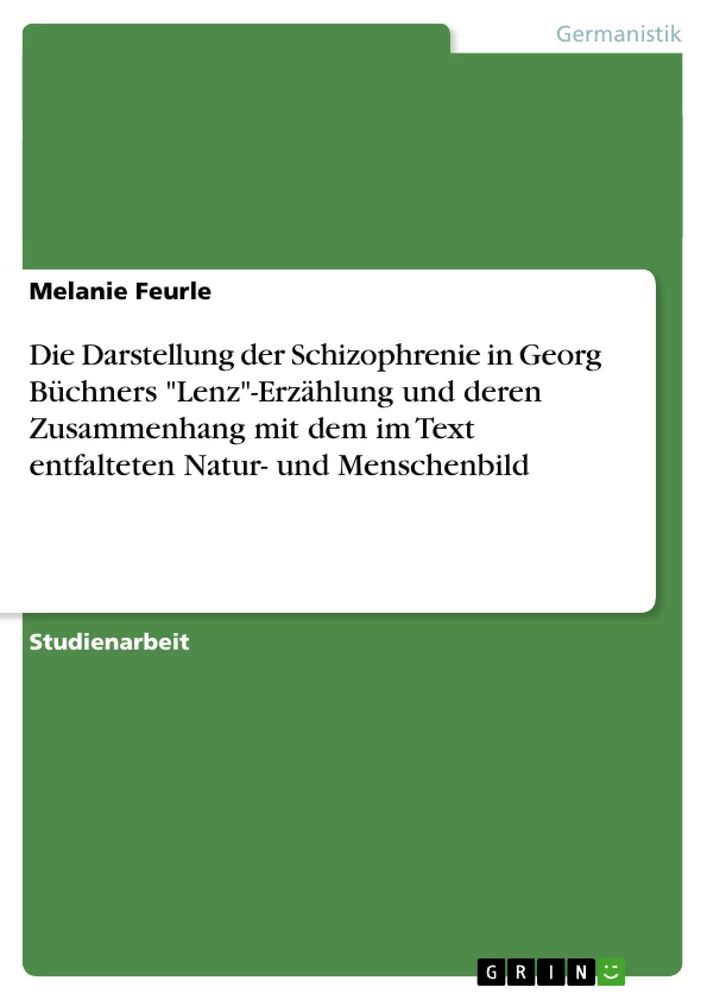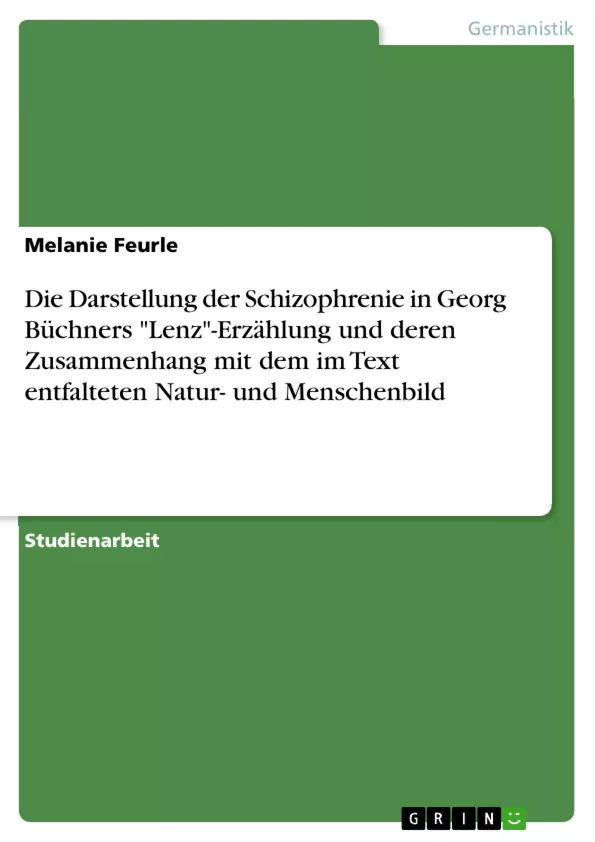In dieser Arbeit werde ich mich nicht etwa einer klinischen Krankheitsdarstellung widmen, sondern vielmehr werde ich versuchen die Zusammenhänge herauszufinden zwischen der Art, wie Büchner Lenzens Krankheit darstellt, und dem im Text entfalteten Menschen- und Naturbild. Weiterhin werde ich versuchen das Neuartige von Büchners Darstellung durch Untersuchung des Stils aufzuzeigen. Selbstverständlich wird ebenfalls zu klären sein, welche Rolle die Sprache im ,,Lenz" spielt, wobei besonders das Kunstgespräch im Mittelpunkt stehen wird.
Grundsätzlich erschwert werden meine Untersuchungen - genau wie die so vieler anderer - von dem Zustand des Unvollendenseins der Erzählung. Es wird also Untersuchungspunkte, bzw. Untersuchungsergebnisse in dieser Arbeit geben, bei denen ich mich an die Meinung der dann angegebenen Sekundärliteratur halten und einen Grad der Vollendung unterstellen werde, der ein entsprechend wahrscheinliches Untersuchungsergebnis erlaubt. Auch wenn es wohl unmöglich ist, festzustellen in wie weit und an welchen Stellen speziell Büchner seinen Text als vollendet oder noch überarbeitungswürdig empfand.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Darstellung Lenzens und die der Nebenpersonen
- 2.1. Lenz:
- 2.2. Oberlin und Kaufmann:
- 2.3. Die Dorfbewohner
- 2.4. Lenzens Mutter und Friederike:
- 3. Leitmotive der Lenz-Erzählung und deren Rolle in der Wahnsinnsdarstellung
- 3.1. Mensch und Natur:
- 3.2. Göttliches
- 4. Die Sprache
- 4.1. Lenzens Sprache
- 4.2. Symbole der Sprache
- 4.2.1. Mond Mutter – Tod.
- 4.2.2. Das Wellenmotiv.
- 4.3. Das Kunstgespräch
- 5. Überschau
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung der Schizophrenie in Georg Büchners „Lenz“ und deren Zusammenhang mit dem Natur- und Menschenbild des Textes. Es wird der Stil Büchners analysiert, um das Neuartige seiner Darstellung aufzuzeigen, und die Rolle der Sprache, insbesondere des Kunstgesprächs, wird beleuchtet. Die Unvollständigkeit der Erzählung stellt eine Herausforderung für die Untersuchung dar.
- Darstellung von Lenzens Krankheit und deren Beziehung zum Natur- und Menschenbild
- Analyse des Stils und der sprachlichen Mittel in Büchners Darstellung
- Rolle der Sprache, insbesondere des Kunstgesprächs, in der Erzählung
- Bedeutung der Nebenfiguren Oberlin und Kaufmann für die Entwicklung und Darstellung von Lenzens Wahnsinn
- Einfluss der Unvollständigkeit des Textes auf die Interpretation
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung skizziert die Forschungsfrage der Arbeit: die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Büchners Darstellung von Lenzens Krankheit und dem im Text entfalteten Menschen- und Naturbild. Sie betont den Fokus auf die stilistische Gestaltung und die Rolle der Sprache, insbesondere des Kunstgesprächs. Die Schwierigkeit der Analyse aufgrund der Unvollständigkeit der Erzählung wird ebenfalls angesprochen. Die Autorin kündigt an, sich bei unklaren Stellen auf Sekundärliteratur zu stützen.
2. Die Darstellung Lenzens und die der Nebenpersonen: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung Lenzens und der Nebenfiguren. Es wird gezeigt, dass Lenz als zentrale Figur die Erzählung dominiert, während seine physische Erscheinung nur in Momenten der Ruhe oder nach wahnhaften Anfällen beschrieben wird. Die Nebenfiguren Oberlin und Kaufmann werden im Detail untersucht, wobei Oberlin als Lenzens letzte Hoffnung und Kaufmann als die Kraft dargestellt wird, die den endgültigen Bruch herbeiführt. Oberlin erhält Innensicht und wörtliche Rede, was seine Bedeutung für Lenz hervorhebt. Im Gegensatz dazu wird Kaufmann, obwohl er das Kunstgespräch mit Lenz führt, in seiner wörtlichen Rede und Bedeutung zurückgestellt. Die Dorfbewohner werden nur kurz erwähnt, mit Fokus auf Lenzens Sicht der individuellen Schönheit jedes Menschen.
Schlüsselwörter
Georg Büchner, Lenz, Schizophrenie, Natur- und Menschenbild, Stil, Sprache, Kunstgespräch, Oberlin, Kaufmann, Wahnsinn, Unvollendetheit, Sekundärliteratur.
Häufig gestellte Fragen zu Georg Büchners "Lenz"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung von Schizophrenie in Georg Büchners „Lenz“ und deren Verbindung zum Natur- und Menschenbild des Textes. Im Fokus stehen Büchners Stil, die Rolle der Sprache (insbesondere des Kunstgesprächs) und die Herausforderungen, die sich aus der Unvollständigkeit der Erzählung ergeben.
Welche Aspekte von "Lenz" werden untersucht?
Die Analyse umfasst die Darstellung Lenzens und der Nebenfiguren (Oberlin, Kaufmann, Dorfbewohner, Lenzens Mutter und Friederike), die Leitmotive (Mensch und Natur, Göttliches), die sprachlichen Mittel (Lenzens Sprache, Symbole wie Mond/Mutter/Tod, das Wellenmotiv, das Kunstgespräch) und den Einfluss der Unvollständigkeit des Textes auf die Interpretation.
Wie wird Lenz in der Arbeit dargestellt?
Lenz ist die zentrale Figur, dessen physische Erscheinung nur in Momenten der Ruhe oder nach wahnhaften Anfällen beschrieben wird. Seine Krankheit und deren Beziehung zum Natur- und Menschenbild stehen im Mittelpunkt der Analyse.
Welche Rolle spielen die Nebenfiguren?
Oberlin wird als Lenzens letzte Hoffnung dargestellt und erhält Innensicht und wörtliche Rede. Kaufmann, obwohl Gesprächspartner im Kunstgespräch, wird in seiner wörtlichen Rede und Bedeutung zurückgestellt und repräsentiert die Kraft, die den endgültigen Bruch herbeiführt. Die Dorfbewohner werden nur kurz erwähnt, mit Fokus auf Lenzens Sicht der individuellen Schönheit jedes Menschen.
Welche Leitmotive werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Leitmotive „Mensch und Natur“ und „Göttliches“ und deren Rolle in der Darstellung von Lenzens Wahnsinn.
Welche Bedeutung hat die Sprache in "Lenz"?
Die sprachlichen Mittel, insbesondere Lenzens Sprache, Symbole (Mond/Mutter/Tod, Wellenmotiv) und das Kunstgespräch, werden analysiert, um das Neuartige von Büchners Darstellung aufzuzeigen.
Wie wirkt sich die Unvollständigkeit des Textes auf die Analyse aus?
Die Unvollständigkeit der Erzählung stellt eine Herausforderung für die Untersuchung dar und wird explizit thematisiert. Die Autorin greift bei unklaren Stellen auf Sekundärliteratur zurück.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Darstellung Lenzens und der Nebenfiguren, ein Kapitel zu den Leitmotiven und deren Rolle in der Wahnsinnsdarstellung, ein Kapitel zur Sprache und eine abschließende Überschau.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Georg Büchner, Lenz, Schizophrenie, Natur- und Menschenbild, Stil, Sprache, Kunstgespräch, Oberlin, Kaufmann, Wahnsinn, Unvollendetheit, Sekundärliteratur.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Büchners Darstellung von Lenzens Krankheit und dem Natur- und Menschenbild des Textes, analysiert den Stil und die sprachlichen Mittel und beleuchtet die Rolle des Kunstgesprächs.
- Quote paper
- Melanie Feurle (Author), 2002, Die Darstellung der Schizophrenie in Georg Büchners "Lenz"-Erzählung und deren Zusammenhang mit dem im Text entfalteten Natur- und Menschenbild, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13651