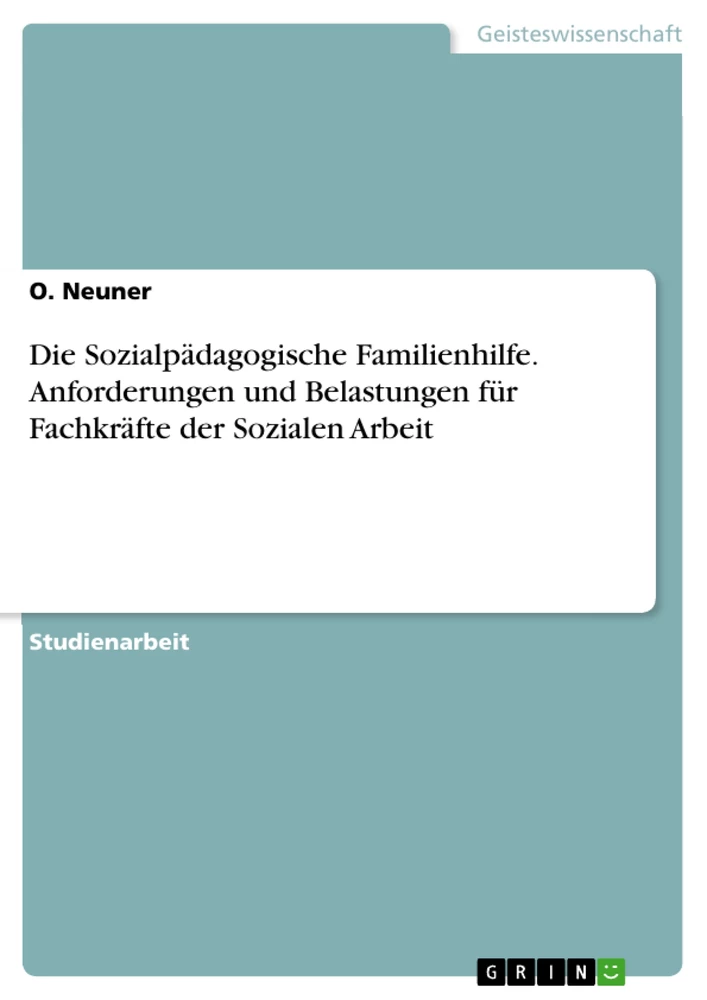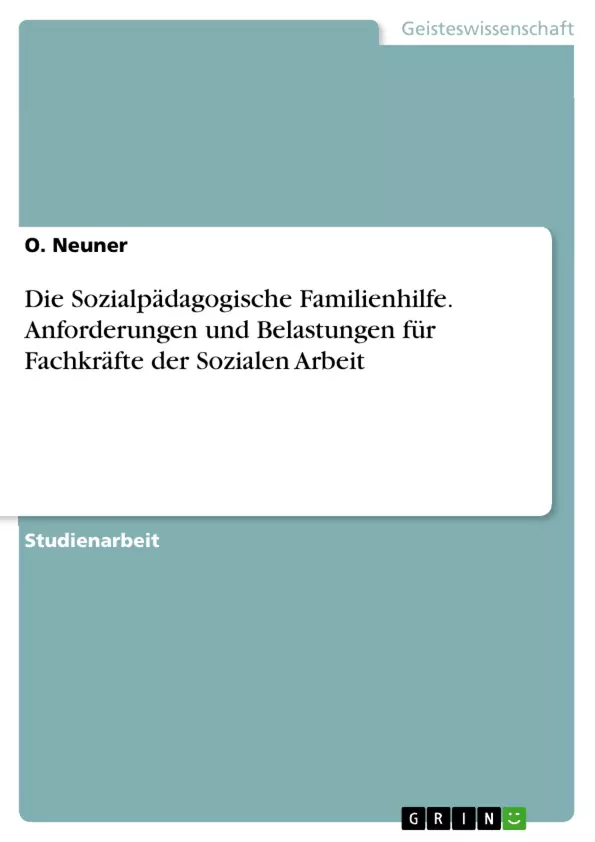Vorliegende Arbeit nähert sich zuerst dem Begriff Familie unter Berücksichtigung heutiger pluralisierter Familien- und Lebensformen. Konsequenterweise werden anschließend familiale Lebensbedingungen beschrieben, die Gründe für sozialpädagogische Interventionen in der Familie sein können. Die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) wird vorgestellt und ihre spezifischen Merkmale als Hilfe zur Erziehung für Familien beleuchtet. Im Zentrum der Betrachtung steht neben der Nennung von Aufgaben und AdressatInnen der SPFH und die Darstellung der rechtlichen Grundlagen, vor allem das Verhältnis von hilfebedürftigen Familien zu öffentlichen und freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe. Im Arbeitsfeld der Sozialpädagogischen FamilienhelferInnen werden Spannungsfelder identifiziert, die für die Fachkräfte der Sozialen Arbeit besondere Anforderungen und Belastungen darstellen und auf den Hilfeprozess der Familien wirken.
Die Fallbeschreibung von "Amelie und Jonathan" ist eine Fiktion, die Lebensumstände der Familie und das Agieren der Kinder- und Jugendhilfe jedoch dagegen nicht. Die Familie zeigt sich hier aufgrund von inneren und äußeren belastenden Umständen in einer schwierigen Lebenssituation, so dass sich die erzieherische Hilfe auf die gesamte Familie richtet und Unterstützung in den verschiedensten Bereichen des alltäglichen Lebens bereithält.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffbestimmungen
- 2.1 Die Familie: Pluralisierte Familien- und Lebensformen heute
- 2.2 Sozialpädagogische Interventionen in der Familie
- 3. Die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)
- 3.1 Aufgaben und Zielgruppe
- 3.2 Rechtliche Grundlagen
- 3.3 Das jugendhilferechtliche Dreiecksverhältnis
- 4. Spannungsfelder im jugendhilferechtlichen Dreiecksverhältnis
- 4.1 Spannungsfeld Sozialpädagogische FamilienhelferIn und Familie
- 4.2 Spannungsfeld Sozialpädagogische FamilienhelferIn und Jugendamt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) im Kontext des jugendhilferechtlichen Dreiecksverhältnisses. Sie beleuchtet die Herausforderungen und Belastungen für Fachkräfte, die aus den Spannungsfeldern zwischen Familie, Jugendamt und FamilienhelferIn resultieren. Die Arbeit analysiert die Bedeutung dieser Spannungsfelder für Hilfsprozesse im Familiensystem.
- Pluralisierte Familienformen und ihre Auswirkungen auf die SPFH
- Rechtliche Grundlagen und Rahmenbedingungen der SPFH
- Spannungsfelder zwischen FamilienhelferIn und Familie
- Spannungsfelder zwischen FamilienhelferIn und Jugendamt
- Anforderungen und Belastungen für Fachkräfte der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung präsentiert den fiktiven Fall von Amelie und Jonathan, um die Herausforderungen der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH) zu veranschaulichen. Sie führt in die Thematik ein und skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich mit dem Begriff der Familie, sozialpädagogischen Interventionen, der SPFH selbst und den daraus resultierenden Spannungsfeldern befasst.
2. Begriffbestimmungen: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Familie“ im Kontext der Pluralisierung heutiger Familienstrukturen. Es diskutiert die Vielfältigkeit an Familienformen und Lebensweisen sowie den subjektiven Charakter der Familiendefinition. Weiterhin werden die Ursachen und Arten sozialpädagogischer Interventionen in Familien erörtert, welche durch exogene (z.B. finanzielle Not) und endogene (z.B. Beziehungs-Konflikte) Faktoren ausgelöst werden können.
3. Die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH): Dieses Kapitel beschreibt die SPFH als eine Leistung der Kinder- und Jugendhilfe, die Familien in schwierigen Lebenssituationen unterstützt. Es erläutert die Aufgaben, Zielgruppen und die rechtlichen Grundlagen der SPFH im SGB VIII. Besonderes Augenmerk liegt auf dem jugendhilferechtlichen Dreiecksverhältnis zwischen Familie, Jugendamt und freiem Träger der SPFH.
4. Spannungsfelder im jugendhilferechtlichen Dreiecksverhältnis: Dieses Kapitel analysiert die Spannungsfelder innerhalb des Dreiecksverhältnisses. Es untersucht die Herausforderungen der Beziehung zwischen FamilienhelferIn und Familie (Balance zwischen Nähe und Distanz, Umgang mit Ambivalenzen) und die Beziehung zwischen FamilienhelferIn und Jugendamt (Auftraggeberrolle des Jugendamtes, Kinderschutz, Kontrollfunktion, Dokumentationspflichten und Leistungsdruck).
Schlüsselwörter
Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH), Jugendhilfe, Dreiecksverhältnis, Familie, Spannungsfelder, Kinderschutz, Rechtliche Grundlagen, Belastungen, Anforderungen, Soziale Arbeit, Hilfeplanung, Ressourcenorientierung, Empowerment.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH)
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) im Kontext des jugendhilferechtlichen Dreiecksverhältnisses zwischen Familie, Jugendamt und FamilienhelferIn. Sie analysiert die Herausforderungen und Belastungen für Fachkräfte, die aus den Spannungsfeldern in diesem Dreiecksverhältnis resultieren, und deren Bedeutung für Hilfsprozesse im Familiensystem.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Pluralisierte Familienformen und ihre Auswirkungen auf die SPFH; Rechtliche Grundlagen und Rahmenbedingungen der SPFH; Spannungsfelder zwischen FamilienhelferIn und Familie; Spannungsfelder zwischen FamilienhelferIn und Jugendamt; Anforderungen und Belastungen für Fachkräfte der Sozialen Arbeit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit besteht aus vier Kapiteln: Einleitung, Begriffsbestimmungen (inkl. Pluralisierung von Familienformen und sozialpädagogischen Interventionen), Die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) mit ihren Aufgaben, Zielgruppen und rechtlichen Grundlagen, und Spannungsfelder im jugendhilferechtlichen Dreiecksverhältnis (zwischen FamilienhelferIn, Familie und Jugendamt).
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung präsentiert einen fiktiven Fall, um die Herausforderungen der SPFH zu veranschaulichen. Sie führt in die Thematik ein und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Was wird unter "Begriffbestimmungen" erläutert?
Dieses Kapitel definiert den Begriff „Familie“ unter Berücksichtigung der Pluralisierung heutiger Familienstrukturen und diskutiert die Vielfältigkeit von Familienformen und Lebensweisen. Es werden auch sozialpädagogische Interventionen in Familien, ihre Ursachen und Arten, erörtert.
Was wird über die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) erklärt?
Dieses Kapitel beschreibt die SPFH als Leistung der Kinder- und Jugendhilfe, erläutert ihre Aufgaben, Zielgruppen und rechtlichen Grundlagen (SGB VIII) und legt besonderes Augenmerk auf das jugendhilferechtliche Dreiecksverhältnis.
Welche Spannungsfelder werden im letzten Kapitel analysiert?
Das letzte Kapitel analysiert die Spannungsfelder zwischen FamilienhelferIn und Familie (Nähe/Distanz, Umgang mit Ambivalenzen) und zwischen FamilienhelferIn und Jugendamt (Auftraggeberrolle, Kinderschutz, Kontrolle, Dokumentation, Leistungsdruck).
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH), Jugendhilfe, Dreiecksverhältnis, Familie, Spannungsfelder, Kinderschutz, Rechtliche Grundlagen, Belastungen, Anforderungen, Soziale Arbeit, Hilfeplanung, Ressourcenorientierung, Empowerment.
- Citar trabajo
- O. Neuner (Autor), 2018, Die Sozialpädagogische Familienhilfe. Anforderungen und Belastungen für Fachkräfte der Sozialen Arbeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1369438