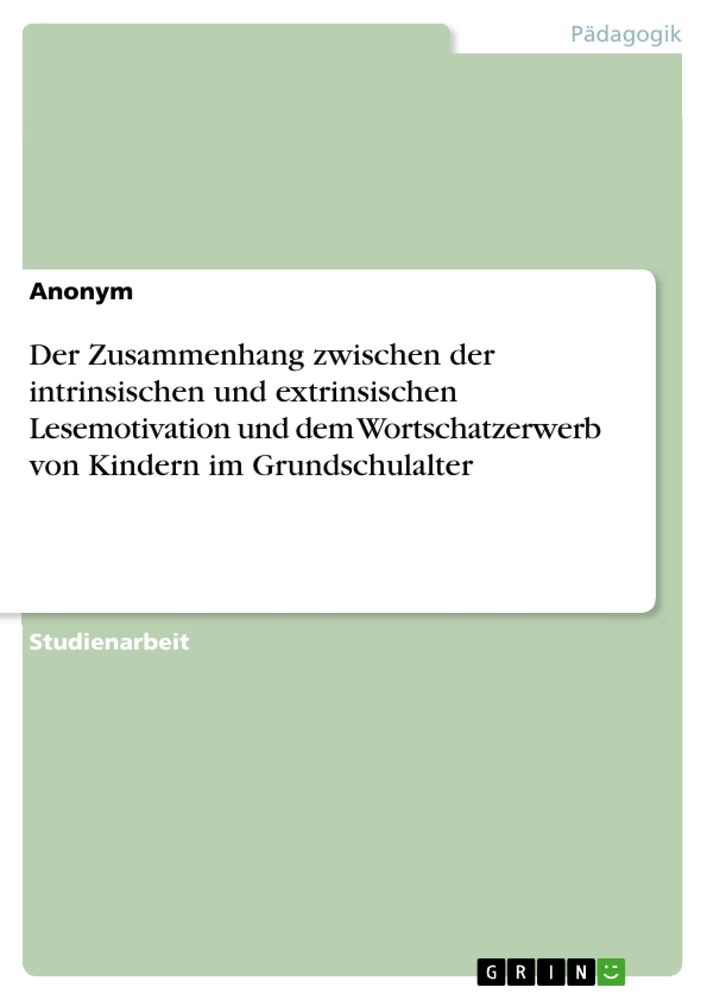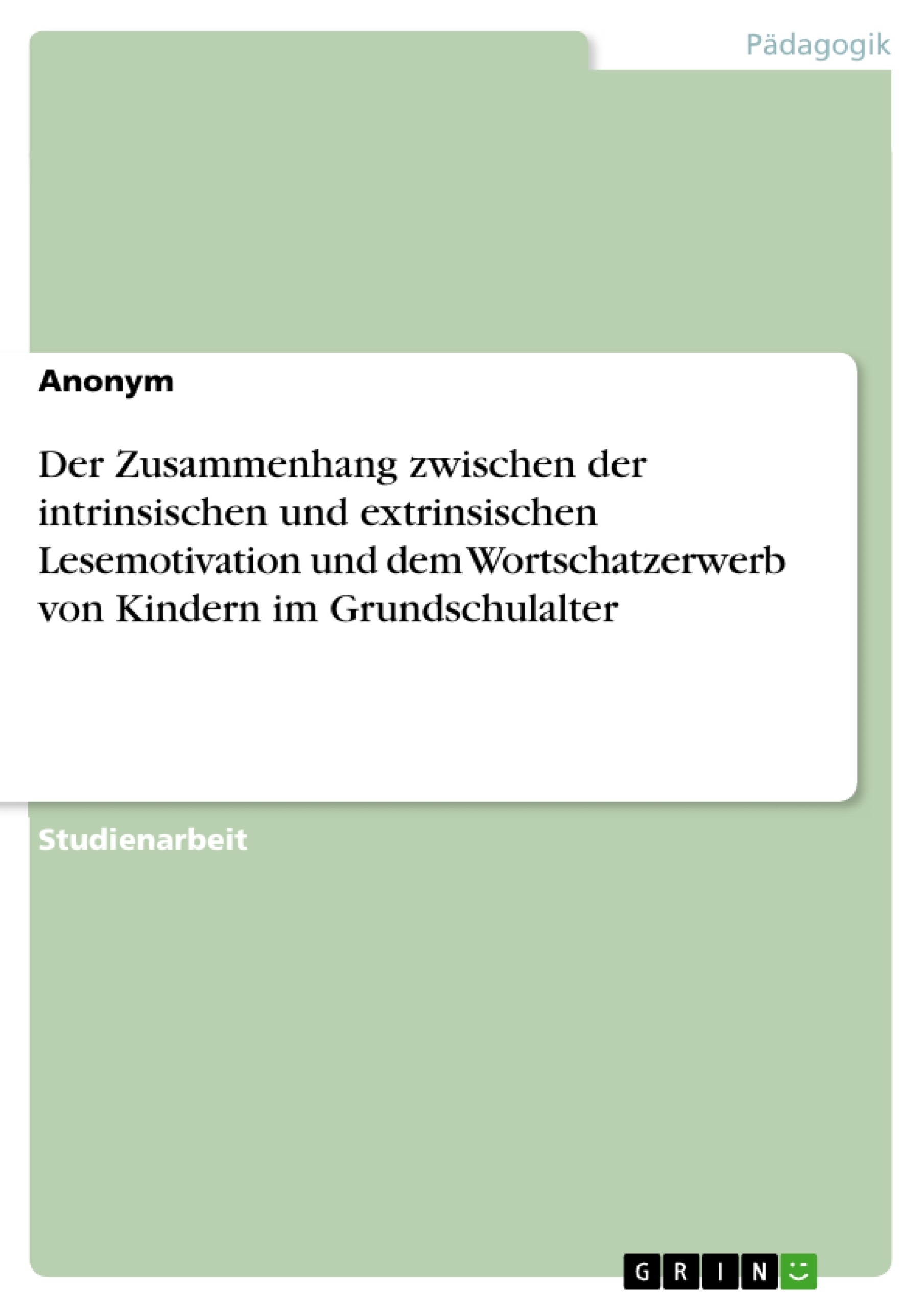In dieser Arbeit soll beleuchtet werden, inwieweit es einen Zusammenhang zwischen der intrinsischen und extrinsischen Lesemotivation und dem Wortschatzerwerb bei Kindern im Grundschulalter gibt. Dazu wird zunächst im ersten Teil der theoretische Hintergrund betrachtet. Hierbei wird auf die Lesemotivation eingegangen. Ausgehend vom Begriff der Motivation soll ein Überblick über die Lesemotivation und im Speziellen auf die Unterschiede zwischen der intrinsischen und der extrinsischen Lesemotivation gegeben werden. Im Detail wird hier auch betrachtet, welchen Stellenwert die Lesekompetenz in Betracht auf die Lesemotivation hat. Der zweite Teil des theoretischen Parts der Arbeit beschäftigt sich näher mit dem Wortschatzerwerb. Dazu wird dieser Teil unterteilt in die Sprachentwicklung im frühkindlichen Alter und anschließend die Sprachentwicklung im Grundschulalter. Hierzu wird der Rahmenlehrplan miteinbezogen.
Der zweite Teil der Arbeit umfasst die Darstellung eigener empirischer Untersuchungsergebnisse. Hierzu werden als Grundlage die Ergebnisse der PIER-Studie (Potsdamer Intrapersonale Entwicklungsrisiken) genutzt. Ziel dieser Studie war es, die Wirkung von verschiedenen Risikofaktoren auf die Entwicklung verschiedener Störungen im Kindes- und Jugendalter darzustellen. Im Detail werden hier die Daten verwendet, welche sich speziell mit der Lesemotivation und dem Wortschatzerwerb befassen.
Im abschließenden Diskussionsteil der Arbeit soll ein Zusammenhang zwischen der zu Beginn gegebenen Theorie und den eigens ermittelten Untersuchungsergebnissen dargestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Lesemotivation
- 2.2 Wortschatzerwerb
- 2.2.1 Sprachentwicklung im frühkindlichen Alter
- 2.2.2 Wortschatz arbeit in der Grundschule
- 2.2.3 Konzeptionen der Wortschatzdidaktik
- 2.3 Zusammenhang Lesemotivation und Wortschatzerwerb
- 3. Empirie
- 3.1 Fragestellungen und Hypothesen
- 3.2 Design und Stichprobe
- 3.3 Erhebungsinstrumente
- 3.4 Ergebnisse
- 4. Diskussion
- 5. Literaturverzeichnis
- 6. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Forschungsbericht untersucht den Zusammenhang zwischen intrinsischer und extrinsischer Lesemotivation und dem Wortschatzerwerb bei Grundschulkindern. Die Arbeit analysiert die Entwicklung der Lesemotivation im Grundschulalter und deren Einfluss auf den Wortschatzerwerb. Es werden empirische Daten herangezogen, um die bestehenden theoretischen Annahmen zu überprüfen und zu erweitern.
- Entwicklung der intrinsischen und extrinsischen Lesemotivation im Grundschulalter
- Zusammenhang zwischen Lesemotivation und Wortschatzerwerb
- Einfluss von Leseleistung auf die Lesemotivation
- Analyse empirischer Daten zur Lesemotivation und zum Wortschatzerwerb
- Vergleich der empirischen Ergebnisse mit bestehenden Theorien
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Lesemotivation und des Wortschatzerwerbs bei Grundschulkindern ein und erläutert die Relevanz des Themas vor dem Hintergrund der verbreiteten Klagen über mangelhafte Lesefähigkeiten deutscher Schüler. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, der die theoretischen Grundlagen, die Darstellung empirischer Ergebnisse und die Diskussion umfasst. Der Fokus liegt auf dem Zusammenhang zwischen intrinsischer und extrinsischer Lesemotivation und dem Wortschatzerwerb.
2. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Lesemotivation und des Wortschatzerwerbs. Es werden verschiedene Aspekte der Lesemotivation, insbesondere der Unterschied zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation, diskutiert. Der Zusammenhang zwischen Lesekompetenz und Lesemotivation wird ebenfalls behandelt. Der Abschnitt zum Wortschatzerwerb umfasst die Sprachentwicklung im frühkindlichen und im Grundschulalter, wobei der Rahmenlehrplan berücksichtigt wird. Das Kapitel legt die theoretische Basis für die empirische Untersuchung.
3. Empirie: Dieses Kapitel beschreibt die empirische Untersuchung, die auf Daten der Potsdamer PIER-Studie basiert. Es werden die Fragestellungen, Hypothesen, das Studiendesign, die Stichprobe und die verwendeten Erhebungsinstrumente detailliert dargestellt. Die Ergebnisse der Untersuchung werden präsentiert, wobei der Schwerpunkt auf dem Zusammenhang zwischen Lesemotivation und Wortschatzerwerb liegt. Die Ergebnisse liefern die Grundlage für die anschließende Diskussion.
Schlüsselwörter
Lesemotivation, intrinsisch, extrinsisch, Wortschatzerwerb, Grundschulalter, Sprachentwicklung, empirische Untersuchung, PIER-Studie, Lesekompetenz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Forschungsbericht: Lesemotivation und Wortschatzerwerb bei Grundschulkindern
Was ist der Gegenstand dieses Forschungsberichts?
Der Forschungsbericht untersucht den Zusammenhang zwischen intrinsischer und extrinsischer Lesemotivation und dem Wortschatzerwerb bei Grundschulkindern. Er analysiert die Entwicklung der Lesemotivation im Grundschulalter und deren Einfluss auf den Wortschatzerwerb, gestützt auf empirische Daten der Potsdamer PIER-Studie.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung intrinsischer und extrinsischer Lesemotivation im Grundschulalter, den Zusammenhang zwischen Lesemotivation und Wortschatzerwerb, den Einfluss der Leseleistung auf die Lesemotivation, die Analyse empirischer Daten und den Vergleich dieser Ergebnisse mit bestehenden Theorien. Die theoretischen Grundlagen umfassen die Lesemotivation (intrinsisch vs. extrinsisch), den Wortschatzerwerb (Sprachentwicklung im Kindes- und Grundschulalter) und den Zusammenhang beider Bereiche.
Welche Kapitel umfasst der Bericht?
Der Bericht gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den theoretischen Grundlagen, ein Kapitel zur empirischen Untersuchung (Methoden, Ergebnisse), eine Diskussion der Ergebnisse und abschließend ein Literatur- und ein Abbildungs-/Tabellenverzeichnis.
Welche Methodik wurde angewendet?
Die empirische Untersuchung basiert auf Daten der Potsdamer PIER-Studie. Der Bericht beschreibt detailliert die Fragestellungen, Hypothesen, das Studiendesign, die Stichprobe und die verwendeten Erhebungsinstrumente. Die Ergebnisse konzentrieren sich auf den Zusammenhang zwischen Lesemotivation und Wortschatzerwerb.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Bericht am besten?
Schlüsselwörter sind: Lesemotivation, intrinsisch, extrinsisch, Wortschatzerwerb, Grundschulalter, Sprachentwicklung, empirische Untersuchung, PIER-Studie, Lesekompetenz.
Welche Zielsetzung verfolgt der Bericht?
Die Zielsetzung ist es, den Zusammenhang zwischen Lesemotivation und Wortschatzerwerb bei Grundschulkindern zu untersuchen und die bestehenden theoretischen Annahmen anhand empirischer Daten zu überprüfen und zu erweitern. Der Bericht trägt zum Verständnis der Faktoren bei, die den Wortschatzerwerb im Grundschulalter beeinflussen.
Wo finde ich die Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Der Bericht enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel: Einleitung (Einführung in die Thematik und den Forschungsaufbau), Theoretische Grundlagen (Lesemotivation, Wortschatzerwerb, deren Zusammenhang), Empirie (Beschreibung der Studie, Ergebnisse) und Diskussion (Interpretation der Ergebnisse im Kontext der Literatur).
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Der Zusammenhang zwischen der intrinsischen und extrinsischen Lesemotivation und dem Wortschatzerwerb von Kindern im Grundschulalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1391748