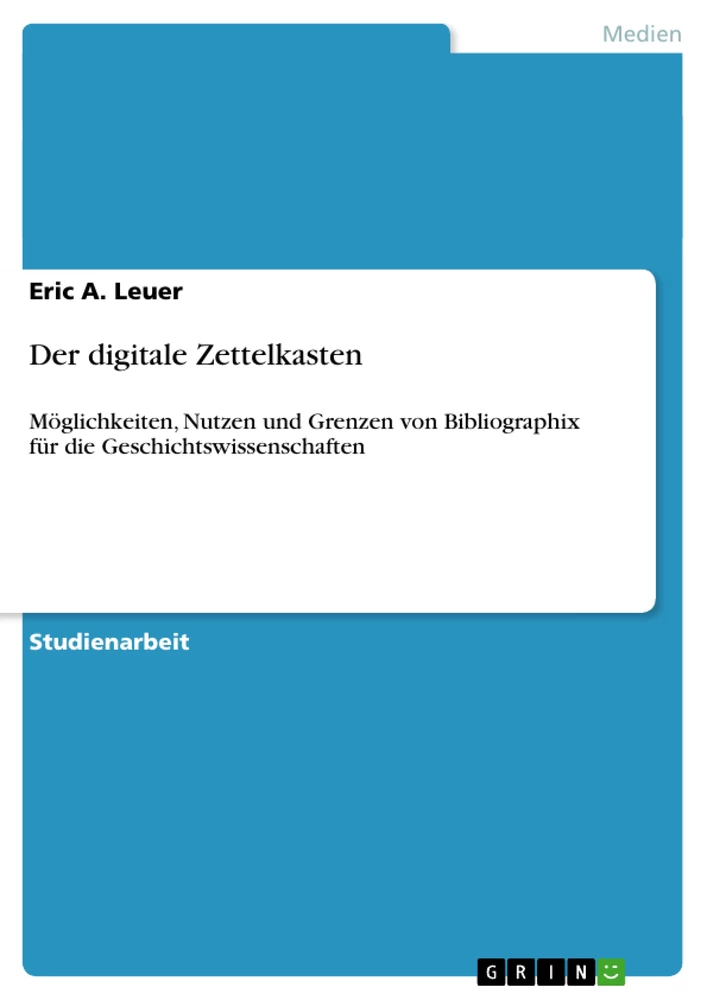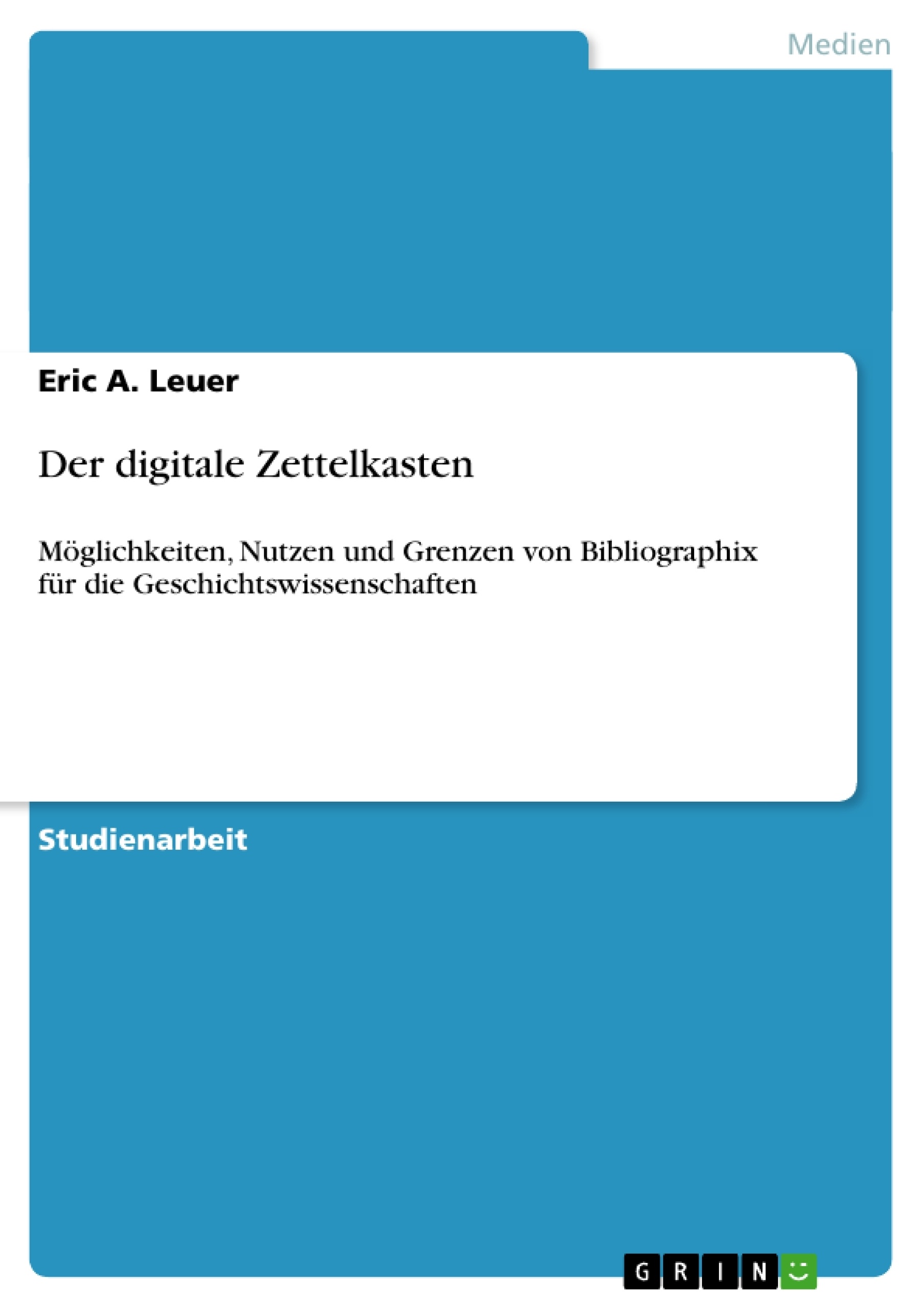Wer im Wintersemester 2002 / 2003 sein Studium der Geschichtswissenschaft an der Universität Bonn begann, machte direkt die Erfahrung mit dem wichtigsten propädeutischem
Handwerkszeug des Historikers, dem Bibliographieren. Im Idealfall nahm das Bibliographieren die Gestalt eines Bibliographie-Bandes an, der jedoch in den seltensten Fällen dem aktuellen Stand
entsprach.
Vielmehr nahm der Vorgang des Bibliographierens die Gestalt eines großen, braunen Holzkastens an dem Zettelkasten, einem mühsam gepflegten Karteikartensystem, dessen Logik sich nur selten in voller Gänze erschloss. Er war nicht nur mühsam zu handhaben, sondern führte bei großem zeitlichem Aufwand, selten zu einem ertragreichen Ergebnis.
Mittlerweile, haben sich die Möglichkeiten eines raschen Bibliographierens mit dem Fortschritt im Bereich der digitalen Medien radikal verändert. Kataloge wie die OPAC – Systeme, der Karlsruher Virtuelle Katalog und das Zentralverzeichnis Antiquarischer Bücher machen es möglich innerhalb weniger Minuten eine Unmenge an vermeintlich passender Literatur zu bibliographieren. Doch diese digitalen Möglichkeiten führen nun zu einem Überschuss an Literatur, die Auswahl der treffenden Bücher wird zur Schwierigkeit, welche Literatur ist brauchbar, welche nur durch falsche Einpflegung in das Ergebnis gerutscht und welche vollends unbrauchbar?
Es stellt sich also ausgehend vom Beispiel des Bibliographierens die Frage, inwieweit die Möglichkeiten der digitalen Medien ein Fluch oder ein Segen sind. Abhilfe in diesem Dilemma sollen so genannte Bibliographiertools geben, Literaturverwaltungsprogramme, die für den Nutzer mitdenken und ihm ein gros an Arbeit ersparen oder ihm diese zumindest erleichtern.
Aber auch hier stellen sich wieder Fragen. Sind solche Programme nutzerfreundlich und leicht zu bedienen? Werden alle Anwendungen solcher Programme auch vernünftig vermittelt, so dass der
Nutzer sie umfassend ausschöpfen kann? Wie und unter welchen Kriterien arbeiten diese Programme und was können sie überhaupt leisten?
Diese Frage soll hier auf das Programm Bibliographix 7.0 bezogen werden, einem Literaturverwaltungsprogramm, dessen Auswahl zufällig geschah, um so das Verhalten eines Nutzers nachvollziehen zu können, der sich eben ganz subjektiv für ein Produkt entscheidet.
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
II. Entwicklung und Aufbau
III. Was kann Bibliographix?
Dateneingabe
Ideen- und Wissensverwaltung
Recherche, Referenzen und Import von Daten
Erstellen von Bibliographien und Zitationen
IV. Ergebnis
V. Perspektiven und Erwartungen von Bibliographiertools
VI. Literatur
I. Einleitung
Als ich mein Studium der Geschichtswissenschaft im Wintersemester 2002 / 2003 an der Universität Bonn begann, machte ich direkt die Erfahrung mit dem wichtigsten propädeutischem Handwerkszeug des Historikers, dem Bibliographieren. Im Idealfall nahm das Bibliographieren die Gestalt eines Bibliographie-Bandes an, der jedoch in den seltensten Fällen, dem aktuellen Stand entsprach. Vielmehr nahm der Vorgang des Bibliographierens die Gestalt eines großen, braunen Holzkastens an, dem Zettelkasten, einem mühsam gepflegten Karteikartensystem, dessen Logik sich nur selten in voller Gänze erschloss. Er war nicht nur mühsam zu handhaben, sondern führte bei großem zeitlichem Aufwand, selten zu einem ertragreichen Ergebnis.
Mittlerweile, haben sich die Möglichkeiten eines raschen Bibliographierens mit dem Fortschritt im Bereich der digitalen Medien radikal verändert. Kataloge wie die OPAC - Systeme, der Karlsruher Virtuelle Katalog und das Zentralverzeichnis Antiquarischer Bücher machen es möglich innerhalb weniger Minuten eine Unmenge an vermeintlich passender Literatur zu bibliographieren. Doch diese digitalen Möglichkeiten führen nun zu einem Überschuss an Literatur, die Auswahl der treffenden Bücher wird zur Schwierigkeit, welche Literatur ist brauchbar, welche nur durch falsche Einpflegung in das Ergebnis gerutscht und welche vollends unbrauchbar?
Es stellt sich also ausgehend vom Beispiel des Bibliographierens die Frage inwieweit die Möglichkeiten der digitalen Medien ein Fluch oder Segen sind. Abhilfe in diesem Dilemma sollen so genannte Bibliographiertools geben, Literaturverwaltungsprogramme, die für den Nutzer mitdenken und ihm ein gros an Arbeit ersparen oder ihm diese zumindest erleichtern. Aber auch hier stellen sich wieder Fragen. Sind solche Programme Nutzerfreundlich und leicht zu bedienen? Werden alle Anwendungen solcher Programme auch vernünftig vermittelt, so dass der Nutzer sie umfassend ausschöpfen kann? Wie und unter welchen Kriterien arbeiten diese Programme und was können sie überhaupt leisten?
Diese Frage soll hier auf das Programm Bibliographix 7.0 bezogen werden, einem Literaturverwaltungsprogramm, dessen Auswahl zufällig geschah, um so das Verhalten eines Nutzers nachvollziehen zu können, der sich eben ganz subjektiv für ein Produkt entscheidet.
II. Entwicklung und Aufbau
Bibliographix wurde 1991 von Olaf Winkelhakel und Markus Schäfer geboren. Beide griffen im Rahmen ihrer Promotion die Idee des Zettelkastens auf und wollten ihn optimieren. Auch sie sahen die Probleme des “herkömmlichen” Zettelkastens und hielten ihn für größere wissenschaftliche Arbeiten als vollkommen unbrauchbar. Der “kontinuierliche Publikationsfluss” fehlte ihnen. Beide sahen den Punkt der Literaturverwaltung jedoch als Teil des gesamten Prozesses des Schreibens wissenschaftlicher Texte und waren der Meinung, dass eine Literaturverwaltung als Bestandteil diesen Prozesses in ihn eingefügt sein müsse.
Als Beginn des Prozesses nennen Winkelhakel und Schäfer die Entwicklung einer Idee, weshalb sie einen so genannten Ideenmanager in das Programm einbauten. Dies wollten sie deshalb um einerseits Literatur und eigene Ideen unmittelbar in ein und demselben Programm verknüpfen zu können. Außerdem versuchten sie eine Kreativitätssoftware mit einzubringen, welche die positiven Eigenschaften von Mindmaps und Outline-Software vereint. In der „schwammigen“ Phase eines Projekts solle somit die Idee noch nicht zu früh strukturiert werden, sondern erst dann wenn sie „reif“ dazu sei.
Schließlich griffen sie auf den Aspekt der Onlinevernetzung zurück und bauten ein Bibliotheksmodul in ihr Programm ein. Somit versuchen Winkelhakel und Schäfer, stets den aktuellen Stand der Forschung mittels Vernetzung zu den Bibliotheken zu garantieren und diesen aktuellen Forschungsstand direkt in Bibliographix und somit das Forschungsprojekt des Nutzers zu importieren.
Auch die Zitierrichtlinien sind weitläufig durchdacht. 250 Richtlinien sind bereits vordefiniert, diese können darüber hinaus verändert oder neu erstellt werden.
Als Systemvoraussetzungen bauten sie das landläufig benutzte Microsoft Windows 2000 / XP / Vista. Dies schließt zwar die Nutzung mit Apple Computern aus, mittels der Windows-Emulatoren Win4Lin und WINE ist Bibliographix jedoch auch für Linux und somit auch Apple nutzbar. Der benötigte Speicherplatz ist mit mindestens 16 MB nicht gering, für ein Programm des entsprechenden Umfangs jedoch passend und auch nicht problematisch für jeden vernünftig gewarteten Rechner.
[...]
- Arbeit zitieren
- Cand. phil. Eric A. Leuer (Autor:in), 2009, Der digitale Zettelkasten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/139199