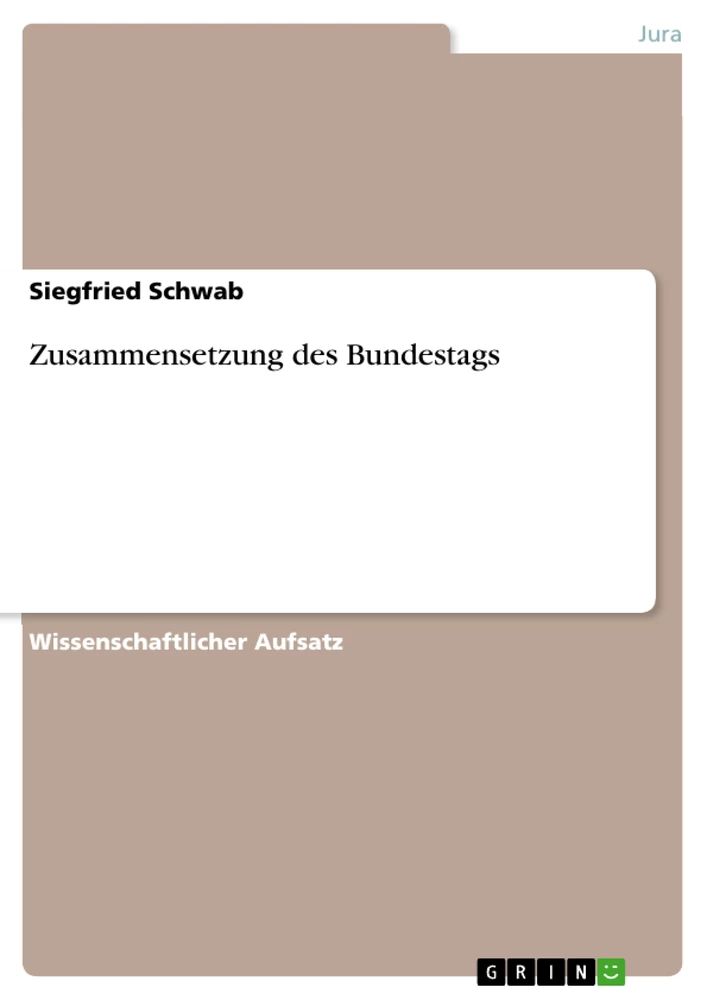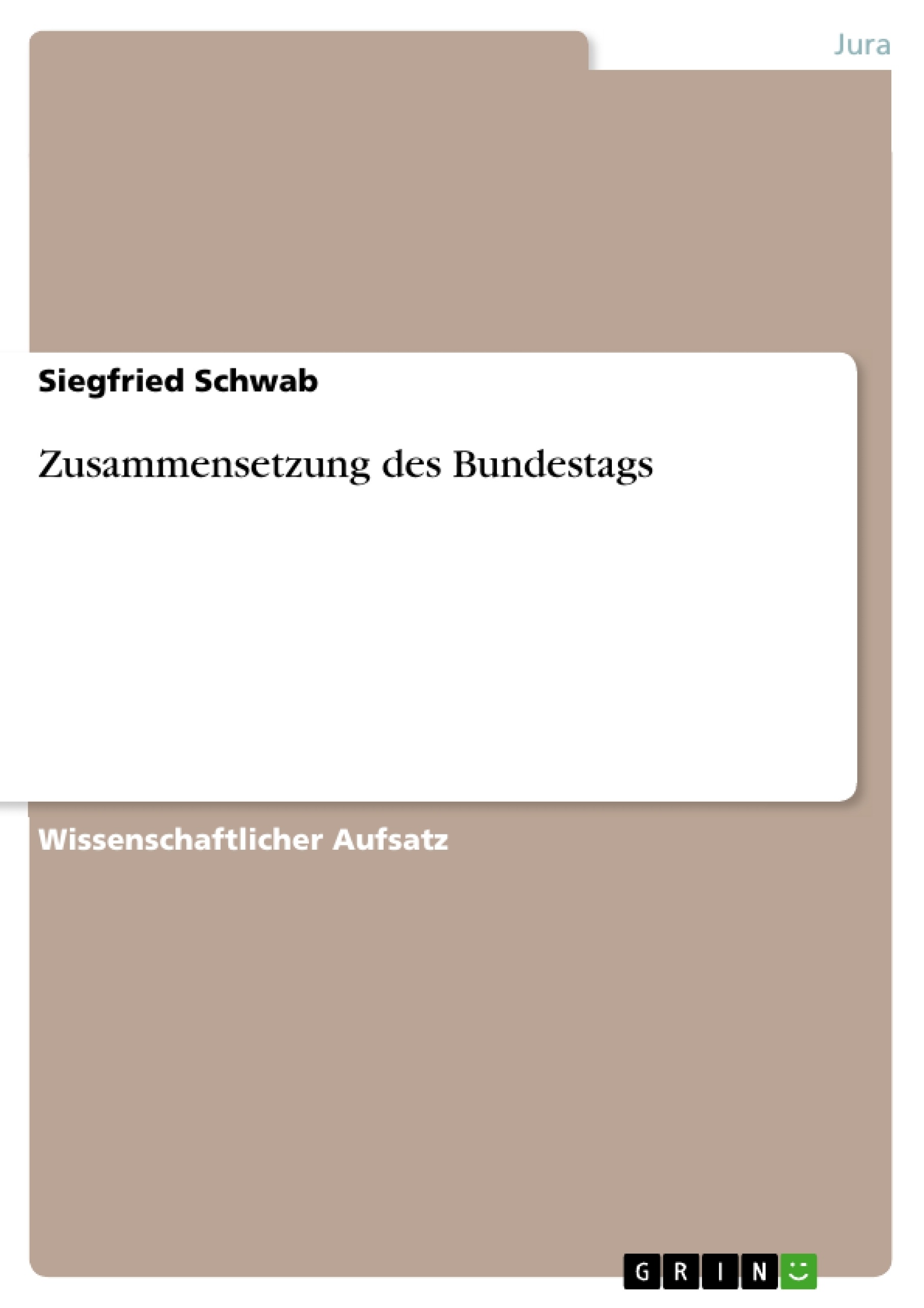Der Bundesgesetzgeber ist bei der Wahl zum Bundestag als dem Verfassungsorgan des Bundes nicht verpflichtet, föderative Gesichtspunkte zu berücksichtigen. § 7 Abs. 3 S. 2 i. V. mit § 6 Abs. 4 und 5 des Bundeswahlgesetzes verletzt die Grundsätze der Gleichheit und der Unmittelbarkeit der Wahl, soweit hierdurch ermöglicht wird, dass ein Zuwachs an Zweitstimmen zu einem Verlust an Sitzen der Landeslisten oder ein Verlust an Zweitstimmen zu einem Zuwachs an Sitzen der Landeslisten führen kann. Das Bundesverfassungsgericht bleibt grundsätzlich auch nach der Auflösung eines Bundestages oder dem regulären Ablauf einer Wahlperiode befugt, die im Rahmen einer zulässigen Wahlprüfungsbeschwerde erhobenen Rügen der Verfassungswidrigkeit von Wahlrechtsnormen und wichtige wahlrechtliche Zweifelsfragen zu prüfen.
Zusammensetzung des Bundestags[1] *
Der Bundesgesetzgeber ist bei der Wahl zum Bundestag als dem Verfas-sungsorgan des Bundes nicht verpflichtet, föderative Gesichtspunkte zu berücksichtigen.[2]
Der Beschwerdeführer erhob mit Schreiben vom 17. November 2002 beim Deutschen Bundestag Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl zum 15. Deutschen Bundestag am 22. September 2002.
Zur Begründung machte er geltend, das Zuteilungsverfahren nach Quoten mit Restausgleich nach größten Bruchteilen gemäß § 6 Abs. 2 Satz 4 BWG (Hare/Niemeyer-Verfahren) verletze den Grundsatz der Gleichheit der Wahl. Die Ausgestaltung des „Zwei-Stimmen-Verfahrens" gemäß § 6 BWG verstoße gegen die Grundsätze der Gleichheit und Unmittelbarkeit der Wahl, soweit ein doppelter Stimmerfolg nicht stets ausgeschlossen werde. Zu einem doppelten Stimmerfolg könne es in bestimmten Konstellationen durch ein „Splitten" von Erst- und Zweitstimmen kommen. Insbesondere die auf der Grundlage von § 6 Abs. 1 Satz 1 BWG vorgenommene Berücksichtigung der Zweitstimmen von Wählern, die in zwei Berliner Wahlkreisen mit ihrer Erststimme der jeweiligen Wahlkreiskandidatin der Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS) zu einem Mandat verholfen, mit ihrer Zweitstimme jedoch für eine andere Landesliste gestimmt haben (so genannte Berliner Zweitstimmen), habe den Stimmen dieser Wähler ein doppeltes Stimmgewicht verliehen. Die in § 7 BWG geregelte Möglichkeit der Verbindung von Landeslisten verletze den Grundsatz der Unmittelbarkeit der Wahl, weil für den Wähler die Wirkung seiner Stimmabgabe nicht hinreichend erkennbar sei. Gleiches gelte für das Verfahren zur bundesweiten Ermittlung des Proporzes gemäß § 6 BWG (so genannte Oberverteilung) in Verbindung mit dem Prinzip der Landeslisten. Dieses gewährleiste auch nicht, dass die einzelnen Länder – wie es ein föderales System verlange – proportional zu ihrer Bevölkerungszahl im Deutschen Bundestag vertreten seien. Werde ein Direktmandat gemäß § 6 Abs. 4 Satz 1 BWG auf die nach der Landesliste[3] seiner Partei zu vergebenden Mandate angerechnet, obwohl der erfolgreiche Wahlkreiskandidat auf der Landesliste nicht kandidiert habe und daher mit der Zweitstimme nicht habe gewählt werden können, werde ebenfalls gegen den Grundsatz der Unmittelbarkeit der Wahl verstoßen. Schließlich seien der Grundsatz des gleichen passiven Wahlrechts und die Chancengleichheit von Einzelbewerbern dadurch verletzt, dass im Falle ihres Erfolgs die von ihren Wählern abgegebenen Zweitstimmen gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 BWG ‑ anders als bei Wahlkreiskandidaten einer Landesliste ‑ nicht gewertet würden.
Das Bundesverfassungsgericht[4] bleibt grundsätzlich auch nach der Auflösung eines Bundestages oder dem regulären Ablauf einer Wahlperiode befugt, die im Rahmen einer zulässigen Wahlprüfungsbeschwerde erhobenen Rügen der Verfassungs-widrigkeit von Wahlrechtsnormen und wichtige wahlrechtliche Zweifelsfragen zu prüfen.
Ob eine Wahlprüfungsbeschwerde eingelegt wird, obliegt der freien Entscheidung jedes Beschwerdeberechtigten. Das Bundesverfassungsgericht kann nicht von Amts wegen tätig werden. Die Wahlprüfungsbeschwerde hat demgemäß eine Anstoßfunktion. Über den weiteren Verlauf des überwiegend objektiven Verfahrens[5] entscheidet jedoch das Bundesverfassungsgericht. Insoweit kommt es auf das öffentliche Interesse an.[6]
[...]
* Mit vertiefenden Anmerkungen von Prof. Dr. Dr. Siegfried Schwab, Mag. rer. publ. unter Mitarbeit von Diplom – Betriebswirtin (DH) Silke Schwab.
[1] BVerfG, Beschluss vom 18.02.2009 - 2 BvC 9/04, BeckRS 2009 32483
[2] Meyer, Hans (1987), § 38 Wahlgrundsätze und Wahlverfahren, in: Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland - Band II: Demokratische Willensbildung - Die Staatsorgane des Bundes, hrsg. von Josef Isensee und Paul Kirchhof, S. 269-311.Nohlen, Dieter (2000), Wahlrecht und Parteiensystem, S. 304-331.
[3] § 7 Abs. 3 S. 2 i. V. mit § 6 Abs. 4 und 5 des Bundeswahlgesetzes verletzt die Grundsätze der Gleichheit und der Unmittelbarkeit der Wahl, soweit hierdurch ermöglicht wird, dass ein Zuwachs an Zweitstimmen zu einem Verlust an Sitzen der Landeslisten oder ein Verlust an Zweitstimmen zu einem Zuwachs an Sitzen der Landeslisten führen kann, BVerfG, Urteil vom 3. 7. 2008 - 2 BvC 1/07 u. a., NVwZ 2008, 991ff. Roth, Negatives Stimmgewicht und Legitimationsdefizite des Parlaments, NVwZ 2008, 1199 - unter dem Schlagwort negatives Stimmgewicht firmiert ein Phänomen, das auf der Grundlage des geltenden Bundestagswahlrechts auftreten kann, wenn zu Gunsten einer Partei Überhangmandate anfallen (ob und inwieweit ausgleichslose Überhangmandate überhaupt verfassungsrechtlich hingenommen werden können, ist höchst streitig, vgl. BVerfGE 95, 335 [348ff. u. 367ff.] = NJW 1997, 1553 = NVwZ 1997, 781 L; zusammenfassend . Roth in: Umbach/Clemens, GG, Mitarbeiterkommentar [MitKomm-GG], Stand: 2002, Art. 38 RN 98ff. Dann kann es dazu kommen, dass ein Zugewinn von Zweitstimmen einer Partei einen Mandatsverlust bei gerade dieser Partei bewirkt und umgekehrt die Verringerung der Anzahl der Zweitstimmen einen Mandatsgewinn. Dass ein Wahlrecht, das solche absurden Wirkungen zulässt, zumindest gegen den Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit (Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG) und das Demokratieprinzip verstößt, BVerfG, NVwZ 2008, 991 (994), liegt auf der Hand. Zur Novellierung des Wahlrechts zum Deutschen Bundestag vgl. Schreiber, NVwZ 2002, 1; zu wahlrechtlichen Auffälligkeiten der Bundestagswahl 2002 s. Schreiber, NVwZ 2003, 402; zur Bundestagswahl 2005 s. König, DÖV 2006, 417. Pukelsheim, Erfolgswertgleichheit der Wählerstimmen zwischen Anspruch und Wirklichkeit, DÖV 2004, 405. Parteienstreit um Überhangmandate wird hitziger - Die Debatte um eine Regierungsmehrheit nur auf Basis von Überhangmandaten spielt eine immer größere Rolle im Wahlkampf. Die SPD sagte in Richtung Union und FDP, eine mögliche schwarz-gelbe Koalitionsmehrheit nur mit Hilfe dieser Mandate sei illegitim. In einem am 21.09.2009 vom SPD-Präsidium verabschiedeten Wahlaufruf heißt es, spätestens mit der notwendigen Verabschiedung eines neuen Wahlrechtes 2010 würde sich eine solche Koalition von CDU/CSU und FDP «eigenhändig delegitimieren». Grünen-Spitzenkandidat Jürgen Trittin warf Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor, sie wolle mit einer «ergaunerten Mehrheit» von Überhangmandaten weiterregieren.
Westerwelle: «Mehrheit ist Mehrheit»
FDP-Parteichef Guido Westerwelle wertete die von Sozialdemokraten und Grünen neu entfachte Debatte um das vom Bundesverfassungsgericht beanstandete Wahlrecht allerdings als Eingeständnis einer erwarteten Wahlniederlage. Er rechne am Wahlsonntag mit einer «sehr klaren Mehrheit» für Schwarz-Gelb. Der «theoretische Fall» einer Koalition nur dank Überhangmandaten werde nicht eintreten. Westerwelle erinnerte daran, die FDP habe unmittelbar nach dem Urteil des Verfassungsgerichts im Juli 2008 zu den Überhangmandaten Gespräche über eine Neuregelung des Wahlrechts angeboten. Die SPD habe sich verweigert. Jetzt gelte: «Mehrheit ist Mehrheit.»
Pofalla: «Stil eines schlechten Verlierers»
Auch CDU-Generalsekretär Ronald Pofalla wies die Vorwürfe von SPD und Grünen zurück. «Diese Debatte kann nur jemand vorgeben, der die Wahlen schon verloren gegeben hat», sagte er in Berlin. Dies sei der «Stil eines schlechten Verlierers». Die SPD habe bei den Wahlen zwischen 1998 und 2005 bis zu 13 Überhangmandate mehr als die Union erzielt. Dies sei damals von der SPD nicht in Frage gestellt worden.
Wahlrechtsvorstoß der Grünen zu Überhangmandaten gescheitert
Union, FDP sowie ein Teil der SPD-Fraktion haben am 03.07.2009 den Vorstoß der Grünen zur Änderung des Wahlrechts noch vor der Bundestagswahl abgelehnt. In namentlicher Abstimmung votierten 391 Abgeordnete mit «Nein». 97 stimmten mit «Ja», fünf enthielten sich. Abgegeben wurden 493 Stimmen
[4] Das Verfahren vor dem Deutschen Bundestag, bei dem in ständiger Praxis die Verfassungsmäßigkeit von Wahlrechtsnormen nicht geprüft wird, sondern einer Prüfung durch das BVerfG vorbehalten bleibt, begründet keinen Wahlfehler, vgl. BVerfGE 89, 291 [300] = NJW 1994, 927. Eine Pflicht des Deutschen Bundestages zur Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit von Normen im Wahleinspruchsverfahren besteht nicht. Zwar ist der Deutsche Bundestag, wie der Bf. zu Recht vorträgt, gem. Art. 20 Abs. 3 GG an die Verfassung gebunden. Hieraus kann jedoch keine Pflicht abgeleitet werden, die Verfassungsmäßigkeit der angegriffenen Bestimmungen des Bundeswahlgesetzes zu prüfen. Das Grundgesetz selbst, das dem Deutschen Bundestag die Aufgabe der Wahlprüfung zuweist Art. 41 Abs. 1 S. 1 GG, sieht dabei die Möglichkeit einer Vorlage an das BVerfG im Verfahren der konkreten Normenkontrolle Art. 100 Abs. 1 GG nicht vor. Dem Deutschen Bundestag fehlt bereits die Vorlageberechtigung. Gemäß Art. 100 Abs. 1 S. 1 GG kann nur ein Gericht anlässlich einer konkreten Entscheidung zum BVerfG vorlegen. Der Deutsche Bundestag ist kein Gericht; gleiches gilt für den Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung, der die Beschlüsse des Deutschen Bundestages im Einspruchsverfahren gegen die Bundestagswahl vorbereitet. Eine analoge Anwendung des Art. 100 Abs. 1 GG kommt nicht in Betracht. Hiergegen spricht bereits die enumerative Aufzählung der Zuständigkeiten des BVerfG im Grundgesetz und in anderen Bundesgesetzen vgl. Art. 93 Abs. 3 GG. Ebenso fehlt es an der Vergleichbarkeit der Ausgangslage; denn der Bundestag wird - anders als Gerichte - in eigener Sache tätig, vgl. Klein, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 41 RN 73; Morlok, in: Dreier, GG II, 2. Aufl. [2006], Art. 41 RN 16; Meyer, HdbStaatsR III, 3. Aufl. [2005], § 46 RN 94. Auch eine Pflicht des Deutschen Bundestages, ein Verfahren der abstrakten Normenkontrolle beim BVerfG zur Überprüfung der Verfassungskonformität von Normen des Bundeswahlgesetzes oder der Bundeswahlordnung einzuleiten, besteht nicht.
[5] Vgl. BVerfGE 34, 81 <97>.
[6] Vgl. BVerfGE 89, 291 <299>.
Häufig gestellte Fragen zur Zusammensetzung des Bundestags
Was versteht man unter dem "negativen Stimmgewicht"?
Dies ist ein Phänomen im Wahlrecht, bei dem ein Zuwachs an Zweitstimmen paradoxerweise zu einem Verlust an Sitzen führen kann (oder umgekehrt), was das Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig eingestuft hat.
Muss der Gesetzgeber föderale Aspekte bei der Bundestagswahl berücksichtigen?
Nein, laut Bundesverfassungsgericht ist der Gesetzgeber nicht verpflichtet, föderative Gesichtspunkte bei der Wahl zum Verfassungsorgan des Bundes zwingend zu berücksichtigen.
Was ist das Hare/Niemeyer-Verfahren?
Es handelt sich um ein Zuteilungsverfahren nach Quoten mit Restausgleich nach größten Bruchteilen, das zur Berechnung der Sitzverteilung genutzt wurde.
Darf der Bundestag die Verfassungsmäßigkeit von Wahlrechtsnormen selbst prüfen?
Der Bundestag hat keine Pflicht zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit im Wahleinspruchsverfahren; diese Prüfung ist dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten.
Was passiert bei einem "Splitten" von Erst- und Zweitstimmen?
Stimmensplitting kann in bestimmten Konstellationen zu einem doppelten Stimmerfolg führen, was die Grundsätze der Gleichheit der Wahl berühren kann.
- Citation du texte
- Prof. Dr. Dr. Assessor jur., Mag. rer. publ. Siegfried Schwab (Auteur), 2009, Zusammensetzung des Bundestags, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/139345