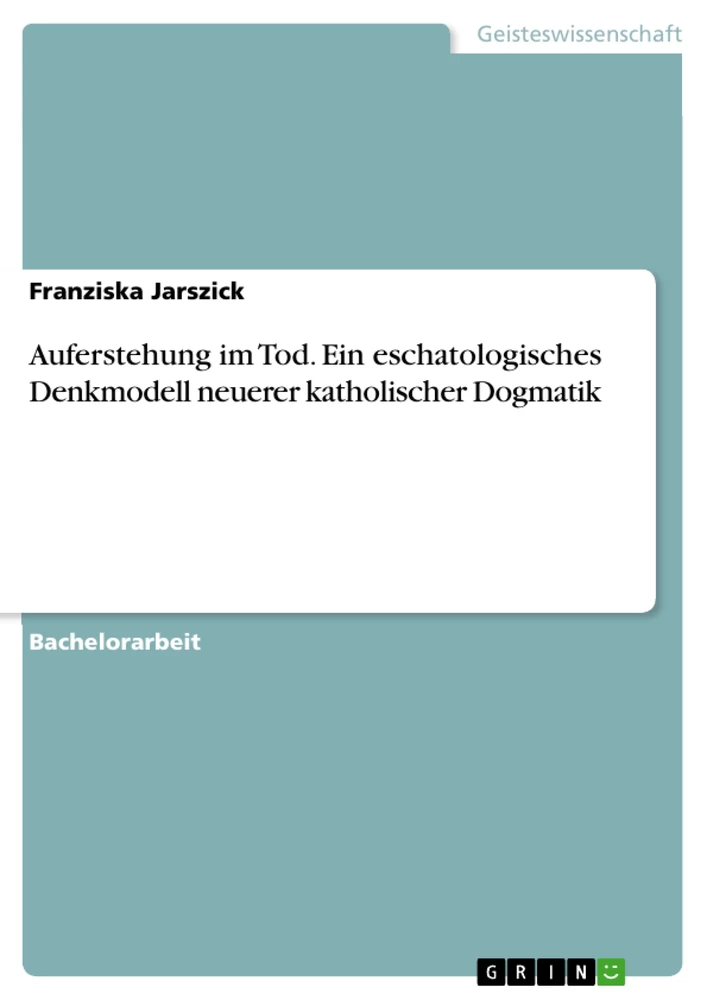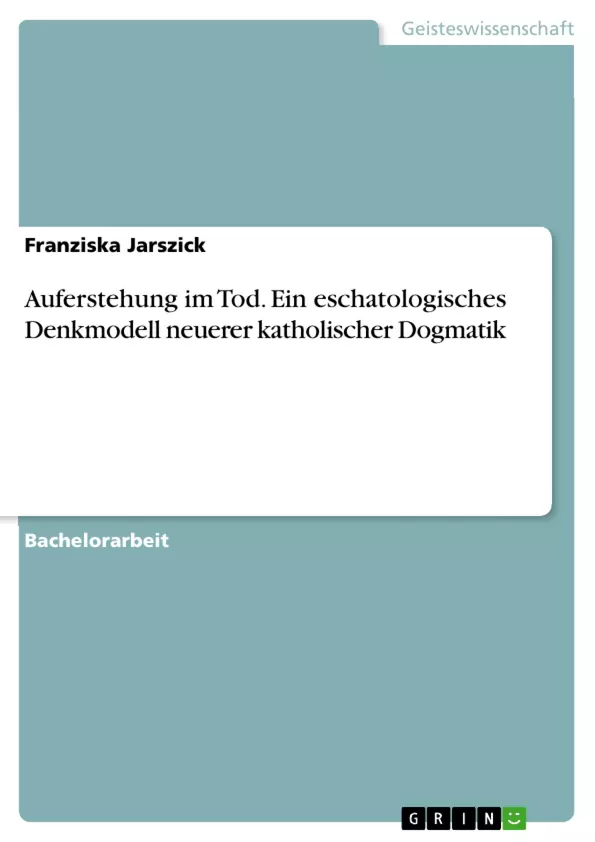Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung des christlichen Todes- und Auferstehungsverständnisses, wobei der Fokus insbesondere auf der Konzeption „Auferstehung im Tod“ liegt.
Im Rahmen der Arbeit ist es wichtig, die theologie- und dogmengeschichtliche Entwicklung des christlichen Auferstehungsglaubens inhaltlich zu beleuchten, da sich ebenjener Auferstehungsglaube sowie die damit verbundene Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod stets im Wandel befunden haben. Aufgrund zahlreicher Modifikationen gibt es folglich nicht das eine Denkmodell einer Auferstehung. Um jedoch im Rahmen der Schwerpunktsetzung auf das durch Gisbert Greshake geprägte zeitgenössische Denkmodell der „Auferstehung im Tod“ eingehen zu können, ist es unerlässlich, die vorherigen Traditionsströme sowie daraus resultierende Entwicklungen inhaltlich zu beleuchten, um den Weg bis in die katholische Dogmatik der Gegenwart nachvollziehen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Auferstehung der Toten als Hoffnung über den Tod hinaus
- Grundbegriffe einer biblischen Anthropologie als Ausdruck der Ganzheitlichkeit des Menschen
- Das Menschenbild des Alten Testamentes unter besonderer Berücksichtigung anthropologischer Grundtermini
- Das neutestamentliche Menschenbild unter besonderer Berücksichtigung anthropologischer Grundbegriffe
- Tod und Auferstehung aus biblischer Perspektive
- Tod und Auferstehung nach dem Alten Testament
- Das Verständnis des Todes als Hinabsteigen in die Scheol
- Vom Scheolglauben zur Auferstehungshoffnung
- Tod und Auferstehung nach dem Neuen Testament
- Das biblische Todesverständnis vor dem Hintergrund des Christusereignisses
- Der Glaube an die Auferstehung der Toten aus neutestamentlicher Sicht
- Tod und Auferstehung nach dem Alten Testament
- Die Entwicklung des Todes- und Auferstehungsverständnisses aus dogmengeschichtlicher Sicht
- Tod und Seelenunsterblichkeit in der griechischen Philosophie platonischer Provenienz
- Die Lehre von der Auferstehung der Toten in der theologischen Lehrtradition des Altertums
- Der Glaube an eine Auferstehung des ganzen Menschen bei den Apostolischen Vätern
- Die Überbietung der Unsterblichkeitslehren bei den frühchristlichen Apologeten und antignostischen Theologen
- Die „hierarchische“ Auferstehung und leiblich konstituierte Seele bei Tertullian
- Das Verständnis einer Auferstehung als prozesshaftes Geschehen bei Klemens und Origenes von Alexandrien
- Die Vorstellung von zwei Auferstehungen bei Augustinus
- Der Hylemorphismus und die Bestimmung der Seele als Form des Auferstehungsleibes in der mittelalterlichen Scholastik bei Thomas von Aquin
- Eschatologische Konzeptionen und Grundlinien des 20. Jahrhunderts
- Die evangelische Ganztodtheorie des 20. Jahrhunderts
- Die kritische Auseinandersetzung mit der Ganztodtheorie in der katholischen Theologie
- Die „Endentscheidungshypothese“ – der theologische Denkentwurf des Ladislaus Boros
- Die Theorie einer „Auferstehung im Tod“ als neue Konzeption der katholischen Dogmatik der Gegenwart
- Die These der „Auferstehung im Tod“ als Antwort auf eine klassisch gewordene katholische Eschatologie
- Die Auferstehung des einen und ganzen Menschen als Individuum
- Die Vollendung des Gesamten am Ende der Zeit
- Das Verständnis einer Auferstehung als prozesshaftes Geschehen
- Die „Auferstehung im Tod“ aus christologischer Perspektive
- Im Tod Jesu vollzieht sich das Auferstehungsgeschehen
- Die Auferstehung Jesu Christi als Voraussetzung der Auferweckung des Menschen
- Die universale Perspektive der Auferstehung Christi
- Die eschatologische Neuinterpretation der Identität zwischen Erden- und Auferstehungsleib
- Die Stellung der These einer „Auferstehung im Tod“ in der neueren katholischen Dogmatik
- Kritik an der Konzeption der „Auferstehung im Tod“
- Chancen und Leistungen der Theorie gegenüber dem traditionellen eschatologischen Denkmodell
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, die Entwicklung des christlichen Todes- und Auferstehungsverständnisses zu beleuchten, mit besonderem Fokus auf die Konzeption „Auferstehung im Tod“. Sie untersucht, wie der Glaube an die Auferstehung im Laufe der Geschichte und innerhalb der verschiedenen Strömungen der Theologie interpretiert und weiterentwickelt wurde.
- Die biblische Grundlage des Auferstehungsglaubens
- Die dogmengeschichtliche Entwicklung des Todes- und Auferstehungsverständnisses
- Die eschatologischen Konzeptionen des 20. Jahrhunderts
- Die Konzeption der „Auferstehung im Tod“ als zeitgenössisches Denkmodell der katholischen Dogmatik
- Die Rezeption und Bewertung dieser Konzeption in der neueren katholischen Theologie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Thematik der Auferstehung im Tod vor und erläutert die Relevanz der dogmengeschichtlichen Entwicklung des christlichen Todes- und Auferstehungsverständnisses.
- Die Auferstehung der Toten als Hoffnung über den Tod hinaus: Dieses Kapitel behandelt die biblischen Grundlagen der Auferstehungshoffnung.
- Grundbegriffe einer biblischen Anthropologie als Ausdruck der Ganzheitlichkeit des Menschen: Hier werden die anthropologischen Grundtermini des Alten und Neuen Testaments untersucht und in Verbindung mit der eschatologischen Thematik der Auferstehung gebracht.
- Tod und Auferstehung aus biblischer Perspektive: Dieses Kapitel analysiert das biblische Todes- und Auferstehungsverständnis im Kontext des Alten und Neuen Testaments.
- Die Entwicklung des Todes- und Auferstehungsverständnisses aus dogmengeschichtlicher Sicht: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung des Todes- und Auferstehungsverständnisses in der Antike und im Mittelalter, insbesondere die Rezeption der platonischen Lehre und die Rolle der Kirchenväter.
- Eschatologische Konzeptionen und Grundlinien des 20. Jahrhunderts: Dieses Kapitel beleuchtet die eschatologischen Konzeptionen des 20. Jahrhunderts, wie die Ganztodtheorie und die Endentscheidungshypothese.
- Die Theorie einer „Auferstehung im Tod“ als neue Konzeption der katholischen Dogmatik der Gegenwart: Dieses Kapitel stellt die Theorie der „Auferstehung im Tod“ vor und untersucht ihre Relevanz für die moderne katholische Eschatologie.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen der christlichen Eschatologie, wie dem Tod, der Auferstehung, dem menschlichen Körper und der Vollendung des Menschen in Gott. Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Auferstehung im Tod, Ganztodtheorie, Endentscheidungshypothese, Hylemorphismus, biblische Anthropologie, christologische Perspektive, eschatologische Neuinterpretation.
- Quote paper
- Franziska Jarszick (Author), 2021, Auferstehung im Tod. Ein eschatologisches Denkmodell neuerer katholischer Dogmatik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1416607