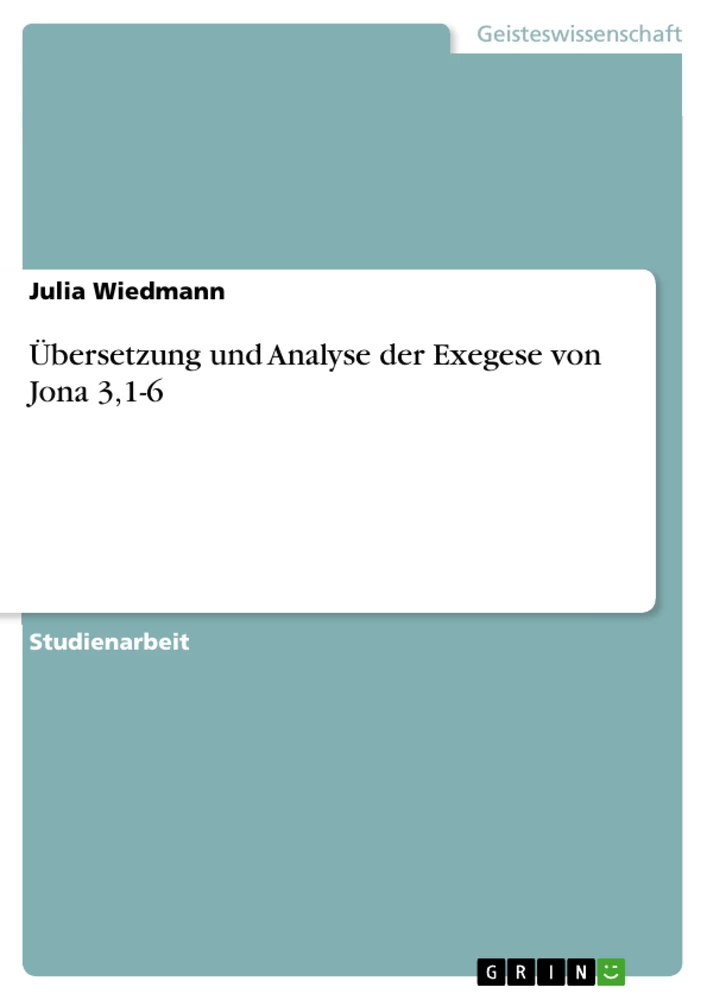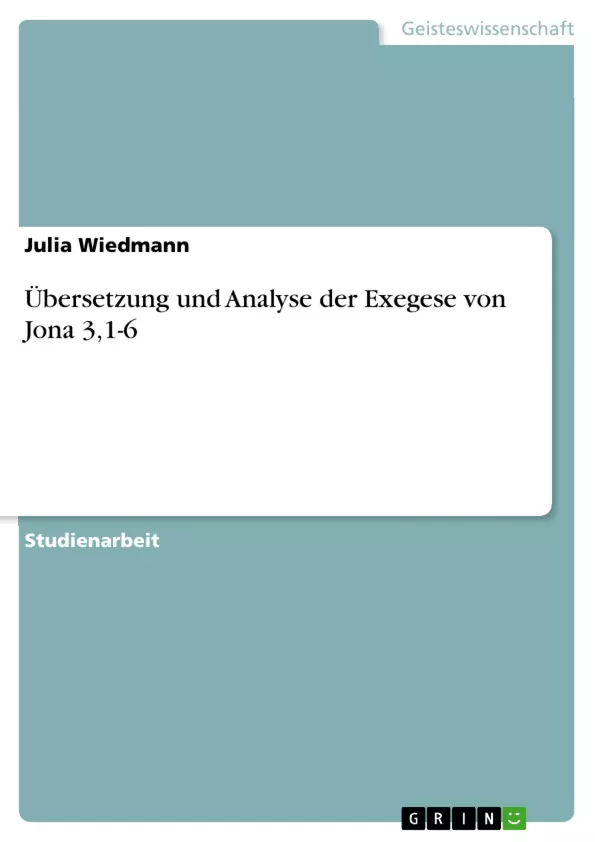Durchführung der exegetischen Arbeitsschritte am Beispiel von Jona 3,1-6. So stolz das Volk Israel auf seinen Status als erwähltes Volk ist, hat es in seiner Geschichte mit Jahwe auch Fehler gemacht und so den Zorn Gottes auf sich gezogen. Als erwähltes Volk konnte es sich aber dennoch in besonderer Weise der Gnade Gottes gewiss sein. Dass diese Gnade aber nicht nur dem Volk Israel vorbehalten ist, zeigt das Kapitel 3 des Jonabuches.
Gerade am Beispiel der für ihre Lasterhaftigkeit bekannten Stadt Ninive zeigt Gott, dass er seine Gnade dort walten lässt, wo Menschen bereuen und umkehren auf den richtigen Weg des Glaubens. Wenn schon die Größe und Bosheit Ninives an Größe unvorstellbar ist, wie unvorstellbar groß ist dann erst Gottes Barmherzigkeit einer solchen Stadt gegenüber. Kein Volk ist so schlecht, dass es nicht auch die Möglichkeit hat, sich zu Gott zu bekehren, denn Gottes Gnade und Barmherzigkeit kennt keine Grenzen.
Inhaltsverzeichnis
- Übersetzung des Masoretischen Textes von Jona 3, 1-6
- Textkritik
- Literarkritik
- Der Wechsel der Gottesbezeichnungen
- Brüche
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der vorliegende Text analysiert die Unterschiede zwischen der masoretischen Textversion (MT) und der Septuaginta-Version (LXX) des Bibeltextes Jona 3, 1-6. Die Untersuchung konzentriert sich auf die verschiedenen Übersetzungen und die daraus resultierenden Interpretationsprobleme, insbesondere im Hinblick auf die Zeitangabe der prophezeiten Zerstörung von Ninive und die Bedeutung des göttlichen Namens.
- Unterschiede in der Übersetzung der beiden Textversionen
- Analyse der Zeitangaben und ihre Implikationen
- Untersuchung der Bedeutung des göttlichen Namens und seine Rolle im Text
- Literarische Besonderheiten des Textes
- Theologische Interpretation der Erzählung
Zusammenfassung der Kapitel
Übersetzung des Masoretischen Textes von Jona 3, 1-6
Dieser Abschnitt präsentiert den hebräischen Text von Jona 3, 1-6 und seine deutsche Übersetzung. Der Fokus liegt auf der Darstellung des masoretischen Textes als Grundlage für die spätere Textkritik.
Textkritik
Dieser Abschnitt vergleicht den masoretischen Text (MT) mit der Septuaginta-Version (LXX) und analysiert die Unterschiede in der Übersetzung von Jona 3, 1-6. Insbesondere wird die Zeitangabe der prophezeiten Zerstörung von Ninive sowie der Gebrauch des göttlichen Namens im Text untersucht.
Literarkritik
Der Wechsel der Gottesbezeichnungen
Dieser Unterabschnitt untersucht den Wechsel der Gottesbezeichnungen im Text und beleuchtet die damit verbundenen theologischen und literarischen Implikationen.
Brüche
Dieser Unterabschnitt beleuchtet die Brüche in der Erzählung von Jona 3, 1-6 und analysiert die literarischen Funktionen dieser Brüche. Insbesondere wird die Darstellung der Bußreaktion des Königs von Ninive und seine Rolle im Text untersucht.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des Textes sind Textkritik, Bibelübersetzung, Gottesnamen, Jona 3, 1-6, Septuaginta, masoretischer Text, Literarkritik, Erzählstruktur, Zeitangabe, Ninive, Buße, göttliche Intervention. Die Analyse konzentriert sich auf die unterschiedlichen Interpretationen und die damit verbundenen theologischen Implikationen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Thema von Jona 3,1-6?
Das Kapitel beschreibt die Predigt Jonas in Ninive und die darauffolgende Buße der Stadt, die zur Begnadigung durch Gott führt.
Was sind die Unterschiede zwischen dem Masoretischen Text (MT) und der Septuaginta (LXX)?
Ein wesentlicher Unterschied liegt in der Zeitangabe: Während der MT 40 Tage bis zur Zerstörung nennt, spricht die LXX von nur 3 Tagen.
Welche Rolle spielt der Wechsel der Gottesbezeichnungen?
Die Arbeit untersucht, warum zwischen „Jahwe“ und „Elohim“ gewechselt wird und welche theologischen Nuancen damit verbunden sind.
Warum ist die Reaktion des Königs von Ninive bemerkenswert?
Der König reagiert sofort mit radikaler Buße (Asche, Fasten), was die universale Reichweite von Gottes Gnade unterstreicht, die nicht nur Israel gilt.
Was lehrt das Buch Jona über Gottes Barmherzigkeit?
Es zeigt, dass Gottes Gnade keine Grenzen kennt und jedem Volk offensteht, das aufrichtig bereut und umkehrt.
- Arbeit zitieren
- Julia Wiedmann (Autor:in), 2009, Übersetzung und Analyse der Exegese von Jona 3,1-6, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/141879