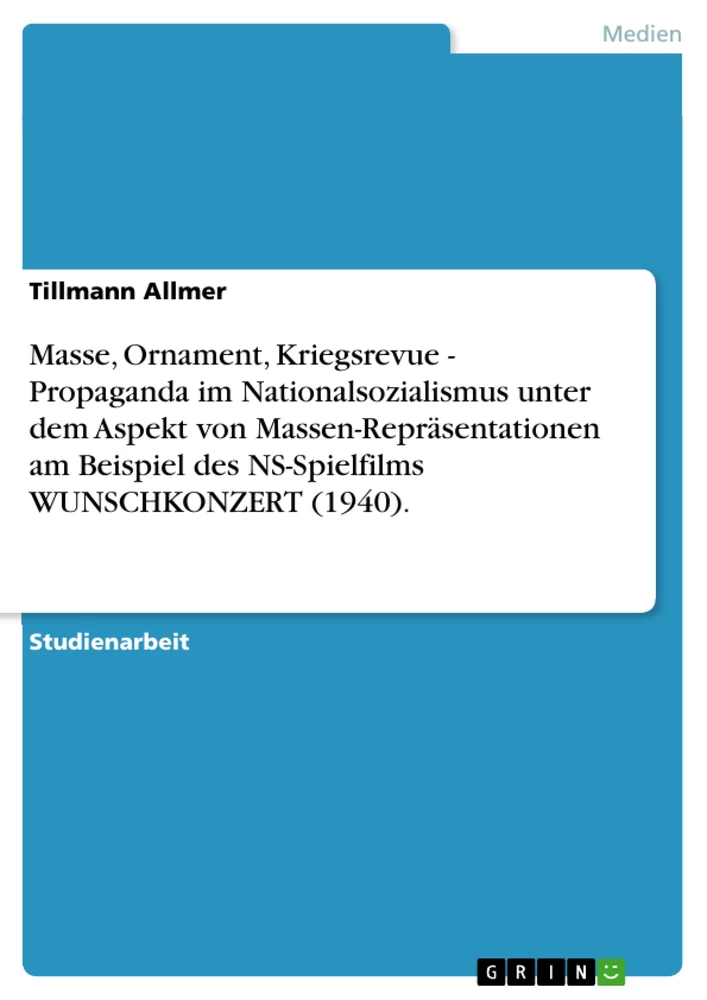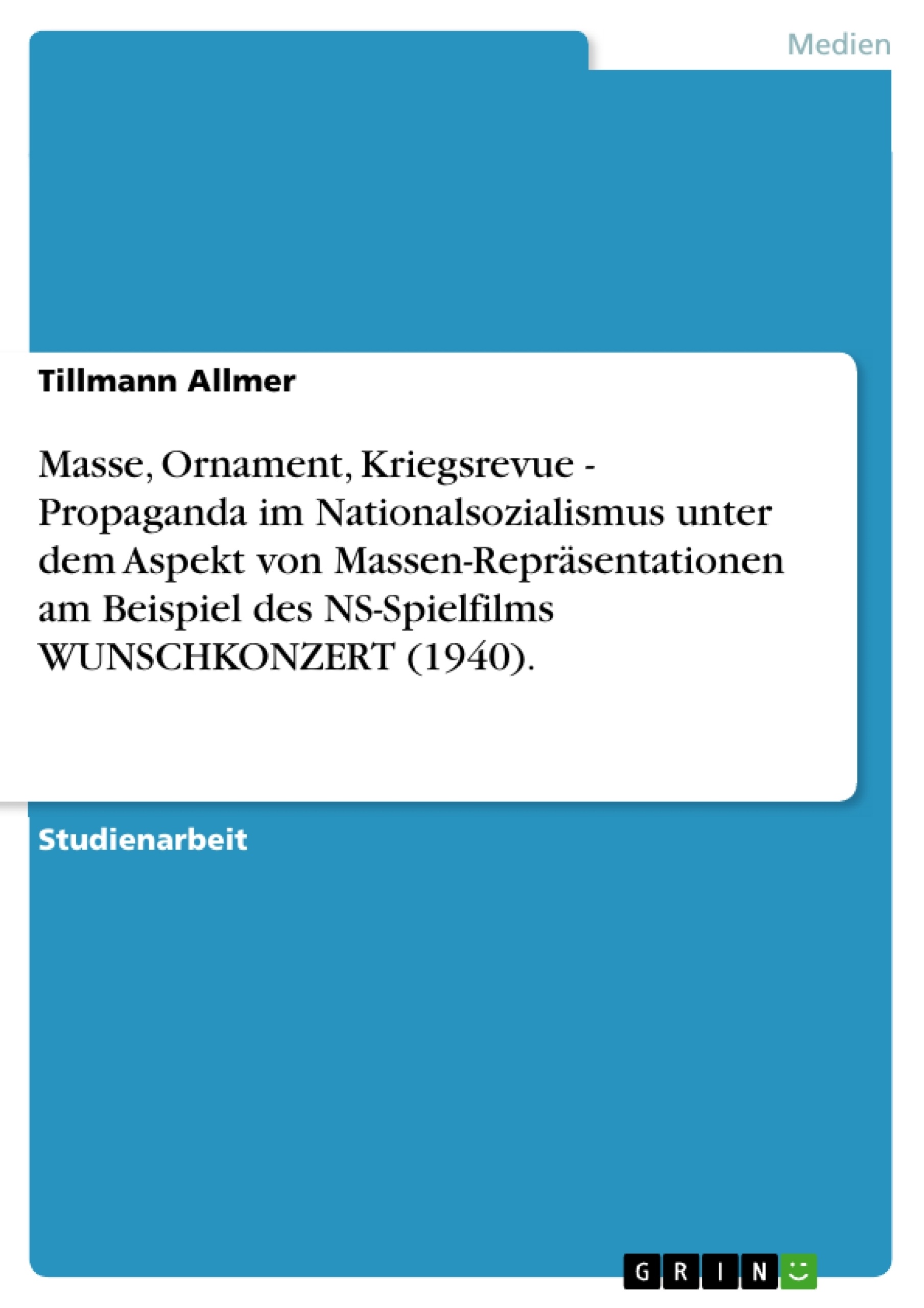"Der Krieg", schreibt Erich Ludendorff, Erster Generalquartiermeister bei der Obersten Heeresleitung, am 4. Juli 1917 in einem Brief an das Kaiserliche Kriegsministerium, "hat die überragende Macht des Bildes und des Films als Aufklärungs- und Beeinflussungsmittel gezeigt. Leider haben unsere Feinde den Vorsprung auf diesem Gebiet so gründlich ausgenutzt, dass schwerer Schaden für uns entstanden ist." Die ersten Sätze in der Denkschrift des Generals, die als "Gründungsdokument" der Universum Film AG (Ufa) gilt, lassen den engen Zusammenhang zwischen moderner Kriegführung und der Technik der Kinematographie erkennen. Die Feldherren des Ersten Weltkrieges sehen im Film, der zu diesem Zeitpunkt kaum älter als zwei Jahrzehnte ist, eine "wirkungsvolle Kriegswaffe", ein geeignetes Instrument zur massenwirksamen Verbreitung ihrer Propaganda.
In den expandierenden Städten der Jahrhundertwende, den Ballungsorten industrieller Produktion, Administration und Distribution, findet das Kino nicht nur sein erstes Publikum, indem es die Vergnügungs- und Zerstreuungsquartiere um ein neues Mittel der Illusionierung bereichert. Die Objektivationen der urbanen Lebenswelt, ihre immanenten Gegensätze von Tempo und Dynamik einerseits und naturnahen Enklaven andererseits, bieten dem Film die adäquate Motivik für seine künstlerischen Möglichkeiten. Mit dem Schwirren der Räder, den Takten ihrer Arbeit und den Illuminationen ihrer Nächte revolutioniert die moderne Großstadt die Erfahrungs- und Denkkategorien von Zeit und Raum. Kein anderes Medium scheint die diffizilen Wahrnehmungsangebote von Tempo, Rhythmus und Licht authentischer vermitteln zu können, als das der `laufenden´ Bilder. Mit dem Blick auf die Stadt und ihre Massen wandelt sich die Ästhetik des apparativen Sehens.
Wie und inwieweit das Massenmedium Film unter der Ägide des Nationalsozialismus eine Funktion als Mittel der `geistigen Kriegführung zu erfüllen vermochte, ist der Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit. Das Erkenntnisinteresse richtet sich dabei auf die Rolle und Repräsentation von `Massen´ in dem NS-Spielfilm WUNSCHKONZERT aus dem Jahr 1940. In einer exemplarischen Analyse einiger ausgewählter Sequenzen aus dem Film werden Verknüpfungen zwischen den Massenornamenten der "Revuen" und des Militärs gezogen und auf die Funktion hin betrachtet, welche die Massenmedien Film und Rundfunk für die NS-Propaganda zur Herstellung einer "Volksgemeinschaft", einer `gleichgeschalteten´ Masse, erfüllten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Massenkultur und Ideologie im nationalsozialistischen Spielfilm
- 3. WUNSCHKONZERT (1940)
- 3.1. Rundfunk und Krieg
- 3.2. "Revue" zwischen Front und Heimat
- 4. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle des Massenmediums Film im Nationalsozialismus, insbesondere seine Funktion als Instrument der "geistigen Kriegführung". Der Fokus liegt auf der Repräsentation von Massen im NS-Spielfilm "Wunschkonzert" (1940). Durch die Analyse ausgewählter Sequenzen werden Verbindungen zwischen Massenornamenten und Propaganda hergestellt.
- Die Funktion des Films als Propagandamittel im Nationalsozialismus
- Massenrepräsentationen im NS-Spielfilm "Wunschkonzert"
- Der Zusammenhang zwischen Massenmedien, Propaganda und der Herstellung einer "Volksgemeinschaft"
- Die Verbindung von Massenornamenten im Film mit dem Militär
- Die ideologischen Grundlagen nationalsozialistischer Filmproduktion
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet den frühen Zusammenhang zwischen moderner Kriegführung und der Kinematographie. Sie zeigt auf, wie die Feldherren des Ersten Weltkriegs den Film als "wirkungsvolle Kriegswaffe" und Instrument zur massenwirksamen Propaganda erkannten. Die Entstehung des Kinos in den expandierenden Städten der Jahrhundertwende wird beschrieben, wobei der Einfluss der urbanen Lebenswelt auf die filmische Ästhetik hervorgehoben wird. Der Text führt den Untersuchungsgegenstand ein: die Rolle des Massenmediums Film im Nationalsozialismus, insbesondere im Film "Wunschkonzert" (1940), und die Repräsentation von Massen darin.
2. Massenkultur und Ideologie im nationalsozialistischen Spielfilm: Dieses Kapitel untersucht Form und Funktion der nationalsozialistischen Weltanschauung. Es wird argumentiert, dass der Nationalsozialismus weniger ein schlüssiges Welterklärungsmodell als ein "Glaubensbekenntnis" war, das auf Massenwirkung zielte. Stephen Lowrys These von drei Grundformen der Kultur im Nationalsozialismus (traditionelle Ideologie, faschistische Öffentlichkeit, moderne Massenkultur) wird vorgestellt und die These der "reinen Unterhaltung" nationalsozialistischer Filme widerlegt. Die Arbeit diskutiert die inkonsistente Natur der Nazi-Ideologie als ein Konglomerat widersprüchlicher Elemente und vergleicht die Ansätze von Habermas und Lowry zur Charakterisierung des nationalsozialistischen Ideensystems. Lowry argumentiert, dass die Verbindung von traditionellen Elementen mit modernen Formen der kulturellen Vermittlung eine neuartige, sozial integrative und legitimatorische Kraft ausübte.
Schlüsselwörter
Nationalsozialismus, Propaganda, Massenmedien, Film, "Wunschkonzert", Massenrepräsentation, Massenornament, Ideologie, Massenkultur, "Volksgemeinschaft", geistige Kriegführung, Rundfunk, Revue.
Häufig gestellte Fragen zu "Massenkultur und Ideologie im nationalsozialistischen Spielfilm - Analyse von 'Wunschkonzert' (1940)"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Rolle des Films als Massenmedium im Nationalsozialismus, insbesondere seine Funktion als Propagandainstrument. Der Fokus liegt dabei auf dem NS-Spielfilm "Wunschkonzert" (1940) und der Repräsentation von Massen darin. Analysiert werden die Verbindungen zwischen Massenornamenten und Propaganda.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Funktion des Films als Propagandamittel, Massenrepräsentationen in "Wunschkonzert", den Zusammenhang zwischen Massenmedien, Propaganda und der "Volksgemeinschaft", die Verbindung von Massenornamenten und Militär sowie die ideologischen Grundlagen nationalsozialistischer Filmproduktion.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Kapitel 1 (Einleitung): Der Zusammenhang zwischen moderner Kriegführung und Kinematographie im Ersten Weltkrieg wird dargestellt. Die Entstehung des Kinos und dessen Einfluss der urbanen Lebenswelt wird beschrieben. Der Fokus liegt auf der Rolle des Films im Nationalsozialismus und der Repräsentation von Massen in "Wunschkonzert".
Kapitel 2 (Massenkultur und Ideologie): Dieses Kapitel untersucht Form und Funktion der nationalsozialistischen Ideologie, die als "Glaubensbekenntnis" mit dem Ziel der Massenwirkung charakterisiert wird. Die These von drei Grundformen der Kultur im Nationalsozialismus (Lowry) wird diskutiert, und die These der "reinen Unterhaltung" nationalsozialistischer Filme widerlegt. Die Arbeit analysiert die inkonsistente Natur der Nazi-Ideologie und vergleicht die Ansätze von Habermas und Lowry.
Kapitel 3 (Wunschkonzert): Dieses Kapitel analysiert den Film "Wunschkonzert" im Detail, unterteilt in die Unterkapitel "Rundfunk und Krieg" und "Revue zwischen Front und Heimat".
Kapitel 4 (Schlussbetrachtung): [Der Inhalt des Schlusskapitels ist nicht explizit in der Zusammenfassung enthalten.]
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Nationalsozialismus, Propaganda, Massenmedien, Film, "Wunschkonzert", Massenrepräsentation, Massenornament, Ideologie, Massenkultur, "Volksgemeinschaft", geistige Kriegführung, Rundfunk, Revue.
Welche Quellen werden verwendet?
Die expliziten Quellen sind nicht in der Vorschau aufgeführt. Die Arbeit bezieht sich jedoch auf die Theorien von Stephen Lowry und Jürgen Habermas.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke bestimmt und dient der Analyse von Themen im Nationalsozialismus.
Wo finde ich den vollständigen Text?
Der vollständige Text ist nicht in dieser Vorschau enthalten. Weitere Informationen zur Beschaffung des vollständigen Textes sind nicht angegeben.
- Arbeit zitieren
- Tillmann Allmer (Autor:in), 1999, Masse, Ornament, Kriegsrevue - Propaganda im Nationalsozialismus unter dem Aspekt von Massen-Repräsentationen am Beispiel des NS-Spielfilms WUNSCHKONZERT (1940)., München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1420