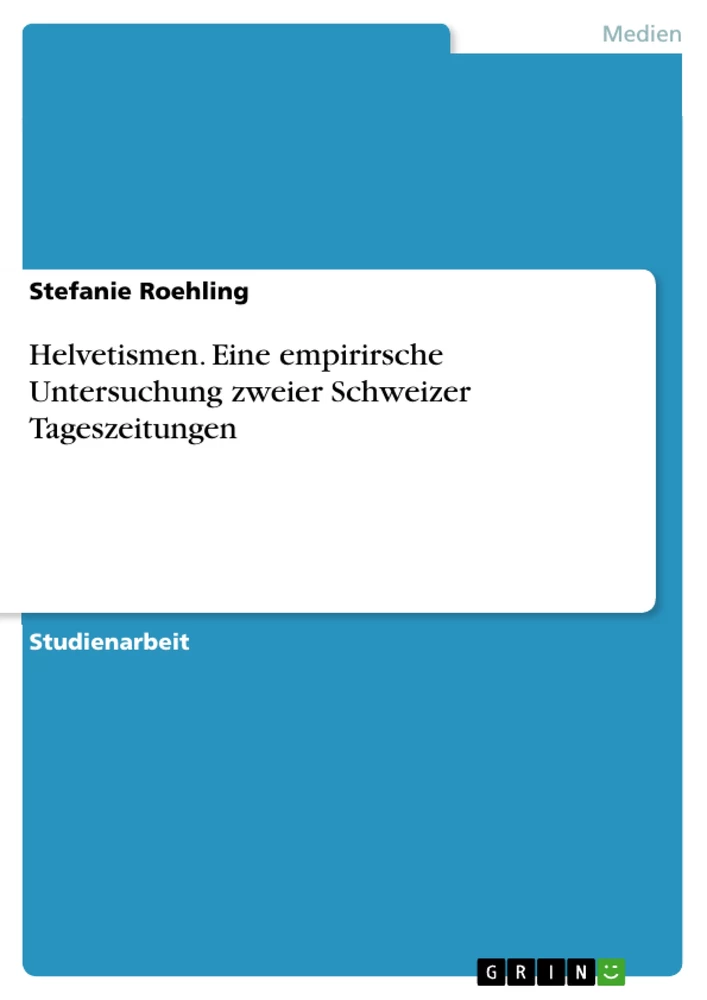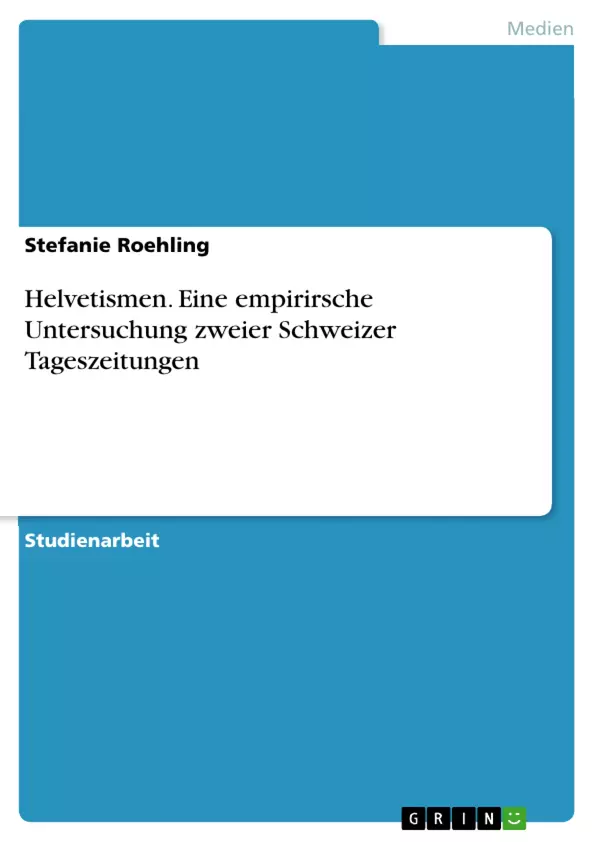Im Rahmen meines Auslandssemesters 2008 an der Universität Zürich mit Schwerpunkt „Deutsche Sprachwissenschaft“ wurde mir unter anderem die Möglichkeit geboten, mehr über die nationalen Varietäten des Deutschen zu erfahren. Zum ersten Mal wurde mir wirklich bewusst, dass schweizerisch und österreichisch nicht nur Dialekte sind, sondern nachweisliche Strukturen, spezifische Besonderheiten und eine Menge an Wörtern enthalten, die ich noch nie zuvor als deutsche Muttersprachlerin gehört habe. Durch tägliches Zeitungslesen und damit verbundenes Finden solcher Spezifika, sowie durch den täglichen Umgang mit dem Schweizerdeutsch wurde ich neugieriger auf dieses Thema und las dazu die aktuelle, vor Ort vorhandene, einschlägige Literatur1. So kam es dazu, dass ich mich im Rahmen des Seminars „Medienlinguistik“ in der vorliegenden Hausarbeit mit diesem Thema empirisch wissenschaftlich auseinander setzen durfte.
Zunächst gehe ich allgemein auf die Plurizentrizität der deutschen Sprache ein, bevor ich mir näher die Situation in der Schweiz anschaue. Im nächsten Kapitel werde ich meine Untersuchung erläutern und eine kurze Einführung in die zwei Tageszeitungen BLICK und Tages-Anzeiger geben, die mir für mein Vorhaben als Ausgangsmaterial dienten. Anschließend lege ich die methodischen Schritte meiner Vorgehensweise dar und beschäftige mich im darauf folgenden Kapitel mit der Kodifizierung von Helvetismen in den von mir verwendeten Nachschlagewerken. Der Umgang mit der Schweizer(hoch)deutschen Sprache in der Schweizer Presse soll dann noch einmal näher betrachtet und erleuchtet werden, bevor ich einige Ergebnisse meiner Untersuchung aufzeige. Dabei sollen unbedingt auch die mundartlichen Ausdrücke erwähnt werden, da diese auch im anschließenden Kapitel „Nähe und Distanz“ eine Rolle spielen. Abschließend möchte ich die Probleme, die während der Untersuchung aufkamen, ergänzen und biete gleichzeitig Lösungsvorschläge dafür an, die jedoch zum Teil sehr zeitintensiv sein könnten. Ausnahmsweise sei an dieser Stelle schon auf den Anhang verwiesen, der eine umfangreiche Wortliste enthält, die durchaus für weitere Untersuchungen dieser Art als Hilfe dienen und dann auch ergänzt werden könnte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Plurizentrizität der deutschen Sprache und das Standarddeutsch
- Die Situation in der Schweiz
- Die Untersuchung
- Blick
- Tages-Anzeiger
- Die Vorgehensweise
- Kodifizierung in den Nachschlagewerken
- Schweizer(hoch)deutsch in Schweizer Zeitungen
- Ergebnisse
- Mundartliche Ausdrücke
- Einordnung der Helvetismen in die Schemata nach EHRSAM-NEFF
- Nähe und Distanz von Sprache
- Probleme bei der Untersuchung
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Verwendung von Helvetismen in zwei Schweizer Tageszeitungen, dem Blick und dem Tages-Anzeiger. Ziel ist es, empirisch die sprachlichen Besonderheiten des Schweizerdeutschen in der Presse zu analysieren und in den Kontext der Plurizentrizität des Deutschen einzuordnen.
- Plurizentrizität des Deutschen und die Situation in der Schweiz
- Methodische Vorgehensweise bei der Analyse von Helvetismen
- Kodifizierung von Helvetismen in Nachschlagewerken
- Verwendung von Mundart in Schweizer Zeitungen
- Nähe und Distanz von Sprache in der medialen Darstellung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Entstehungshintergrund der Arbeit, der aus dem persönlichen Erleben der Autorin während eines Auslandssemesters in Zürich resultiert. Sie erläutert ihre zunehmende Faszination für die sprachlichen Besonderheiten des Schweizerdeutschen und skizziert den Aufbau der Hausarbeit, der von einer allgemeinen Betrachtung der Plurizentrizität des Deutschen über die methodische Vorgehensweise bis hin zur Präsentation der Ergebnisse führt. Besonderes Augenmerk liegt auf der empirischen Untersuchung anhand der beiden Tageszeitungen Blick und Tages-Anzeiger.
Die Plurizentrizität der deutschen Sprache und das Standarddeutsch: Dieses Kapitel beleuchtet die Plurizentrizität der deutschen Sprache, die sich in verschiedenen nationalen Varianten manifestiert. Es diskutiert unterschiedliche Auffassungen zur Plurizentrizität (plurinational vs. pluriareal) und stellt die Vollzentren (Deutschland, Österreich, Schweiz) den Halbzentren gegenüber. Der Autor verweist auf die Bedeutung von staatlichen Verwaltungen, Kontaktsprachen und Dialekten für die Herausbildung nationaler Varianten und veranschaulicht die Unterschiede anhand einer Tabelle mit Beispielen für nationale Varianten auf verschiedenen Sprachebenen (Schreibung, Aussprache, Grammatik, Wortbildung und Wortschatz). Die Definition des Standarddeutschen und dessen soziale Einbettung werden ebenfalls thematisiert.
Die Situation in der Schweiz: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die sprachliche Situation in der Schweiz, die durch mediale Diglossie gekennzeichnet ist. Die Autorin beschreibt die Verwendung von Mundart in gesprochenen und Standardsprache in geschriebenen Medien, wobei Ausnahmen in formellen Kontexten erwähnt werden. Das Kapitel betont den Kontrast zwischen Mundart und Schweizerhochdeutsch und legt die Grundlage für die spätere empirische Analyse in den ausgewählten Zeitungen.
Schlüsselwörter
Helvetismen, Plurizentrizität, Schweizerdeutsch, Standarddeutsch, Medienlinguistik, Tageszeitungen, Blick, Tages-Anzeiger, Mundart, Sprachvarietäten, Kodifizierung, empirische Untersuchung.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: "Helvetismen in Schweizer Tageszeitungen"
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit untersucht die Verwendung von Helvetismen (schweizerische Sprachvarianten) in den Schweizer Tageszeitungen "Blick" und "Tages-Anzeiger". Ziel ist die empirische Analyse der sprachlichen Besonderheiten des Schweizerdeutschen in der Presse und deren Einordnung in den Kontext der Plurizentrizität des Deutschen.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Plurizentrizität des Deutschen und die spezifische Situation in der Schweiz, die methodische Vorgehensweise bei der Analyse von Helvetismen, die Kodifizierung von Helvetismen in Nachschlagewerken, die Verwendung von Mundart in Schweizer Zeitungen und die Nähe und Distanz von Sprache in der medialen Darstellung. Die Einleitung beschreibt den Entstehungshintergrund der Arbeit und ihren Aufbau. Die Zusammenfassung der Kapitel gibt einen Überblick über die einzelnen Abschnitte.
Welche Methoden wurden in der Studie angewendet?
Die Studie verwendet eine empirische Methode, die auf der Analyse von Helvetismen in den ausgewählten Zeitungen ("Blick" und "Tages-Anzeiger") basiert. Die genaue Vorgehensweise wird im Kapitel zur Methodik detailliert beschrieben.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse umfassen die Analyse mundartlicher Ausdrücke, die Einordnung der Helvetismen in Schemata nach Ehram-Neff, eine Betrachtung der Nähe und Distanz von Sprache in den Zeitungen und eine Diskussion der Probleme bei der Untersuchung. Die Ergebnisse werden im entsprechenden Kapitel detailliert dargestellt.
Welche Zeitungen wurden untersucht?
Die Hausarbeit untersucht die beiden Schweizer Tageszeitungen "Blick" und "Tages-Anzeiger".
Was ist unter Plurizentrizität des Deutschen zu verstehen?
Die Arbeit beleuchtet die Plurizentrizität des Deutschen, also das Nebeneinander verschiedener nationaler Sprachvarianten (Vollzentren: Deutschland, Österreich, Schweiz; Halbzentren: weitere Länder mit Deutsch als Amtssprache). Es wird auf die Bedeutung von staatlichen Verwaltungen, Kontaktsprachen und Dialekten für die Herausbildung nationaler Varianten eingegangen.
Wie wird die sprachliche Situation in der Schweiz beschrieben?
Die sprachliche Situation in der Schweiz wird als mediale Diglossie beschrieben, mit der Verwendung von Mundart in gesprochenen und Standardsprache in geschriebenen Medien (Ausnahmen in formellen Kontexten). Der Kontrast zwischen Mundart und Schweizerhochdeutsch wird hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Helvetismen, Plurizentrizität, Schweizerdeutsch, Standarddeutsch, Medienlinguistik, Tageszeitungen, Blick, Tages-Anzeiger, Mundart, Sprachvarietäten, Kodifizierung, empirische Untersuchung.
- Arbeit zitieren
- Stefanie Roehling (Autor:in), 2008, Helvetismen. Eine empirirsche Untersuchung zweier Schweizer Tageszeitungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/142621