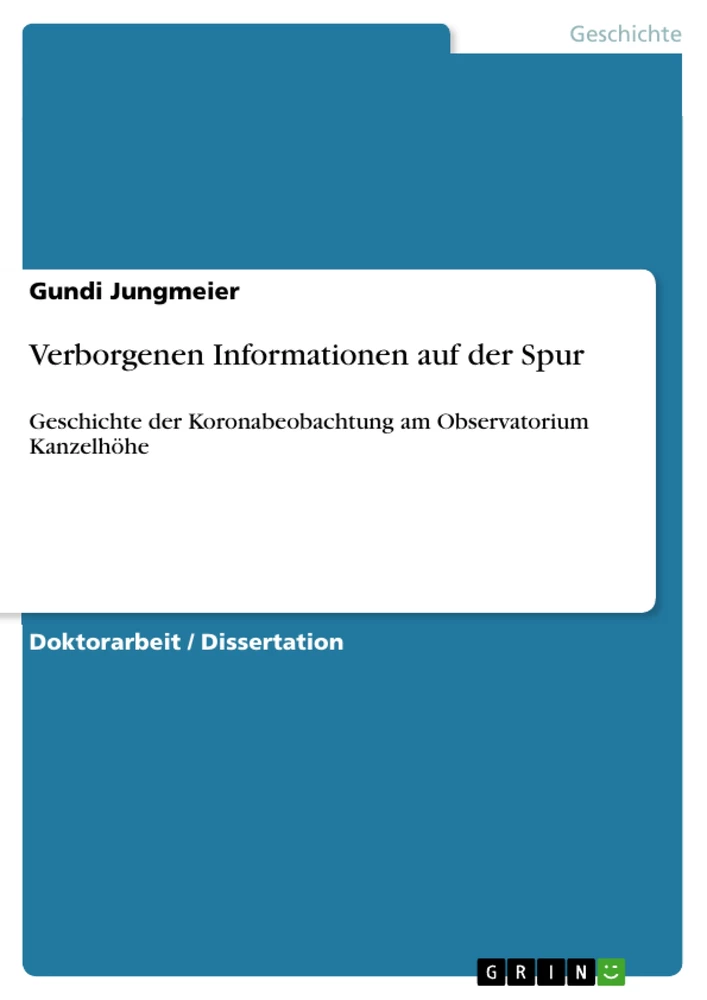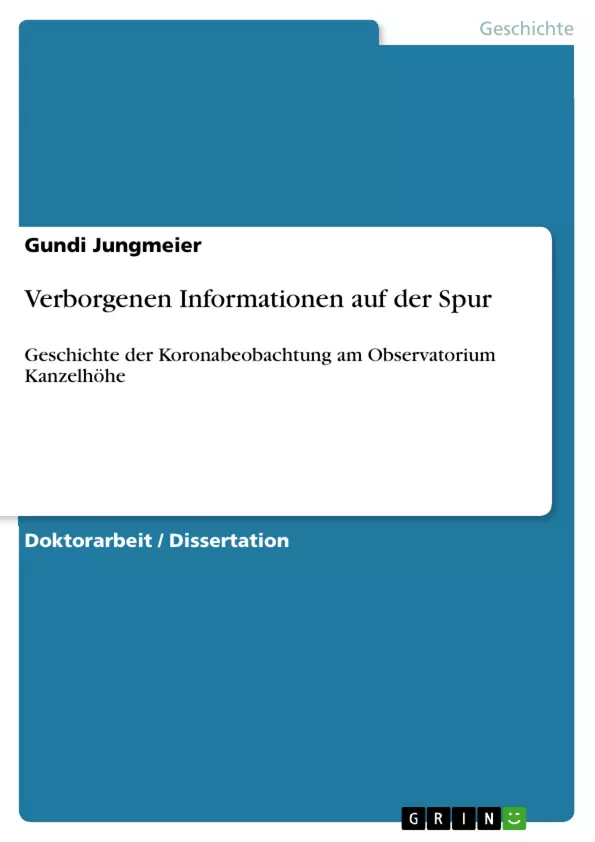Die Dissertation befasst sich mit der Geschichte des Observatoriums Kanzelhöhe für Sonnen- und Umweltforschung (KSO) bei Villach in Kärnten, das seit 1945 Teil der Universität Graz ist. Zunächst bietet sie eine ausführliche Rekonstruktion der Gründungsgeschichte und der äußeren Rahmenbedingungen. Aufbauend darauf steht die Entwicklung der Koronabeobachtung als Praxis der Datengewinnung für wissenschaftliche Zwecke im Fokus. Zur Beschaffenheit der Korona und den solar-terrestrischen Beziehungen entstanden in den 1930er Jahren neue Theorien in der Physik. Mit einem neuartigen Instrument, dem Koronografen, konnte die Sonnenkorona ab den 1930er Jahren erstmals außerhalb totaler Sonnenfinsternisse beobachtet werden. Ab 1947/48 wurde am KSO mit der laufenden Koronabeobachtung begonnen. Die Ergebnisse wurden mit jenen anderer Beobachtungsstationen in verwertbares Datenmaterial überführt.
Zugrundegelegt wird der Arbeit die Theorie der Theoriebeladenheit wissenschaftlicher Beobachtung. Diese geht davon aus, dass Beobachtung nie völlig frei von Theorie ist und daher keine neutrale Basis bilden bzw. nicht als alleiniger objektiver Beweis herangezogen werden kann. Ein möglicher Ausweg aus diesem Dilemma ist eine zusätzliche Absicherung von Theorien mittels Konsistenz, Kohärenz innerhalb des größeren wissenschaftlichen Systems und Unabhängigkeit (Heranziehung von anderen Theorien im Beobachtungsprozess als jene, die damit geprüft werden soll).
Die Dissertation überprüft anhand der Koronabeobachtung am KSO inwieweit auch die Ergebnisse der (theoriebeladenen) Beobachtung mittels Konsistenz, Kohärenz und Unabhängigkeit abgesichert werden können und kommt zu dem Schluss, dass die o. a. Methoden durchaus dazu geeignet sind, um abgesicherte Daten für die weitere Forschung zu gewinnen. Sie sind nicht nur dazu geeignet, sondern kamen im Prozess der Transformation der Beobachtungsergebnisse in Datenmaterial tatsächlich zur Anwendung.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Stand der Forschung
- Quellen
- Methode
- Anfänge der wissenschaftlichen Sonnenbeobachtung und -forschung
- Moderne Sonnenforschung
- Die Sonne unter regelmäßiger Beobachtung
- Entstehung von Astrophysik bzw. Sonnenphysik
- Sonnenfleckenbeobachtung
- Koronabeobachtung
- Spektroskopie
- Fotografie
- Etablierung von Sonnenphysik und Astrophysik
- Beobachtungs- und Forschungsnetzwerke
- Funkberatung der deutschen Luftwaffe
- Entwicklung von Funksendern und -empfängern
- Kurzwellenfunk
- Sonnenforschung für das Militär
- Die Errichtung von Observatorien
- Kooperationen
- Sternwarte Göttingen
- Astrophysikalisches Observatorium Potsdam
- Weitere deutsche Beobachtungsstationen
- Eidgenössische Sternwarte Zürich
- Mobilisierung von Ressourcen in okkupierten Gebieten
- Observatorium Paris-Meudon – Frankreich
- Observatorium Pic du Midi – Frankreich
- Observatorium Tromsø – Norwegen
- Observatorium Belgrad – Jugoslawien
- Sternwarte Simejis – UdSSR
- Sternwarte Frascati – Italien
- Sternwarte Ondřejov – Reichsprotektorat Böhmen und Mähren
- Das Fraunhofer-Institut in den letzten Kriegsmonaten
- Bau des Observatoriums Kanzelhöhe
- Bau von Hauptgebäude und Turm II
- Bau von Turm III auf der Gerlitzen
- Exkurs: Gab es Zwangsarbeit beim Bau der Beobachtungsanlagen?
- Organisatorische Entwicklung nach Kriegsende
- Gründung des Kuratoriums für das Observatorium
- Weitere Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut
- Kooperation mit dem Royal Greenwich Observatory
- Kooperation mit der Eidgenössischen Sternwarte Zürich
- Endgültige Angliederung des Observatoriums an die Universität Graz
- Lebens- und Arbeitsbedingungen
- Personal
- Personalstruktur vor dem Kriegsende
- Personalstruktur nach dem Kriegsende
- Lebensbedingungen
- Arbeitsbedingungen
- Mangel
- Arbeiten an den Instrumenten
- Personal
- Gewinnung zuverlässiger Daten aus der Koronabeobachtung
- Beobachtung in der Wissenschaft
- Begriffsbestimmung
- Theoriebeladenheit der Beobachtung
- Kritik an der Theorie der Theoriebeladenheit
- Kohärenz als Ausweg
- Stand der Koronaforschung in den 1930er und 1940er Jahren
- Aufbau der Korona
- Solar-terrestrische Beziehungen
- Theoriegeleitete Fragestellungen
- Erdgebundene Koronabeobachtung mittels Koronografen
- Koronabeobachtung auf der Kanzelhöhe
- Tätigkeitsberichte des Observatoriums
- Arbeitspraxis am Observatorium
- Ausstattung und Beobachtungsprogramm
- Dokumentation und Kommunikation
- Methoden der Koronabeobachtung
- Beobachtung der Beobachtungsbedingungen
- Durchmusterung nach Protuberanzen und Protuberanzenaufnahmen
- Intensitätsschätzung der Koronahelligkeit
- Gewinnung zuverlässiger Daten
- Befähigung der Beobachterinnen und Beobachter
- Instrumentelle Weiterentwicklungen
- Überführung subjektiver Schätzungen in quantifizierbares Datenmaterial
- Absicherung der gewonnenen Daten
- Konsistenz: Abstimmung mit anderen Stationen
- Kohärenz: Zusammenführung von Daten
- Unabhängigkeit des Beobachtungsprozesses
- Zusammenfassung
- Schlussfolgerung
- Epilog
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Dissertation untersucht die Geschichte des Observatoriums Kanzelhöhe, das während des Zweiten Weltkriegs errichtet wurde. Die Arbeit konzentriert sich auf die Entwicklung der Koronabeobachtung, die Maßnahmen und Methoden zur Gewinnung zuverlässiger Daten sowie die Einbindung des Observatoriums in wissenschaftliche Netzwerke nach dem Krieg.
- Die Gründungsgeschichte des Observatoriums Kanzelhöhe im Kontext der deutschen Sonnenforschung für militärische Zwecke
- Die Entwicklung der Koronabeobachtung als Praxis der Datengewinnung
- Die Herausforderungen der Datensicherung und -weitergabe in der Nachkriegszeit
- Die Rolle der Theoriebeladenheit in der wissenschaftlichen Beobachtung
- Die Einbindung des Observatoriums Kanzelhöhe in nationale und internationale Forschungsnetzwerke
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Kapitel 1 gibt einen Überblick über das Thema und die zentralen Fragestellungen der Arbeit.
- Kapitel 2 beleuchtet den aktuellen Forschungsstand zur Geschichte der Sonnenforschung, zum Verhältnis von Theorie und Beobachtung und zur Theoriebeladenheit von Beobachtung.
- Kapitel 3 listet die Quellen auf, die für die Rekonstruktion der Gründungsgeschichte und der Beobachtungspraxis am Observatorium Kanzelhöhe verwendet wurden.
- Kapitel 4 beschreibt die Methode, die für die Analyse der Quellen verwendet wurde.
- Kapitel 5 beleuchtet die Entwicklung der Sonnenforschung von der Antike bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und zeigt die Etablierung der Sonnenphysik als eigenständiges Forschungsgebiet.
- Kapitel 6 stellt die Bedeutung der Funkberatung für die deutsche Luftwaffe während des Zweiten Weltkriegs dar und beleuchtet die Gründung und Entwicklung des Fraunhofer-Instituts für Sonnenforschung.
- Kapitel 7 beschreibt den Bau des Observatoriums Kanzelhöhe und untersucht die Frage nach dem möglichen Einsatz von Zwangsarbeit.
- Kapitel 8 beleuchtet die organisatorische Entwicklung des Observatoriums nach Kriegsende, die Herausforderungen der neuen Verwaltung durch die Universität Graz, sowie die Zusammenarbeit mit anderen wissenschaftlichen Institutionen.
- Kapitel 9 stellt die Lebens- und Arbeitsbedingungen am Observatorium Kanzelhöhe in der Zeit nach dem Krieg dar und beleuchtet die Herausforderungen des Ressourcenmangels.
- Kapitel 10 analysiert das wissenschaftstheoretische Konzept der Theoriebeladenheit von Beobachtung.
- Kapitel 11 beleuchtet den Stand der Koronaforschung in den 1930er und 1940er Jahren und zeigt die Entwicklung von Theorien über die Beschaffenheit der Korona und die solar-terrestrischen Beziehungen.
- Kapitel 12 rekonstruiert die Praxis der Koronabeobachtung am Observatorium Kanzelhöhe anhand der Tätigkeitsberichte, einschließlich der Beobachtung der Beobachtungsbedingungen, der Durchmusterung nach Protuberanzen und der Intensitätsschätzung der Koronahelligkeit.
- Kapitel 13 untersucht die Frage, wie aus den Beobachtungsergebnissen zuverlässige Daten für die weitere Forschung gewonnen werden konnten, wobei Konsistenz, Kohärenz und Unabhängigkeit der Daten als wesentliche Kriterien betrachtet werden.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Dissertation befasst sich mit der Geschichte der Sonnenbeobachtung und -forschung, insbesondere mit dem Observatorium Kanzelhöhe, der Koronabeobachtung, der Theoriebeladenheit wissenschaftlicher Beobachtung und den solar-terrestrischen Beziehungen. Weitere wichtige Themen sind die Funkberatung, der Zweite Weltkrieg, die Entwicklung des Fraunhofer-Instituts, die Datensicherung, das wissenschaftliche Netzwerk, die Zusammenarbeit mit internationalen Forschungseinrichtungen und die Herausforderungen der Nachkriegszeit.
- Citar trabajo
- Gundi Jungmeier (Autor), 2018, Verborgenen Informationen auf der Spur, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1441992