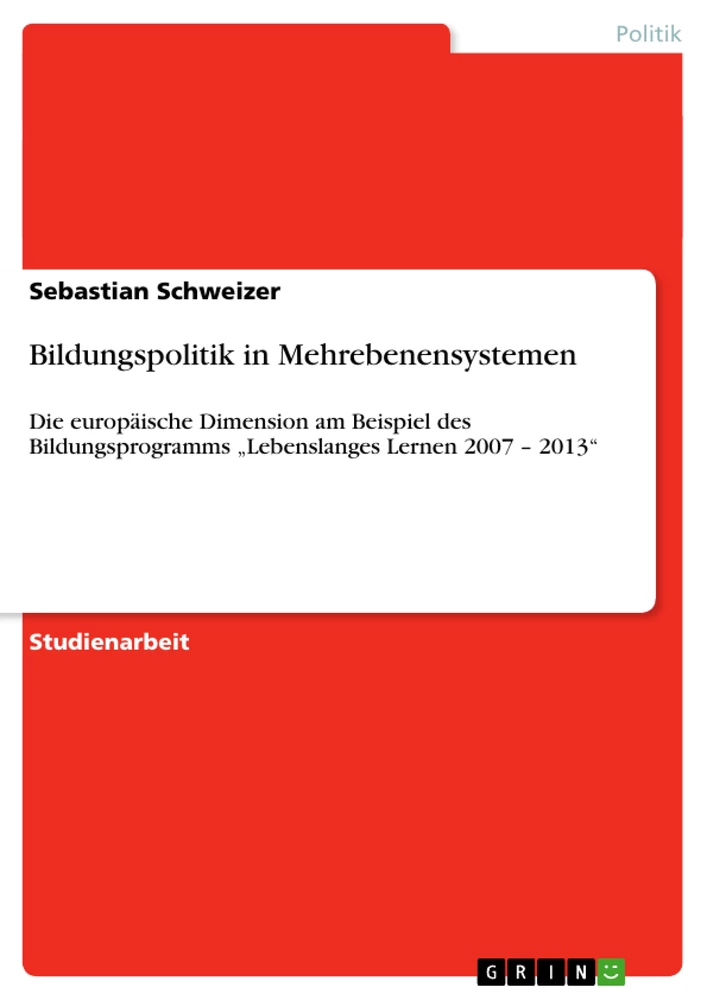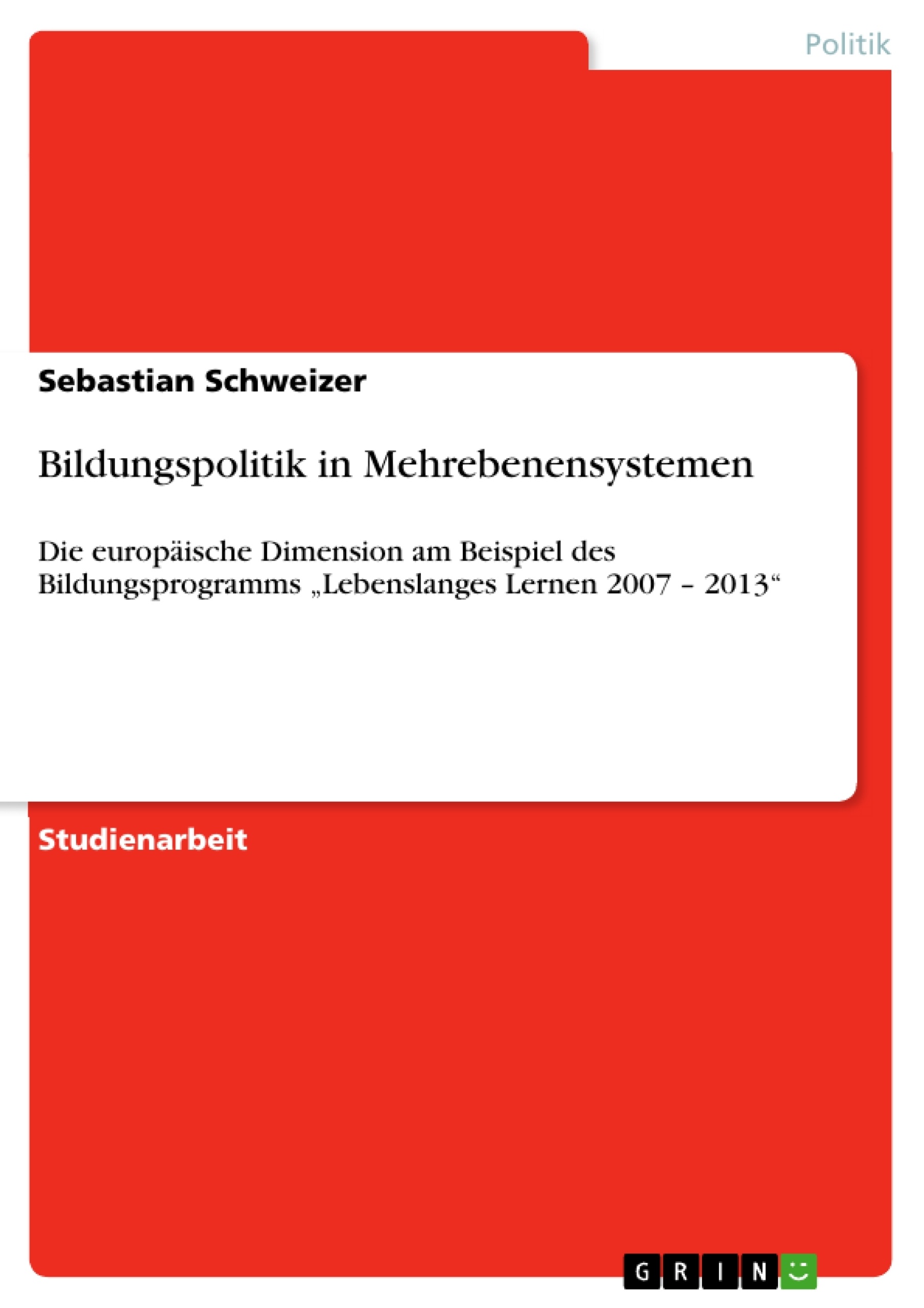Supranationale und internationale Institutionen und Akteure haben in den letzten Jahren in der Bildungspolitik einen immensen Bedeutungszuwachs erfahren und somit auch die nationalstaatlichen
Bildungsdebatten über den Status quo und die eventuell notwendigen Reformen nachhaltig geprägt. Die bekanntesten Beispiele sind zum einen die supranationale Organisation Europäische Union in Gestalt des Bologna-Prozess zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Hochschulraumes und zum anderen die internationale OECD (Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung), welche für die seit Anfang des neuen Jahrtausends Aufsehen erregenden PISA-Studien zur Evaluierung der Bildungssituation in den Mitgliedsländern verantwortlich ist. Diese Entwicklung scheint auf den ersten Blick sehr verwunderlich zu sein, denn die Bildungspolitik gilt schon seit jeher als Domäne des Nationalstaates und ist in den meisten europäischen Staaten durch die Kulturhoheit der Länder fest verankert. Es existiert folglich eine zweischneidige Entwicklung in der Bildungspolitik, zum einen national und zum anderen supranational beziehungsweise international. Doch welche Kompetenzen besitzt die Europäische Union denn eigentlich wirklich und welche rechtlichen Grundlagen machen eine europäische Intervention in die Bildungspolitik möglich? Dabei liegt der Fokus auf den neuen Steuerungsmechanismen in der Bildungspolitik, der „offene Koordinierungsmethode“ und den neuen „governance- Strukturen“ im Mehrebenensystem der internationalen Gemeinschaft. Welche Folgen die Internationalisierung der Bildungspolitik in der supranationalen europäischen Dimension wirklich hat, soll in der folgenden Arbeit zunächst aus einer akteurzentrierten Perspektive analysiert werden und dann durch das Beispiel des aktuellen „Steckenpferdes“ der Europäischen Bildungspolitik im Mehrebenensystem, dem integrierten Programm des „Lebenslangen Lernens 2007-2013“ verdeutlicht werden. Dabei sollen weniger die politischen Theorien konstitutiv sein, sondern die Praxis auch durch die Analyse der Finanzierung der Bildungspolitik im Vordergrund stehen. Daneben darf auch die normative Dimension der aktuellen Prozesse und Entwicklungen nicht vernachlässigt werden und in einem Ausblick sollen letztendlich die Handlungsoptionen und möglichen Tendenzen der Internationalisierung der Bildungspolitik ansatzweise prognostiziert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Bildungspolitik
- Ziele der Bildungspolitik
- Die rechtlichen Grundlagen der europäischen Bildungspolitik bis zum Vertrag von Maastricht
- Der Europäische Gerichtshof im Kontext der Bildungspolitik
- Die Europäische Bildungspolitik nach Maastricht
- Die Bundesrepublik Deutschland als Akteur der Bildungspolitik
- Strukturelle Bedingungen der EU-Bildungspolitik
- Der Europäische Rat
- Rat der Europäischen Union (Ministerrat)
- Kommission der Europäischen Union
- Das Europäische Parlament
- Instrumente der EU-Bildungspolitik
- Ebenen der Internationalisierung von Bildung
- Die Methode der offenen Koordinierung als neue Steuerungsform in der Bildungspolitik
- Der Wandel des Nationalstaates – Internationalisierung zur Stärkung der nationalen Exekutive
- Die Europäische Dimension am Beispiel des Projekts „Lebenslanges Lernen 2010“
- Die Entwicklung der Bildungsprogramme 2000 – 2006
- Das Programm „Lebenslanges Lernen 2007 - 2013“
- Das Comenius-Programm
- Das Erasmus-Programm
- Das Programm Leonardo da Vinci
- Grundtvig-Programm
- Die supplementären Programme „Querschnittsprogramm“ und „Jean Monnet“
- Finanzierung des Programms des Lebenslangen Lernens 2007 – 2013
- Der EU-Haushalt und die politischen Handlungsspielräume der Mitgliedsstaaten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle der Europäischen Union in der Bildungspolitik, insbesondere im Kontext des kooperativen Föderalismus in Deutschland. Sie beleuchtet die rechtlichen Grundlagen und strukturellen Bedingungen europäischer Bildungspolitik, analysiert die Instrumente der EU und untersucht die Auswirkungen der Internationalisierung auf den Nationalstaat. Der Fokus liegt auf der "offenen Koordinierungsmethode" und dem Programm "Lebenslanges Lernen 2007-2013" als Beispiel für europäische Bildungspolitik.
- Rechtliche Grundlagen und Kompetenzen der EU in der Bildungspolitik
- Strukturelle Bedingungen und Akteure der EU-Bildungspolitik
- Die "offene Koordinierungsmethode" als Steuerungsinstrument
- Auswirkungen der Internationalisierung auf den Nationalstaat
- Das Programm "Lebenslanges Lernen 2007-2013" als Fallbeispiel
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort beschreibt den wachsenden Einfluss supranationaler und internationaler Akteure auf die nationale Bildungspolitik, insbesondere die EU und die OECD. Es hebt den scheinbaren Widerspruch zwischen der traditionellen nationalen Zuständigkeit für Bildung und dem zunehmenden Einfluss internationaler Organisationen hervor und kündigt die Untersuchung der Kompetenzen der EU in diesem Bereich sowie der strukturellen Bedingungen für eine effektive europäische Bildungspolitik an. Die Arbeit fokussiert auf neue Steuerungsmechanismen und die Folgen der Internationalisierung für den Nationalstaat, wobei das Programm "Lebenslanges Lernen 2007-2013" als Fallbeispiel dient.
Bildungspolitik: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Bildungspolitik aus pädagogischer und politikwissenschaftlicher Perspektive. Es betont die Komplexität und die vielfältigen Herangehensweisen an dieses Politikfeld. Die Interdependenzen zwischen Bildungspolitik und anderen Politikbereichen wie Sozial-, Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik werden herausgestellt, wobei Bildungspolitik als elementarer Bestandteil nationalstaatlicher Politik dargestellt wird. Die Ziele der Bildungspolitik werden definiert als Gewährleistung von Arbeitsmarkterträgen, Vermittlung von Wissenskompetenzen und Vorbereitung auf den Arbeitsmarkteintritt. Das ökonomische Nutzenkalkül wird als wichtiger Faktor in der Bildungspolitik identifiziert, was zu einer Internationalisierung der Bildungspolitik führt, um wettbewerbsfähiges Personal zu sichern. Das Leitbild "Bildung als wirtschaftlicher Erfolgsfaktor" wird auch von der EU übernommen, wie in der Lissabon-Strategie deutlich wird.
Die rechtlichen Grundlagen der europäischen Bildungspolitik bis zum Vertrag von Maastricht: Dieses Kapitel beleuchtet die traditionell nationale Zuständigkeit für Bildungspolitik und die damit verbundene Funktion der "Sicherung der nationalstaatlichen Gemeinsamkeit". Es setzt den Rahmen für die spätere Diskussion über die Entwicklung und den Ausbau der europäischen Kompetenzen in der Bildungspolitik.
Der Europäische Gerichtshof im Kontext der Bildungspolitik: Dieses Kapitel wird sich mit der Rolle des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) im Bereich der Bildungspolitik auseinandersetzen, seine Entscheidungen und deren Auswirkungen auf die nationale Gesetzgebung analysieren.
Die Europäische Bildungspolitik nach Maastricht: Hier wird die Entwicklung der europäischen Bildungspolitik nach dem Vertrag von Maastricht untersucht. Die Kompetenzen der EU, die Rechtsgrundlagen und die konkreten Maßnahmen zur europäischen Bildungspolitik werden hier ausführlich behandelt.
Die Bundesrepublik Deutschland als Akteur der Bildungspolitik: Dieses Kapitel analysiert die Rolle Deutschlands innerhalb der europäischen Bildungspolitik, unter Berücksichtigung des deutschen kooperativen Föderalismus und der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern.
Strukturelle Bedingungen der EU-Bildungspolitik: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Akteure und Institutionen innerhalb der EU-Bildungspolitik, darunter der Europäische Rat, der Rat der Europäischen Union (Ministerrat), die Kommission der Europäischen Union und das Europäische Parlament. Es untersucht ihre jeweiligen Rollen, Kompetenzen und Einflussmöglichkeiten auf die Gestaltung der europäischen Bildungspolitik.
Instrumente der EU-Bildungspolitik: Hier werden die verschiedenen Instrumente der EU-Bildungspolitik analysiert, mit denen die EU ihre Ziele in der Bildungspolitik zu erreichen versucht. Dies kann z.B. die Bereitstellung von Finanzmitteln, die Förderung von Projekten, die Entwicklung von Standards und Leitlinien und die Koordinierung der nationalen Bildungspolitiken umfassen.
Ebenen der Internationalisierung von Bildung: Dieses Kapitel wird sich mit den verschiedenen Ebenen der Internationalisierung von Bildung befassen, angefangen von der bilateralen Zusammenarbeit bis hin zur supranationalen Kooperation innerhalb der EU und globalen Organisationen.
Die Methode der offenen Koordinierung als neue Steuerungsform in der Bildungspolitik: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die "offene Koordinierungsmethode" als ein wichtiges Steuerungsinstrument der EU-Bildungspolitik. Es untersucht ihre Funktionsweise, ihre Stärken und Schwächen und ihre Bedeutung für die Harmonisierung der Bildungspolitiken in Europa.
Der Wandel des Nationalstaates – Internationalisierung zur Stärkung der nationalen Exekutive: Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen der Internationalisierung der Bildungspolitik auf den Nationalstaat und untersucht, inwieweit diese Internationalisierung zu einem Wandel des Nationalstaates führt.
Die Europäische Dimension am Beispiel des Projekts „Lebenslanges Lernen 2010“: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung der europäischen Bildungsprogramme bis 2010 und analysiert deren Ziele, Strategien und Erfolge. Es dient als Fallbeispiel für die Analyse der europäischen Bildungspolitik.
Das Programm „Lebenslanges Lernen 2007 - 2013“: Dieses Kapitel analysiert das Programm "Lebenslanges Lernen 2007-2013" im Detail, beschreibt die verschiedenen Teilprogramme (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Querschnittsprogramm und Jean Monnet) und untersucht deren jeweilige Ziele und Wirkungen.
Finanzierung des Programms des Lebenslangen Lernens 2007 – 2013: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Finanzierung des Programms "Lebenslanges Lernen 2007-2013", analysiert die Finanzierungsmechanismen und die politischen Handlungsspielräume der Mitgliedstaaten.
Der EU-Haushalt und die politischen Handlungsspielräume der Mitgliedsstaaten: Dieses Kapitel beschreibt den EU-Haushalt und seine Bedeutung für die Bildungspolitik, sowie die damit verbundenen politischen Handlungsspielräume der Mitgliedsstaaten.
Schlüsselwörter
Europäische Bildungspolitik, Kooperativer Föderalismus, Internationalisierung, Lebenslanges Lernen, Offene Koordinierungsmethode, EU-Kompetenzen, Nationalstaat, Bologna-Prozess, OECD, PISA-Studien, Humankapital, Lissabon-Strategie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument "Europäische Bildungspolitik"
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Das Dokument befasst sich umfassend mit der Europäischen Bildungspolitik, insbesondere ihrer Entwicklung, rechtlichen Grundlagen, institutionellen Strukturen und Auswirkungen auf den Nationalstaat, speziell Deutschland im Kontext des kooperativen Föderalismus. Es analysiert die Rolle der EU in der Bildungspolitik, untersucht Steuerungsmechanismen wie die offene Koordinierungsmethode und beleuchtet das Programm „Lebenslanges Lernen“ als Fallbeispiel.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt eine breite Palette an Themen, darunter die rechtlichen Grundlagen der europäischen Bildungspolitik (bis hin zum Vertrag von Maastricht und danach), die Rolle des Europäischen Gerichtshofs, die strukturellen Bedingungen (Europäischer Rat, Ministerrat, Kommission, Parlament), die Instrumente der EU-Bildungspolitik, die Internationalisierung von Bildung, die offene Koordinierungsmethode, den Wandel des Nationalstaates, das Programm „Lebenslanges Lernen 2007-2013“ (inkl. Teilprogramme wie Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig), die Finanzierung des Programms und die Handlungsspielräume der Mitgliedsstaaten. Der Fokus liegt auf dem Zusammenspiel zwischen nationaler und europäischer Ebene im Bildungsbereich.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in Kapitel zu folgenden Themen: Vorwort, Bildungspolitik (inkl. Ziele), Rechtliche Grundlagen bis Maastricht, Europäischer Gerichtshof, Europäische Bildungspolitik nach Maastricht, Deutschland als Akteur, Strukturelle Bedingungen der EU-Bildungspolitik, Instrumente der EU-Bildungspolitik, Ebenen der Internationalisierung, Offene Koordinierungsmethode, Wandel des Nationalstaates, Lebenslanges Lernen 2010, Lebenslanges Lernen 2007-2013 (inkl. Teilprogramme und Finanzierung), EU-Haushalt und Handlungsspielräume der Mitgliedsstaaten.
Was ist die Zielsetzung des Dokuments?
Die Arbeit untersucht die Rolle der Europäischen Union in der Bildungspolitik im Kontext des kooperativen Föderalismus in Deutschland. Sie beleuchtet die rechtlichen Grundlagen und strukturellen Bedingungen, analysiert die Instrumente der EU und die Auswirkungen der Internationalisierung auf den Nationalstaat. Der Schwerpunkt liegt auf der offenen Koordinierungsmethode und dem Programm „Lebenslanges Lernen 2007-2013“ als Beispiel für europäische Bildungspolitik.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für das Dokument?
Schlüsselbegriffe sind: Europäische Bildungspolitik, Kooperativer Föderalismus, Internationalisierung, Lebenslanges Lernen, Offene Koordinierungsmethode, EU-Kompetenzen, Nationalstaat, Bologna-Prozess, OECD, PISA-Studien, Humankapital, Lissabon-Strategie.
Wie ist das Programm „Lebenslanges Lernen 2007-2013“ im Dokument behandelt?
Das Programm „Lebenslanges Lernen 2007-2013“ wird als zentrales Fallbeispiel analysiert. Es werden die verschiedenen Teilprogramme (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Querschnittsprogramm und Jean Monnet) detailliert beschrieben, ihre Ziele und Wirkungen untersucht und die Finanzierung des Programms beleuchtet.
Welche Rolle spielt die „Offene Koordinierungsmethode“?
Die „offene Koordinierungsmethode“ wird als wichtiges Steuerungsinstrument der EU-Bildungspolitik analysiert. Ihre Funktionsweise, Stärken, Schwächen und Bedeutung für die Harmonisierung der Bildungspolitiken in Europa werden untersucht.
Wie wird der Einfluss der Internationalisierung auf den Nationalstaat betrachtet?
Das Dokument analysiert die Auswirkungen der Internationalisierung der Bildungspolitik auf den Nationalstaat und untersucht, inwieweit diese Internationalisierung zu einem Wandel des Nationalstaates führt, insbesondere im Hinblick auf die Kompetenzverteilung und die Gestaltung der Bildungspolitik.
Welche Zusammenfassung der Kapitel bietet das Dokument?
Das Dokument enthält eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels, die die wichtigsten Inhalte und Ergebnisse jedes Abschnitts zusammenfasst.
- Quote paper
- Sebastian Schweizer (Author), 2007, Bildungspolitik in Mehrebenensystemen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/145196