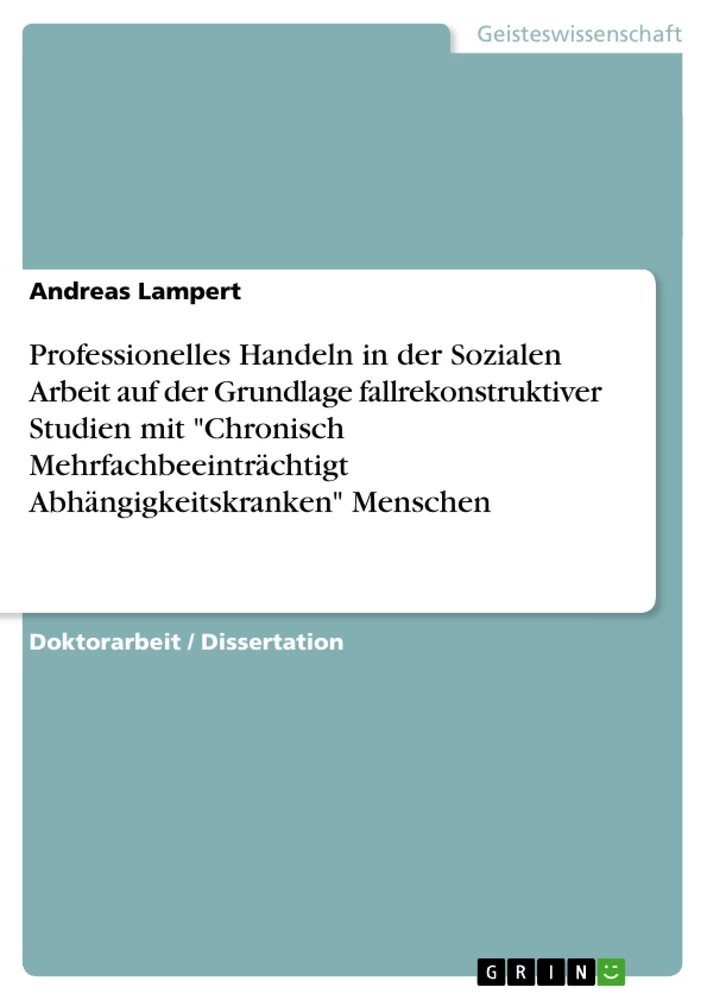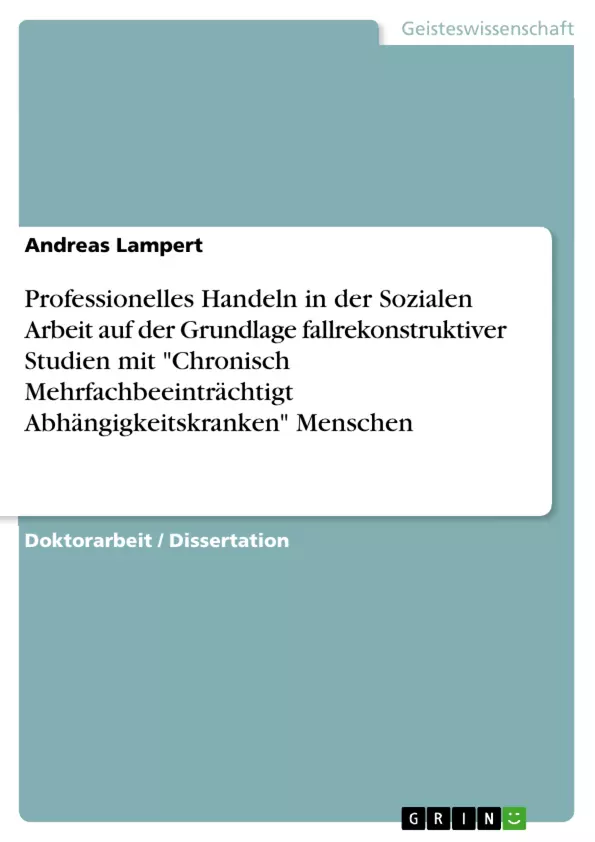Suchterkrankungen gelten als gesellschaftliches Problem. Sie verursachen hohe volkswirtschaftliche Kosten und individuelles Leid. In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass Menschen ihre soziale Wirklichkeit in Handlungsprozessen hervorbringen. Auf dieser Grundlage wird die Entwicklungsgeschichte der "Sucht" als gesellschaftliches Problem und Erkrankung von der Antike bis in die Gegenwart nachgezeichnet und in kulturelle Prozesse eingebettet.
Am Beispiel von zwei "Chronisch Mehrfachbeeinträchtigt Abhängigkeitskranken" wird die Entstehung und Festigung "süchtiger Muster" über drei Generationen hinweg rekonstruiert und im Kontext gesellschaftlicher Prozesse wie Krieg und Vertreibung dargestellt.
Moderne Gesellschaften übertragen die Behandlung ihrer sozialen Probleme an die Soziale Arbeit. Sie verbinden damit die Forderung nach effizienten Lösungsansätzen und die nachhaltige Verbesserung problematischer Lebenslagen.
Ist professionelles Handeln in der Sozialen Arbeit vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Rechtfertigungszwänge und bürokratischer Regeln möglich?
In dieser Arbeit wird ein Lösungsansatz für professionelles Handeln in der Sozialen Arbeit zwischen gesellschaftlichem Mandat und der direkten Zusammenarbeit mit den Klienten entwickelt.
Inhaltsverzeichnis
- DANKSAGUNGEN.
- 1 EINLEITUNG
- VORWORT.
- GESELLSCHAFTLICHE RELEVANZ DES THEMAS
- KONSTRUKTION DER SOZIALWISSENSCHAFTLICHEN FRAGESTELLUNGEN.
- REFLEXION DES ERKENNTNISTHEORETISCHEN HINTERGRUNDES
- AUFBAU DER ARBEIT..
- 2 DAS FALLREKONSTRUKTIVE FORSCHUNGSDESIGN..
- 2.1 BEGRÜNDUNG DER FALLREKONSTRUKTIVEN METHODENWAHL.
- 2.2 FALLREKONSTRUKTIVE FORSCHUNG IM STIL DER GROUNDED THEORY
- 2.2.1 Methodologischer Standpunkt.......
- 2.2.2 Der Theoriebildungsprozess im Stil der Grounded Theory...\n
- 2.3 FALLREKONSTRUKTIVE FORSCHUNG IM STIL DER OBJEKTIVEN HERMENEUTIK
- 2.3.1 Lebenspraxis als autonome Einheit.
- 2.3.2 Rekonstruktion generativer Regeln des Phänomens „CMA“..\n
- 2.3.3 Das fallrekonstruktive Verfahren der Sequenzanalyse.\n
- 2.3.4 Der fallrekonstruktive Forschungsprozess......
- 3 REKONSTRUKTION DER SUCHT ALS GESELLSCHAFTLICHES PROBLEM...................
- 3.1 ALKOHOLKONSUM IM SPIEGEL DER GESELLSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG
- 3.1.1 Rekonstruktion des Alkoholkonsums in der Antike.\n
- 3.1.2 Rekonstruktion des Umgangs mit Alkohol in der Neuzeit..\n
- 3.1.3 Rekonstruktion der Alkoholkonsummuster in der Moderne.\n
- 3.1.4 Rekonstruktion der Konsummuster im Mittelalter.\n
- 3.2 REKONSTRUKTION DER GESELLSCHAFTLICHEN DEFINITION DES TRINKENS ALS\nSUCHTKRANKHEIT
- 3.2.1 Die Medikalisierung des sozialen Trinkproblems
- 3.2.2 Konstruktion der Suchtkrankheit in therapeutischen Modellen
- 3.2.2.1 Konstruktion der Suchtkrankheit im psychoanalytischen Modell.\n
- 3.2.2.2 Konstruktion der Suchtkrankheit im transaktionsanalytischen Modell.\n
- 3.2.2.3 Konstruktion der Suchtkrankheit im verhaltenstherapeutischen Modell.\n
- 3.2.2.4 Konstruktion der Suchtkrankheit im sozial-kognitiven Rückfallmodell
- 3.2.2.5 Konstruktion der Suchtkrankheit im systemischen Modell.\n
- 3.2.2.6 Konstruktion der Suchtkrankheit im biologischen Modell.\n
- 3.2.2.7 Fazit..\n
- 3.2.3 Rekonstruktion konstitutiver Bedingungen des Suchtbegriffs.\n
- 3.2.4 Rekonstruktion der Sucht im Kontext soziologischer Theorien...\n
- 3.3 RESUMEE
- 3.1 ALKOHOLKONSUM IM SPIEGEL DER GESELLSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG
- 4 REKONSTRUKTION DES KONZEPTES „CMA“
- 4.1 REKONSTRUKTION DER BEGRIFFSBILDUNG.
- 4.1.1 Rekonstruktion definitorischer Ebenen des Phänomens ,,CMA“..\n
- 4.1.1.1 Die Studie der Arbeitsgruppe „Chronisch Mehrfachbeeinträchtigt Abhängigkeitskrank“.\n
- 4.1.1.2 Die Studie der Arbeitsgruppe „Chronisch Mehrfachgeschädigte Abhängigkeitskranke“ ..
- 4.1.2 Diskussion der Ergebnisse der „CMA“ Studien.
- 4.1.1 Rekonstruktion definitorischer Ebenen des Phänomens ,,CMA“..\n
- 4.2 FACETTEN DER SOZIALEN KONSTRUKTION LANGWIERIGER ERKRANKUNGEN
- 4.2.1 Zur Problematik des Chronischen an der Sucht..\n
- 4.2.2 Definitorische Ebenen der chronischen Suchtkrankheit.......
- 4.2.2.1 Individuenzentrierte und substanzbasierte Konstruktionen chronischer Suchtkrankheit
- 4.2.2.1.1 Konstruktion der chronischen Krankheit im Kontext medizinisch-\ndiagnostischer Kriterien…....
- 4.2.2.1.2 Konstruktion der chronischen Suchtkrankheit in psychodynamischen Modellen
- 4.2.2.1.3 Konstruktion der chronischen Suchtkrankheit in biologischen Modellen ......
- 4.2.2.2 Konstruktion der chronischen Suchtkrankheit in interaktionistischen Modellen...........
- 4.2.2.2.1 Konstruktion der chronischen Suchtkrankheit unter soziologisch\nerkenntnistheoretischen Prämissen....
- 4.2.2.2.2 Konstruktion der chronischen Suchtkrankheit als Deutungsproblem.…......
- 4.2.2.2.3 Konstruktion der chronischen Suchtkrankheit als Autonomieparadoxie.....
- 4.2.2.2.4 Konstruktion der chronischen Suchtkrankheit im Kontext sozialer Systeme..
- 4.2.2.2.5 Die Konstruktion der chronischen Suchtkrankheit in Suchtkrankenerzählungen
- 4.2.2.2.6 Konstruktion der chronischen Suchtkrankheit im Therapieprozess..\n
- 4.2.2.1 Individuenzentrierte und substanzbasierte Konstruktionen chronischer Suchtkrankheit
- 4.3 DATENERHEBUNG
- 4.3.1 Auswahl der Datenträger.\n
- 4.3.2 Das narrative Interview.
- 4.3.2.1 Die Konstruktion narrativer Identität.\n
- 4.3.2.2 Der Aufbau narrativer Erzählungen.\n
- 4.3.3 Die Fixierung flüchtiger sozialer Daten.\n
- 5 FALLREKONSTRUKTIONEN.
- 5.1 DER FALL,,JENS KUSELKA“.
- 5.1.1 Die Großeltern väterlicherseits
- 5.1.2 Die Großeltern mütterlicherseits
- 5.1.2.1 Die Konstruktion der Zugehörigkeitsparadoxie in Johannas Partnerschaft
- 5.1.2.2 Das Scheitern der Familienbildung bei prekärer Partnerschaft..\n
- 5.1.2.3 Bewältigungsstrategien von Statusübergängen
- 5.1.2.4 Die Familienstruktur im Spannungsbogen zwischen Nähe und Distanz..\n
- 5.1.2.5 Gabrielas Entwicklung unter den Bedingungen diffuser Familienstrukturen
- 5.1.2.6 Bewältigungsbestrebungen familialer Strukturschwächen .\n
- 5.1.2.7 Konsequenzen der Entwicklungsbedingungen des desintegrierten Familienmilieus
- 5.1.2.8 Zusammenfassung .....
- 5.1.3 Gabrielas Entwicklung zwischen Wandel und Reproduktion
- 5.2 DIE FAMILIENSTRUKTUR VON ANTON UND GABRIELA KUSELKA.
- 5.2.1 Ehejahre........
- 5.2.2 Das zentrifugal rotierende Familienmilieu.....
- 5.2.3 Die Reproduktionen familialer Sinnzusammenhänge in intergenerationeller Perspektive.\n
- 5.2.4 Das familiale Herkunftsmilieu Anita Thiels
- 5.3 DER ZUSAMMENHANG ZWISCHEN ALKOHOLISMUS UND FAMILIENSTRUKTUR..
- 5.3.1 Narzissmus und die Bedingungen der Sozialstruktur.\n
- 5.3.1.1 Rekonstruktion des Trinkens als Kompensationsleistung..\n
- 5.3.1.2 Rekonstruktion der Bedeutung des Trinkens im Dialog.\n
- 5.3.1.3 Rekonstruktion der Bedeutung des Trinkens im Dialog zwischen den Generationen..
- 5.3.2 Zwischen partikularistischen und universalistischen Perspektiven
- 5.3.2.1 Die Bedeutung der Substanz im Dialog…………………….\n
- 5.3.2.2 Rekonstruktion der Trinksemantik Jens Kuselkas
- 5.3.1 Narzissmus und die Bedingungen der Sozialstruktur.\n
- 5.1 DER FALL,,JENS KUSELKA“.
- Rekonstruktion der gesellschaftlichen Entwicklung des Alkoholkonsums und seiner Definition als Suchtkrankheit
- Analyse der Entstehung und Verwendung des Begriffs "CMA" im Kontext der Suchtkrankenbehandlung
- Entwicklung eines fallrekonstruktiven Ansatzes zur Untersuchung der Lebenswelt und den Herausforderungen von CMA-Patienten
- Diskussion professioneller Handlungsansätze in der Sozialen Arbeit mit CMA-Patienten unter Berücksichtigung der ermittelten Erkenntnisse
- Plädoyer für eine fallrekonstruktive, professionelle Herangehensweise in der Sozialen Arbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Dissertation befasst sich mit dem professionellen Handeln in der Sozialen Arbeit mit "Chronisch Mehrfachbeeinträchtigt Abhängigkeitskranken" (CMA) und untersucht die Entstehung und Relevanz dieses Begriffs im Kontext der Suchtkrankheitsentwicklung. Der Fokus liegt auf der Rekonstruktion des Prozesses, durch den Alkoholkonsum von einem sozialen Phänomen zu einer behandlungsbedürftigen Suchtkrankheit wurde und wie diese Entwicklung den Umgang mit CMA-Patienten beeinflusst.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die gesellschaftliche Relevanz des Themas CMA, die Forschungsfrage und die methodischen Grundlagen der Arbeit beleuchtet. Kapitel 2 erläutert das fallrekonstruktive Forschungsdesign, das sich auf die Grounded Theory und die Objektive Hermeneutik stützt. Kapitel 3 geht der Rekonstruktion der Sucht als gesellschaftliches Problem nach, wobei die historische Entwicklung des Alkoholkonsums und die Entstehung des Suchtbegriffs im Laufe der Zeit analysiert werden. Kapitel 4 befasst sich mit der Rekonstruktion des Begriffs „CMA“ und den verschiedenen Facetten seiner Definition. Kapitel 5 stellt die Ergebnisse der Fallrekonstruktionen vor, die einen detaillierten Einblick in die Lebenswelt und die Familienstrukturen von CMA-Patienten geben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themenfeldern Soziale Arbeit, Suchtkrankheit, Chronisch Mehrfachbeeinträchtigt Abhängigkeitskrank (CMA), Fallrekonstruktion, Objektive Hermeneutik, Grounded Theory, Alkoholkonsum, Soziale Konstruktion, Lebenswelt, Familienstrukturen, Professionelles Handeln.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet die Abkürzung „CMA“ in der Sozialen Arbeit?
CMA steht für „Chronisch Mehrfachbeeinträchtigt Abhängigkeitskranke“. Es beschreibt Menschen, deren Suchterkrankung zu dauerhaften körperlichen, psychischen und sozialen Schäden geführt hat.
Wie hat sich die gesellschaftliche Wahrnehmung von Alkoholismus gewandelt?
Die Arbeit rekonstruiert den Weg vom sozialen Trinkproblem in der Antike bis hin zur modernen Medikalisierung und Definition als anerkannte Suchtkrankheit.
Welche Rolle spielen Familienstrukturen bei Suchterkrankungen?
Anhand von Fallrekonstruktionen wird gezeigt, wie sich „süchtige Muster“ über Generationen hinweg, oft beeinflusst durch traumatische Ereignisse wie Krieg, festigen können.
Was ist das Ziel professionellen Handelns in der Suchthilfe?
Ziel ist die nachhaltige Verbesserung der Lebenslage der Klienten durch einen Ansatz, der zwischen bürokratischen Regeln und individueller Fallarbeit vermittelt.
Warum ist die „Objektive Hermeneutik“ für diese Studie wichtig?
Diese Methode erlaubt es, die unbewussten Regeln und Sinnzusammenhänge in der Lebenspraxis der Betroffenen durch detaillierte Textanalysen zu entschlüsseln.
- 4.1 REKONSTRUKTION DER BEGRIFFSBILDUNG.
- Quote paper
- Andreas Lampert (Author), 2009, Professionelles Handeln in der Sozialen Arbeit auf der Grundlage fallrekonstruktiver Studien mit "Chronisch Mehrfachbeeinträchtigt Abhängigkeitskranken" Menschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/145539