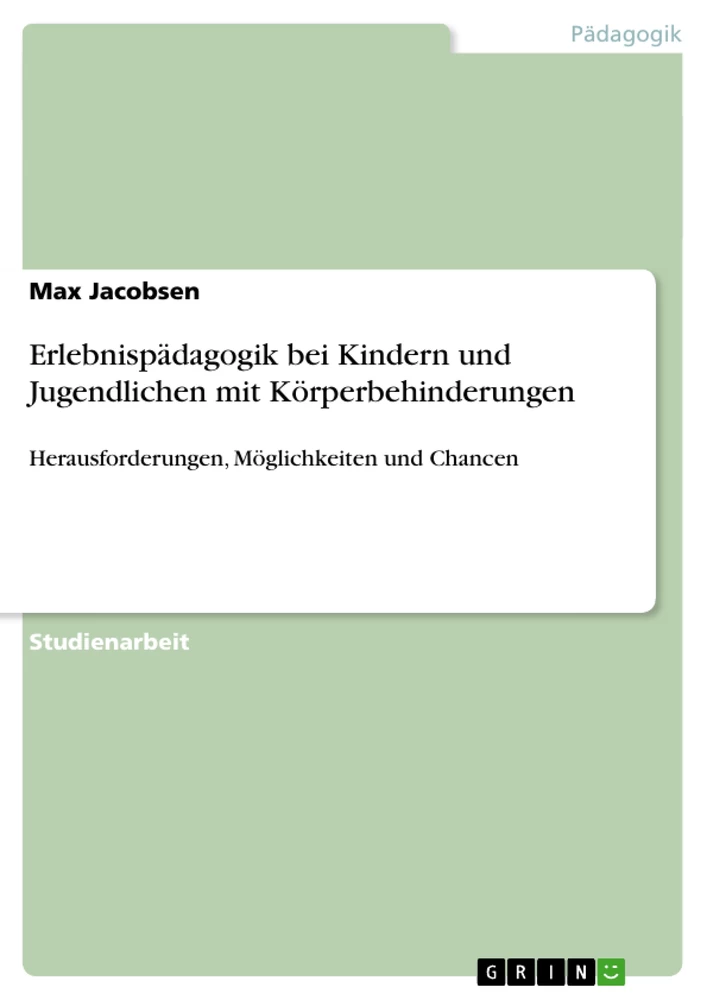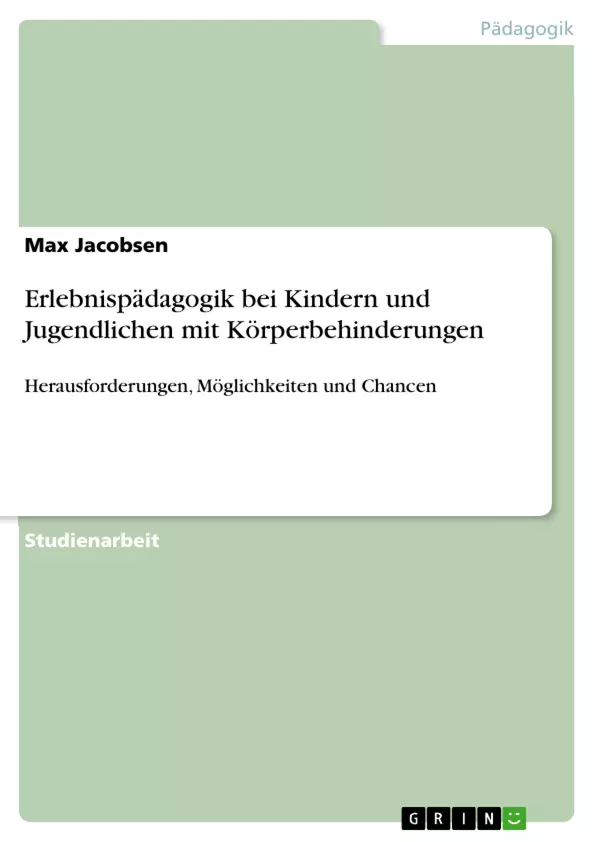Einleitende Gedanken
Der Freiraum, den man braucht, um Dinge auszuprobieren, um etwas zu riskieren, um an seine Grenzen zu gehen, wird immer enger: Zum einen haben sich die ökologischen Rahmenbedingungen dahingehend geändert, dass es besonders in der Stadt, aber auch auf dem Land kaum noch natürliche Spielräume gibt. Viele Betätigungs- und Erlebnismöglichkeiten entfallen, die früher selbstverständlich waren. Weiterhin ersetzen heute Erfahrungen aus zweiter Hand die unmittelbaren Erlebnisse. Die Medien vermitteln Ersatzerlebnisse, die keine unmittelbare gefühls-mäßige Anteilname erlauben. Sie verleiten zu einer Konsumhaltung, in der man nur noch passiv aufnimmt, was jedoch das Grundbedürfnis nach echten Erlebnissen und Erfahrungen nicht befriedigen kann. Dazu kommt, dass schulische Erziehung und Bildung weitgehend durch intellektuelles Lernen bestimmt sind. Unmittelbares Tätigsein und authentische Erlebnisse kommen auch hier zu kurz (vgl. FATKE 1993, 38ff).
Auf diese und weitere Probleme will die Erlebnispädagogik eine Antwort geben. In dieser Arbeit soll untersucht werden, was ihre Ziele sind, wie sie diese erreicht und ob Erlebnispädagogik auch mit Kindern und Jugendlichen mit einer Körperbehinderung möglich ist – welche Herausforderungen sie verursacht, wie weit ihre Möglichkeiten gehen und welche Chancen sie bietet...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Gedanken
- Zur Geschichte der Erlebnispädagogik
- Was ist Erlebnispädagogik?
- Körperbehinderung und ihre Auswirkungen
- Behinderung und Erlebnispädagogik
- Erlebnispädagogik bei Kindern und Jugendlichen mit Körperbehinderungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Anwendung von Erlebnispädagogik bei Kindern und Jugendlichen mit Körperbehinderungen. Sie beleuchtet die Herausforderungen, Möglichkeiten und Chancen, die diese pädagogische Methode in diesem Kontext bietet. Die Arbeit analysiert die Geschichte der Erlebnispädagogik, definiert ihren Kern und beleuchtet die Auswirkungen von Körperbehinderungen auf das Leben von Kindern und Jugendlichen.
- Die Geschichte der Erlebnispädagogik und ihre Wurzeln in der Reformpädagogik
- Die Definition und Ziele der Erlebnispädagogik als ganzheitlicher Erziehungsansatz
- Die Auswirkungen von Körperbehinderung auf Kinder und Jugendliche und die Relevanz von Erlebnispädagogik in diesem Kontext
- Die Herausforderungen, die sich bei der Anwendung von Erlebnispädagogik für Kinder und Jugendliche mit Körperbehinderungen ergeben
- Die Möglichkeiten und Chancen, die Erlebnispädagogik in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit Körperbehinderungen bietet
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitende Gedanken: Die Einleitung stellt die Problematik der Erlebnisarmut in der heutigen Gesellschaft dar und erklärt, warum Erlebnispädagogik eine Antwort darauf sein kann. Sie stellt die zentrale Frage nach der Anwendbarkeit von Erlebnispädagogik bei Kindern und Jugendlichen mit Körperbehinderungen.
- Zur Geschichte der Erlebnispädagogik: Dieses Kapitel beleuchtet die historischen Wurzeln der Erlebnispädagogik, beginnend bei Jean-Jacques Rousseau und den Reformpädagogen bis hin zu Kurt Hahn, der als Urvater der modernen Erlebnispädagogik gilt. Es beschreibt die Entwicklung der Erlebnispädagogik von den frühen Anfängen bis hin zur heutigen Definition.
- Was ist Erlebnispädagogik?: Dieses Kapitel definiert die Erlebnispädagogik als handlungsorientierte Methode, die junge Menschen durch exemplarische Lernprozesse in ihrer Persönlichkeitsentwicklung fördern will. Es erklärt, wie Erlebnispädagogik ganzheitlich verstanden wird und welche Bedeutung das Konzept des „Erlebens“ in diesem Zusammenhang hat.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Erlebnispädagogik, Körperbehinderung, Inklusion, Ganzheitlichkeit, Herausforderung, Möglichkeit, Chance, Reformpädagogik, Lernprozess, Persönlichkeitsentwicklung, Handlungsorientierung, Erfahrungslernen, Selbsttätigkeit, Gemeinschaft, Naturerfahrung, sozial-emotionale Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Erlebnispädagogik?
Erlebnispädagogik ist ein handlungsorientierter Erziehungsansatz, der durch unmittelbare Erfahrungen und Herausforderungen in der Natur oder Gemeinschaft die Persönlichkeitsentwicklung fördern will.
Ist Erlebnispädagogik für Menschen mit Körperbehinderung geeignet?
Ja, die Arbeit untersucht, wie diese Methode trotz körperlicher Einschränkungen Chancen zur Selbstwirksamkeit und sozialen Inklusion bietet.
Wer gilt als "Urvater" der modernen Erlebnispädagogik?
Kurt Hahn wird als maßgeblicher Begründer der modernen Erlebnispädagogik angesehen, mit Wurzeln in der Reformpädagogik.
Welche Probleme der heutigen Gesellschaft will die Erlebnispädagogik lösen?
Sie reagiert auf Erlebnisarmut, den Verlust natürlicher Spielräume und die Dominanz von "Erfahrungen aus zweiter Hand" durch Medienkonsum.
Welche Ziele verfolgt dieser pädagogische Ansatz?
Ziele sind unter anderem die Förderung von Selbstständigkeit, Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und das Kennenlernen eigener Grenzen.
- Quote paper
- Max Jacobsen (Author), 2010, Erlebnispädagogik bei Kindern und Jugendlichen mit Körperbehinderungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/145615