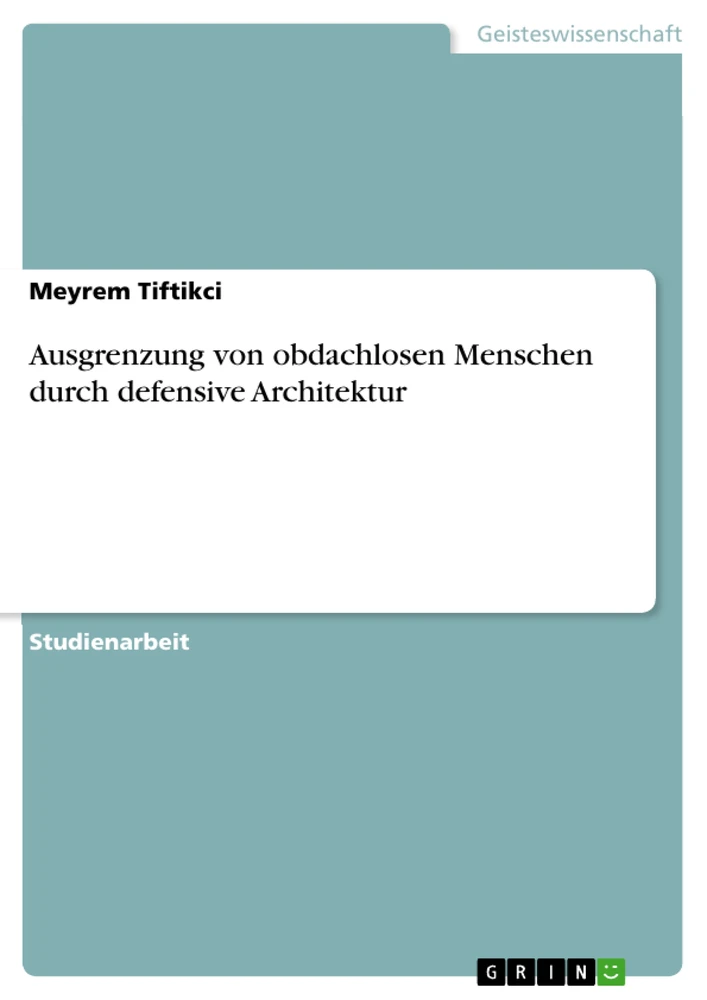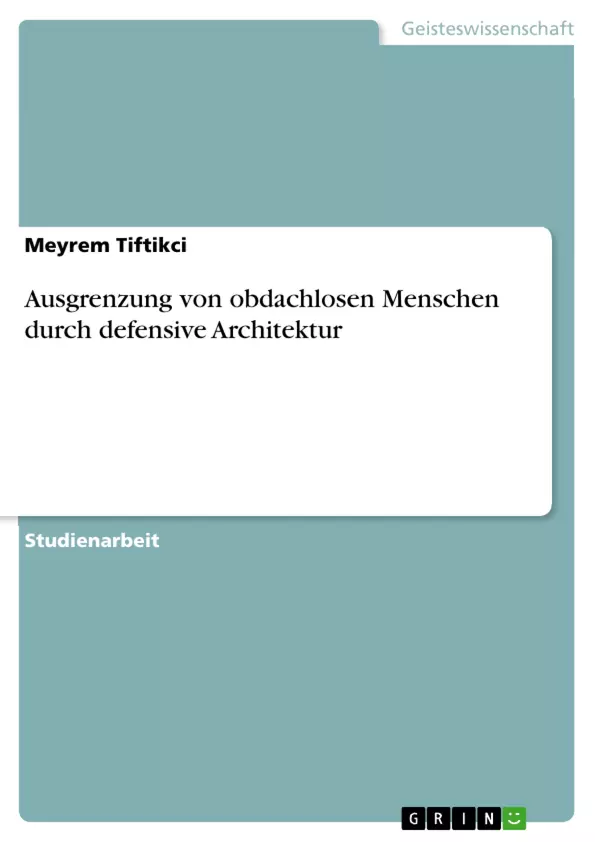Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Platz von obdachlosen Menschen in der Gesellschaft, insbesondere mit Fokus auf Ausgrenzung durch Architektur. Wohnungs- und obdachlose Menschen teilen miteinander stets die gesellschaftliche Ausgrenzung, der sie alle ausgesetzt sind. Sie werden vom Rest der Gesellschaft abgewertet und stigmatisiert. Ihnen werden Attribute wie asozial, arbeitsscheu oder schmutzig zugeschrieben. Diese Vorurteile haben sich so sehr in der Bevölkerung verfestigt, dass auch die städtische Gestaltung sich gegen sie richtet. Politik und Medien verstärken die Feindseligkeit, die sich stets gegen diese Menschengruppe richtet. Mit Blick auf die soziale und demokratische Entwicklung Deutschlands stellt sich hier die Frage, wie sehr Menschen ohne feste Unterkunft tatsächlich durch defensive architektonische Strukturen in Städten ausgegrenzt werden, wie diese strukturellen Merkmale die Denkweise der generellen Gesellschaft beeinflussen und was durch soziale und pädagogische Arbeit dagegen getan werden kann. Welche Formen der materiell geformten Ausgrenzung gibt es in Deutschland und wie kann stigmatisierendes Denken verändert werden?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Vorbetrachtung
- 2.1 Wer gilt als obdachlos?
- 2.2 Wohnungslosigkeit in Deutschland
- 2.3 Wohnungslosenhilfe in Deutschland
- 3. Obdachlosenfeindlichkeit
- 4. Öffentlicher Raum
- 4.1 Was ist „Öffentlicher Raum“?
- 4.2 Nutzung des öffentlichen Raums durch obdachlose Menschen
- 5. Soziale Verdrängung durch defensive Architektur/Hostile Design
- 6. Politische Perspektive
- 7. Pädagogischer Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Phänomen der defensiven Architektur und ihrer Auswirkungen auf obdachlose Menschen in Deutschland. Sie untersucht, wie architektonische Gestaltungselemente dazu beitragen können, obdachlose Menschen aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen und wie sich diese Strukturen auf das gesellschaftliche Denken und Handeln auswirken. Die Arbeit beleuchtet dabei die spezifischen Herausforderungen, denen obdachlose Menschen in Deutschland gegenüberstehen, und wie die Politik und die Gesellschaft dazu beitragen können, die Situation zu verbessern.
- Definition des Begriffs „obdachlos“ und Beschreibung der Situation von Wohnungslosigkeit in Deutschland
- Analyse der Stigmatisierung und Ausgrenzung von obdachlosen Menschen
- Untersuchung der Rolle des öffentlichen Raums und der Nutzung durch Obdachlose
- Erläuterung der Funktionsweise und der Folgen von defensiver Architektur
- Bewertung der politischen und pädagogischen Ansätze zur Bewältigung der Thematik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor und beleuchtet den Zusammenhang zwischen Obdachlosigkeit, defensiver Architektur und gesellschaftlicher Ausgrenzung. Kapitel 2 liefert eine theoretische Grundlage, indem es den Begriff „obdachlos“ definiert, die Situation von Wohnungslosigkeit in Deutschland beschreibt und auf die Wohnungslosenhilfe eingeht. Kapitel 3 betrachtet das Phänomen der Obdachlosenfeindlichkeit und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen. Kapitel 4 untersucht den öffentlichen Raum und die Nutzung durch obdachlose Menschen. Kapitel 5 analysiert die Funktionsweise und Folgen von defensiver Architektur und ihrer Rolle bei der sozialen Verdrängung von Obdachlosen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit, defensive Architektur, Hostile Design, Stigmatisierung, Ausgrenzung, öffentlicher Raum, soziale Verdrängung, politische und pädagogische Perspektiven. Sie befasst sich mit den Herausforderungen, denen obdachlose Menschen in Deutschland gegenüberstehen, und den Möglichkeiten, diese zu überwinden.
- Citation du texte
- Meyrem Tiftikci (Auteur), 2023, Ausgrenzung von obdachlosen Menschen durch defensive Architektur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1457250