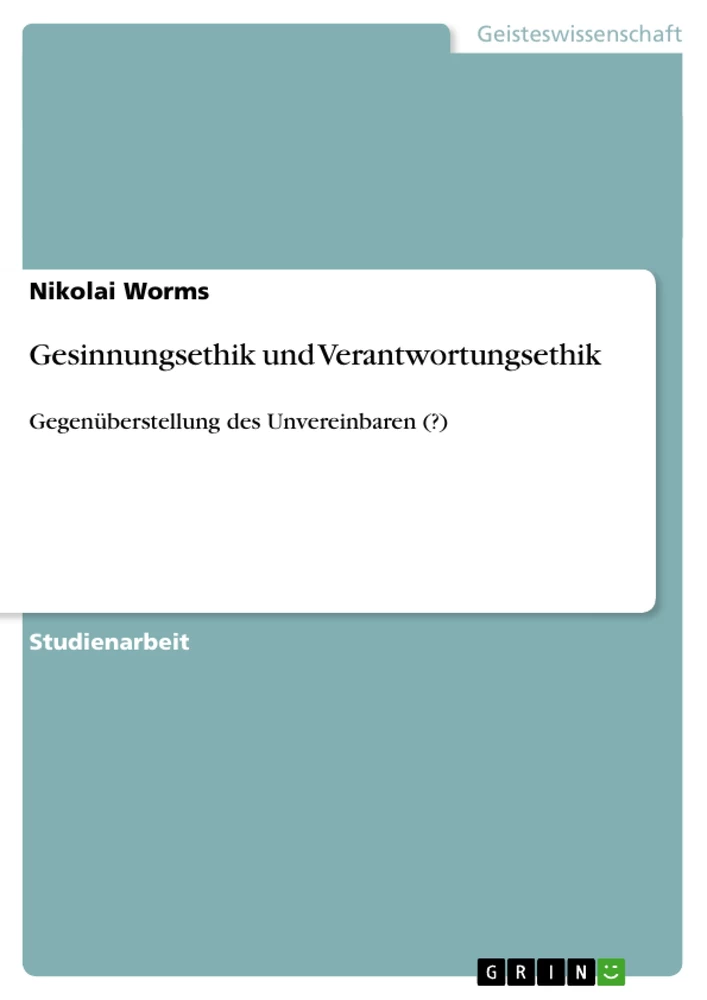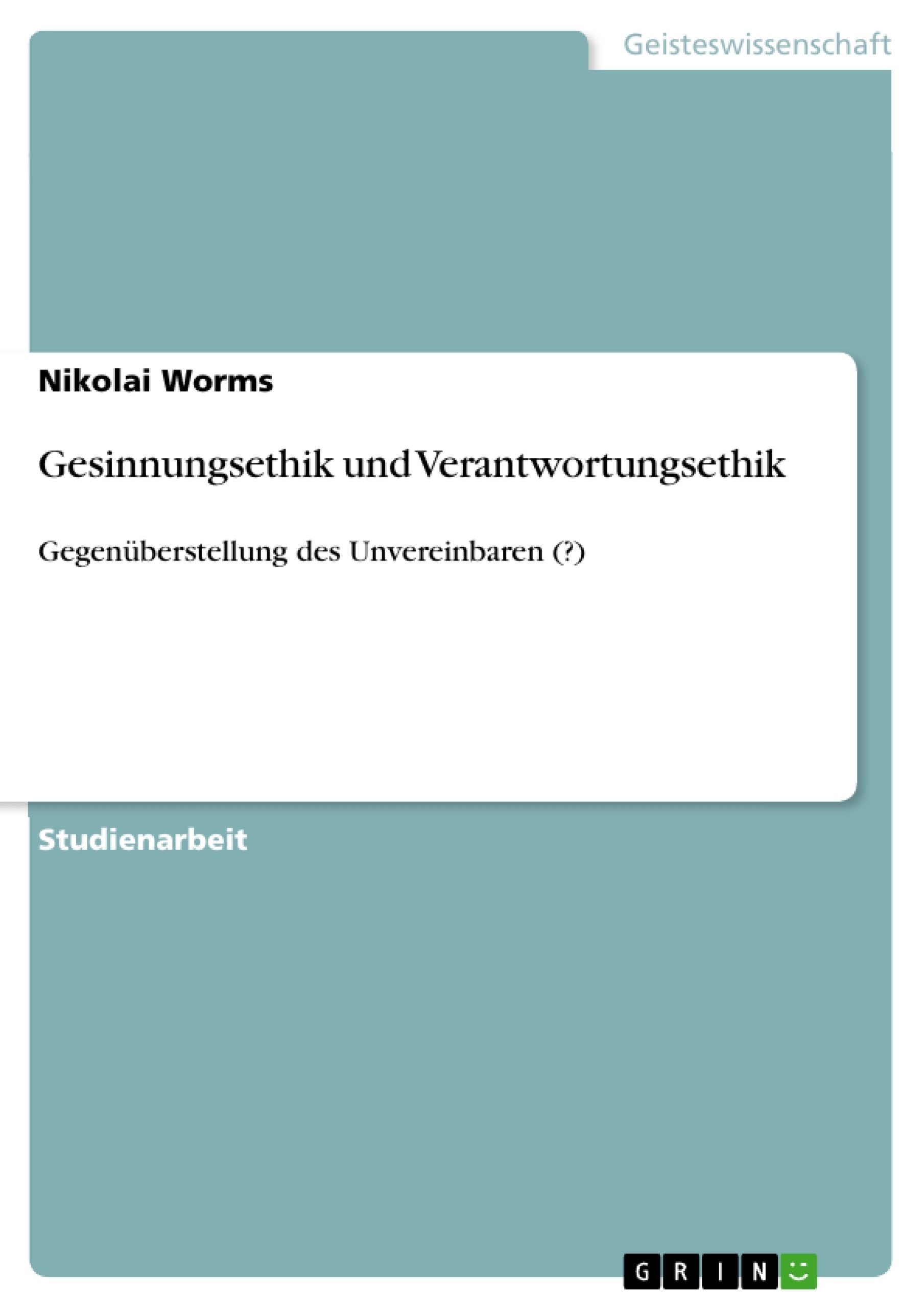Verantwortungsethik und Gesinnungsethik – in der Literatur werden diese beiden Begriffe zumeist als miteinander unvereinbar egenübergestellt. Zumeist ausgehend von dem von Max Weber im Jahr 1919 gehaltenen Vortrag 'Politik als Beruf' werden die beiden Ethiken oft unhinterfragt als grundlegend verschiedene Ansätze angesehen.In der vorliegenden Studienarbeit werden die beiden Begriffe zunächst beschrieben, um darauf aufbauend deren Unvereinbarkeit miteinander genauer zu überprüfen.
1 Einleitung
Verantwortungsethik und Gesinnungsethik - in der Literatur werden diese beiden Begriffe zumeist als miteinander unvereinbar gegenübergestellt. Zumeist ausgehend von dem von Max Weber im Jahr 1919 gehaltenen Vortrag 'Politik als Beruf' werden die beiden Ethiken oft unhin- terfragt als grundlegend verschiedene Ansätze angesehen.In der vorliegenden Studienarbeit werden die beiden Begriffe zunächst beschrieben, um darauf aufbauend deren Unvereinbarkeit miteinander genauer zu überprüfen.
In Kapitel 2 wird zunächst auf die Gesinnungsethik eingegangen. Sie basiert auf dem von Kant entwickelten kategorischen Imperativ, nachdem jegliches moralisches Handeln auf eine Maxime, also dem handelnden Menschen innewohnende Gesinnung zurückgehen muss. Der moralisch handelnde Mensch müsse es als seine Pflicht ansehen, zuallererst nach dieser Maxime zu entscheiden und an diesem von Kant vorausgesetzten „guten Willen" alle seine Entscheidungen zu messen. Die zugrunde liegende Haltung, die Intention, ist somit viel wichtiger als das aus der Handlung resultierende Ergebnis. Der von der Maxime vorgegebene Handlungsrahmen kann nicht verlassen werden, ohne die moralischen Grundsätze zu verletzen und dadurch letztenen- des das gesamte System zu korrumpieren.
Die Verantwortungsethik, die in Kapitel 3 genauer diskutiert wird, geht dagegen davon aus, dass der Handelnde das Ergebnis seines Handelns als primäres Kriterium zur moralischen Bewertung ansieht. Der Weg oder das Motiv, mit dem dieses Ergebnis erzielt wird, ist dabei zunächst von geringerer Bedeutung. Natürlich sieht auch die Verantwortungsethik einen Werte- und Normenrahmen vor, innerhalb dessen die Handlungen stattfinden; sie ist keinesfalls frei von moralischen Grundsätzen. Allerdings können diese Grenzen der Handlungsfreiheit in der Verantwortungsethik überschritten oder (vorübergehend) ausgedehnt werden.
Allein an diesen kurzen Beschreibungen wird bereits deutlich, dass der Widerspruch zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik zunächst logisch scheint. Überspitzt formuliert ist für den Gesinnungsethiker „der Weg das Ziel", während die Handlung für den Verantwortungsethiker eher „Mittel zum Zweck" ist.
Dieser oft als gegeben angesehene Gegensatz ist kontrovers diskutiert worden. Es schließt sich deshalb in Kapitel 4 eine Diskussion über die tatsächlichen Differenzen an, in der versucht wird, den scheinbar unüberwindbare Gegensatz aufzulösen.
2 Gesinnungsethik
In diesem Kapitel wird zunächst der Begriff 'Gesinnung' erläutert. Die Gesinnung ist die handlungsleitende Instanz des Gesinnungsethikers, also die Basis seiner Entscheidungsfindung, und scheint deshalb an dieser Stelle einer gesonderten Betrachtung zu bedürfen. Darauf aufbauend wird in Kapitel 2.2 auf den Begriff der Gesinnungsethik eingegangen. Diese Ethik baut auf einer Intention auf, die ausschließlich durch die individuelle Gesinnung bestimmt ist. Da sich besonders zur Gesinnungsethik vielfältige Kritikpunkte in der Literatur finden, schließt sich am Ende des zweiten Kapitels noch ein Abschnitt über die an der Gesinnungsethik geäußerte Kritik an.
2.1 Grundlage: Die Gesinnung
Unter Gesinnung versteht man das individuelle Wissen und Wollen einer Person, die nach den Maßstäben ihres Gewissens, also der ihr eigenen Vorstellung von Gut und Schlecht handelt. Die Gesinnung ist damit ein individuelles Phänomen; im Gegensatz dazu steht etwa die Moral, die zum kulturellen Erbe jedes Menschen gehört. Gesinnung wird dagegen nicht ererbt, sondern entwickelt sich im Laufe des Lebens; die Bewertungsinstanz, an der sich die auf Basis der Gesinnung getroffenen Entscheidungen messen, ist das ebenfalls individuell im Laufe des Lebens entwickelte Gewissen [Schöpf 1997: 103f.].
Die Handlungen und Urteile einer Person werden durch Wissen, Willen und Gefühle geleitet, das heißt durch ausschließlich innere Motivation, die Handlungen und Urteilen einen Sinn und eine Bedeutung verleihen. Die Handlungsmotivation bezieht zwar auch Umgebungs- und Körperwahrnehmungen mit ein, die das individuelle Wissen, Werte, Normen und Gefühle beeinflussen und prägen. Allerdings werden die daraus folgenden Handlungen immer von der Gesinnung als „sittlicher Grundhaltung“ [Die Zeit 2005: Band 6, 438] abhängig gemacht.
2.2 Erläuterung der Gesinnungsethik
Wie im Kapitel zuvor erläutert, determiniert die „Gesinnung als (...) innere Disposition“ [Schöpf 1997: 103] in Entscheidungssituationen die weitere Handlung und damit nur indirekt das Ergebnis, das deshalb nicht als primäres Kriterium bei der Entscheidungsfindung dient. Vielmehr rückt die Gesinnungsethik die „intentio“ [Reiner 2007: 539], also die Absicht in den Vordergrund. Allerdings ist auch die strikte Entscheidung nach gesinnungsethischen Maßstäben niemals komplett autonom aus dem Gewissen des Entscheidenden heraus getroffen: Wie in Kapitel 2.1 beschrieben werden auch Werte und Normen mit einbezogen, die ein Produkt äußerlicher Einflüsse sind.
Nach Hegel wird bei jeder Entscheidung, sei diese bewusst oder unbewusst, zwischen den besonderen Wünschen und Bedürfnissen des Einzelnen (Vorsatz), und den Ansprüchen der Allgemeinheit (allgemeine Absicht), die in den Normen und Werten verinnerlicht sind [Hegel 1972: §115-§140], verglichen. In Hegels Formulierung einer 'Absicht' steckt erneut das für die Gesinnungsethik prägende Element einer Bestimmung des jeweiligen Willens [Kirchner 1907], das die möglichen Folgen einer Handlung im Extremfall zunächst außer Acht lässt. Grundlage der Entscheidung ist, dass das Gewissen als oberste Entscheidungsinstanz in jeder Situation unbedingt das Gute bejaht und das Schlechte verneint, und zwar ungeachtet der Folgen in der gesellschaftlichen Wirklichkeit [Schöpf 1997: 104]. Der Gesinnungsethiker 'kann also nicht anders', als die Maximen seines Gewissens immer zu befolgen, auch wenn die Folgen eines einmaligen Grenzübertritts die moralischen 'Kosten' eigenlich aufwiegen würden.
Als Beispiele für Gesinnungsethik in der Geschichte nennt Reiner [Reiner 2007: 539f.]:
- Platon erklärt den Versuch der guten Handlung als gut
- Aristoteles: Beim Geben kommt es nicht auf die Größe der Gabe an, sondern auf die Art der zugrunde liegenden Haltung
- Augustinus: Es kommt nicht darauf an, was der Mensch tut, sondern in welcher Gesinnung er es tut. Entscheidend ist allein die Absicht ('intentio').
- Abaelard knüpft an Augustinus an: Die intentio und nicht der 'effectus' macht macht eine Handlung gut
- Die stoische Ethik basiert auf der Maxime dass man sich von der Pflicht zur Zielerreichung völlig frei machen müsse, um tugendhaft zu leben.
- Und vor allem wird Kant als Vertreter einer Gesinnungsethik genannt [vgl. z.B. Köhl 1990: 2]
Nach Kant kann eine Handlung anhand dreier Dimensionen auf ihren moralischen Wert hin beurteilt werden [Köhl 1990: 2]:
- Die Absicht des Handelnden, sein Wille
- Maximen als individuelle Handlungsgrundsätze
- Die Beweggründe des Handelnden, also seine Motive
Diese drei Punkte sind für Kant unter der 'Gesinnung' zusammengefasst.
2.3 Kritik an der Gesinnungsethik
Die Fixierung auf die Innerlichkeit einer moralischen Entscheidungsfindung allein anhand der Gesinnung kritisiert Hegel: das Gute zu erkennen sei jedem Individuum nur zu dem Teil mög- lieh, den es weiß, will und fühlt. Ergo basiere die Entscheidung über eine Handlung nicht auf dem wirklich 'Guten', sondern auf der individuellen Auffassung von Gut [Hegel 1972: §115- §140]. Er spricht daher der Gesllschaft das Recht zu, die Gesinnung Einzelner durch Sitte und Übereinkunft korrigieren zu dürfen. Andererseits müsse die Gesellschaft auch das Individuum schützen, so dass die Gesinnung vom geltenden Recht berücksichtigt werden müsse [Schöpf 1997:104].
Auch Scheler kritisiert, dass moralisches Handeln zwar „aus der Gesinnung herausfließt und von ihr innerlich regiert wird", es aber immer auch „auf die Verwirklichung eines bestimmten Wertes gerichtet" sein muss. Eine „falsche Gesinnung" sei es deshalb, wenn ausschließlich sie als „der einizige Träger der sittlichen Werte" betrachtet werde. Scheler kritisiert somit Kants Auffassung einer „fast bis zur Absurdität gesteigerten" [Scheler 1913, zitiert aus Reiner 2005: 539] Pflichtethik, die er bei Kant erkennt („Eine Handlung ist nur dann gut, wenn sie aus Pflicht geschehen ist" [Köhl 1990: 5]).
Das unbedingte Handeln nach einem moralischen Gesetz impliziert, dass der freie Wille einem gebietenden Anspruch unterliegt, der den eigenen Trieben und Wünschen entgegengesetzt sein kann [Forscher 1997: 229]. Scheler geht in seiner Kritik noch weiter: Pflicht könne keine Grundlage für eine Ethik sein, da sie eine Nötigung und einen Zwang darstellt, der individuelles Wollen unterdrückt und damit sogar eher (moralische) Blindheit statt Einsicht fördere [Schleißhei- mer 2003: 113]; Reiner spricht in diesem Zusammenhang von Gehorsam [Reiner 2005: 540]. Auch bei Max Weber findet sich Kritik an einer reinen Gesinnungsethik, die sich vor allem auf das Christentum bezieht:
„(...) Wenn die Folgen einer aus reiner Gesinnung fließenden Handlung üble sind, so gilt ihm (Anm. d. Verf.: dem Gesinnungsethiker) nicht der Handelnde, sondern die Welt dafür verantwortlich, die Dummheit der Menschen oder - der Wille Gottes, der sie so schuf"
[Weber 1987: 58]
Die Taten des Gesinnungsethikers können deshalb allenfalls „exemplarischen Wert" [Weber 1987: 53] haben, zum Beispiel als Vorbild für andere. Er merkt außerdem an, dass der Gesin- nungsethiker in der Realität nur so lange nach der eigenen Gesinnung handelt, wie ihm diese auch zupass kommt; die „ethische Irrationalität der Welt" [Weber 1987: 59] würde ihn seine hehren Maximen irgendwann vergessen lassen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Textes?
Der Text behandelt die Gegenüberstellung von Gesinnungsethik und Verantwortungsethik, wobei untersucht wird, inwiefern diese beiden ethischen Ansätze miteinander unvereinbar sind.
Was ist Gesinnungsethik gemäß dem Text?
Gesinnungsethik basiert auf der Idee, dass die moralische Bewertung einer Handlung primär von der Gesinnung oder Absicht des Handelnden abhängt. Es geht um die innere Haltung und die zugrunde liegende Maxime, unabhängig von den konkreten Folgen der Handlung.
Wer sind einige der im Text genannten Vertreter der Gesinnungsethik?
Der Text nennt Platon, Aristoteles, Augustinus, Abaelard, die stoische Ethik und insbesondere Kant als wichtige Vertreter der Gesinnungsethik.
Was ist Verantwortungsethik laut dem Text?
Verantwortungsethik hingegen betont die Bedeutung der Konsequenzen einer Handlung für die moralische Bewertung. Der Handelnde trägt die Verantwortung für die Ergebnisse seines Handelns, und diese Ergebnisse sind das primäre Kriterium.
Wie wird die Kritik an der Gesinnungsethik im Text dargestellt?
Die Kritik an der Gesinnungsethik bezieht sich hauptsächlich auf die potenzielle Blindheit gegenüber den tatsächlichen Auswirkungen von Handlungen, die aus reiner Gesinnung resultieren. Hegel kritisiert, dass die Entscheidung über eine Handlung nicht auf dem wirklich 'Guten' basiert, sondern auf der individuellen Auffassung von Gut. Scheler kritisiert Kants Pflichtethik, die er als zu starr betrachtet. Weber weist darauf hin, dass die Folgen schlechter Handlungen, die aus reiner Gesinnung resultieren, dem Handelnden nicht angelastet werden, sondern der Welt oder dem Willen Gottes.
Was ist die Rolle der "Gesinnung" im Kontext der Gesinnungsethik?
Die Gesinnung wird als die handlungsleitende Instanz des Gesinnungsethikers beschrieben, also die Basis seiner Entscheidungsfindung. Sie basiert auf dem individuellen Wissen und Wollen einer Person, die nach den Maßstäben ihres Gewissens handelt.
Wie unterscheidet sich das Gewissen von der Moral im Kontext des Textes?
Das Gewissen wird als eine individuell im Laufe des Lebens entwickelte Bewertungsinstanz beschrieben, während die Moral zum kulturellen Erbe jedes Menschen gehört.
Welche Dimensionen einer Handlung werden nach Kant auf ihren moralischen Wert hin beurteilt?
Nach Kant werden die Absicht des Handelnden, die Maximen als individuelle Handlungsgrundsätze und die Beweggründe des Handelnden unter der 'Gesinnung' zusammengefasst.
Was wird als möglicher Missbrauch der Gesinnungsethik angeführt?
Der Text erwähnt, dass eine Gesinnung, die das Handeln quasi von oben herab auferlegt, fatalistische Züge tragen und zur Rechtfertigung von Verbrechen missbraucht werden kann, wie zum Beispiel bei den christlichen Kreuzzügen oder Terroroperationen.
Was ist das Ziel von Kapitel 4 des Textes?
Kapitel 4 des Textes zielt darauf ab, die tatsächlichen Differenzen zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik zu diskutieren und zu versuchen, den scheinbar unüberwindbaren Gegensatz aufzulösen.
- Quote paper
- Nikolai Worms (Author), 2009, Gesinnungsethik und Verantwortungsethik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146858