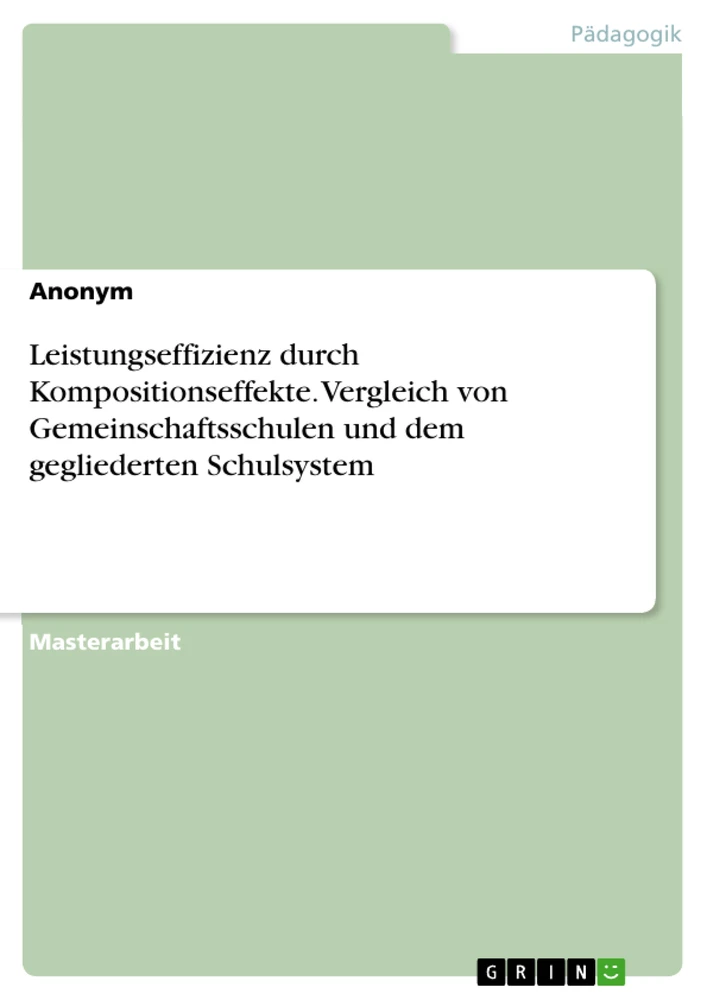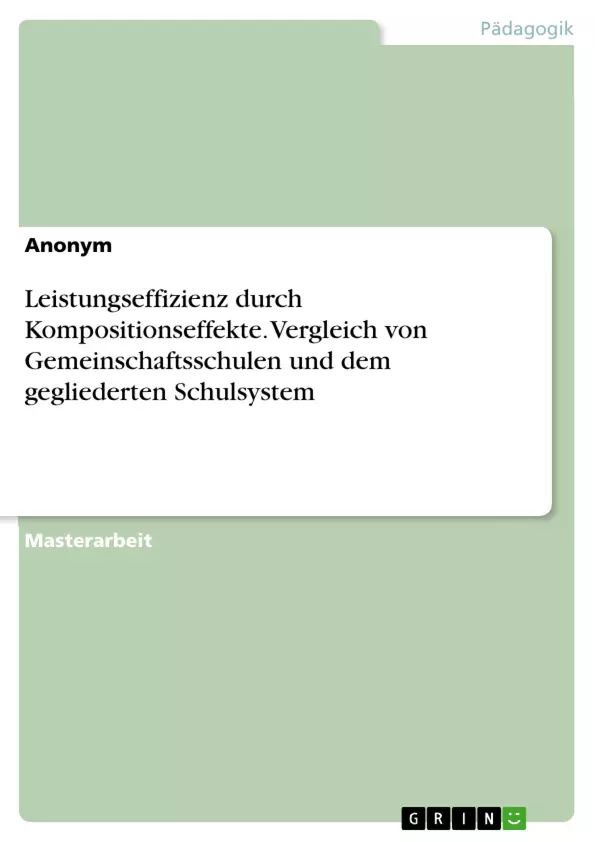Dieser Arbeit liegt die Frage zugrunde wie es generell möglich bzw. in welcher Schulform es möglich ist, jedem Kind den für es am besten geeigneten Bildungsweg anzubieten. Das Hauptaugenmerk liegt dabei, aufgrund des vorgegebenen Arbeitsumfangs, weniger auf dem bildungspolitischen Aspekt bzgl. der Förderung individueller Leistung bei Schülern als mehr auf der Herausarbeitung von Kriterien der Effektivität des Bildungssystems. Dabei wird der Erfolg eines Schulmodells, welches auf Annahmen von allgemeiner Inklusion und Förderung von allgemeiner Heterogenität fußt, kritisch auf den Prüfstand gestellt und hinsichtlich der Förderung von Schülerleistung untersucht. Das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit ist es, quantitativ empirisch zu überprüfen wie die Zusammenstellung einer Klassengemeinschaft in einer Schule Einfluss auf die individuelle Leistung bzgl. der mathematischen Fähigkeiten des einzelnen Schülers hat. Dieses Erkenntnisinteresse ist per Definition im Bereich der Bildungssoziologie zu verorten.
Nicht erst mit der Pisa Studie aus dem Jahr 2000 der OECD, jedoch mit durch diese angesprochen, rückt einer der am stärksten polarisierenden gesellschaftspolitischen Diskurse der deutschen bzw. europäischen Gegenwart in den Fokus öffentlichen Interesses. Die sich bezüglich Bildungs- und Berufslebensläufen, Demografie sowie dem Einkommensgefüge immer mehr diversifizierende deutsche Gesellschaft, steht vor einer großen Herausforderung. Der Blick der Landesregierungen muss, gerade vor dem Hintergrund des schlechten Abschneidens deutscher Schüler in der Pisa 2000 Studie, auf der Verbesserung von zukünftigen Bildungsmodellen liegen. Vor diesem Hintergrund befasst sich die Arbeit mit denjenigen Menschen, welche mittel- bis langfristig die Leistungsträger der bundesdeutschen Gesellschaft sein werden: den jugendlichen Schülern an weiterführenden Schulen. Sinn und Zweck dieser Arbeit ist es, allen Kindern, die das deutsche Schulsystem durchlaufen, die für sie optimale Bildung und ihren vielfältigen und unterschiedlichen Bedürfnissen optimale Form von Bildung aufzuzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Ansatz-gestützte Begründung der Auswahl struktureller Kategorien von Komposition
- 2.1. Prengels Pädagogik der Vielfalt als sozial- und erkenntniskritischer Referenzpunkt
- 2.2. Helmkes Angebot-Nutzungs-Modell als lehr- lernpsychologischer Referenzpunkt. Verwendung der ethnisch-kulturellen Variable bei Kompositionseffekten
- 2.3. Schülergüte-bezogene Zusammenstellung der Gemeinschaft als erklärendes Kriterium
- 2.4. Praktische Umsetzungen aus Lehr- Lernpsychologie und sozial- und erkenntniskritischen Ansätzen / Die Best-Practice Variante
- 3. Schule
- 3.1. Schule als selbstreferenzielles, offenes und geschlossenes System
- 3.2. Schule als autopoietisches System
- 3.3. Sinn und Schule
- 3.4. Wie das System Schule kommuniziert und handelt
- 3.5. Schule als System - Zwischenfazit
- 4. Alternative Betrachtungsweisen von Schule
- 4.1. Schule nach Bourdieu
- 4.1.1 Inkorporierter Zustand
- 4.1.2 Objektivierter Zustand
- 4.1.3 Institutionalisierter Zustand
- 4.2. Zwischenfazit zum Schul-Begriff nach Bourdieu
- 5. Warum Luhmann und nicht Bourdieu ?
- 6. Methodisches Vorgehen
- 7.1. Der Typ des Forschungsdesigns Trend-, Querschnitt- oder Paneldesign
- 7.1.1 Pisa 2003 I Plus als Kohortendesign
- 7.2. Pisa 2003 I/ Pisa 2003 I Plus als quantitative Studie
- 7.3. Konsequenzen der Eigenschaften von Pisa 2003 I Plus für die vorliegende Arbeit
- 8. Die verwendeten Variablen / Die abhängige Variable
- 9. Die verwendeten Variablen / Die unabhängigen Variablen
- 10. Die verwendeten Variablen / Die Kontrollvariablen
- 11. Kurzcharakteristik der Stichprobe
- 12. Grundlagen der Mehrebenenanalyse
- 10.1. Grundlagen der Kontextanalyse
- 10.1.1 Vorstellung einer Auswahl an Statistikprogrammen
- 10.1.2 Niveaus und Beschaffenheit der Daten bei Mehrebenenanalysen
- 13. Grundlagen der Analysemodelle
- 10.3.1 Das allgemeine lineare Modell
- 10.3.2 Die multiple lineare Regression
- 10.3.3 Die Varianzanalyse
- 14. Das verwendete Analysemodell
- 15. Darstellung der Ergebnisse
- 16. Interpretation der Ergebnisse
- 17. Resümee und Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht die Effizienz von Schulsystemen im Hinblick auf die Förderung individueller Schülerleistungen. Dabei wird der Einfluss der Klassenzusammensetzung (Komposition) auf die mathematischen Fähigkeiten von Schülern in den Fokus genommen. Die Arbeit analysiert die Effektivität von Gemeinschaftsschulen im Vergleich zum gegliederten Schulsystem, unter Einbezug von sozioökonomischen und ethnisch-kulturellen Faktoren.
- Leistungsfähigkeit des deutschen Bildungssystems im Hinblick auf die Förderung individueller Schülerleistungen
- Kompositionseffekte in Klassen und ihre Auswirkungen auf die individuelle Leistung von Schülern
- Vergleich der Effektivität von Gemeinschaftsschulen und dem gegliederten Schulsystem
- Sozioökonomische und ethnisch-kulturelle Einflussfaktoren auf die Schülerleistung
- Anwendung von Mehrebenenanalysen und quantitativen Forschungsmethoden zur Überprüfung von Kompositionseffekten
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der Leistungsfähigkeit des deutschen Schulsystems ein und beleuchtet die Bedeutung von Kompositionseffekten für die individuelle Schülerleistung. Sie stellt die Forschungsfrage nach der optimalen Schulform für die Förderung der individuellen Bedürfnisse von Schülern und definiert den Fokus der Arbeit auf die Effektivität von Bildungssystemen.
- Kapitel 2: Ansatz-gestützte Begründung der Auswahl struktureller Kategorien von Komposition
Dieses Kapitel analysiert verschiedene pädagogische Ansätze, die zur Auswahl von strukturellen Kategorien der Komposition beitragen. Es werden Prengels Pädagogik der Vielfalt und Helmkes Angebot-Nutzungs-Modell als Referenzpunkte herangezogen, um die Bedeutung von Schülergüte und ethnisch-kulturellen Merkmalen für die Klassenzusammensetzung zu beleuchten.
- Kapitel 3: Schule
Kapitel 3 beleuchtet den Begriff Schule aus verschiedenen systemtheoretischen Perspektiven. Es werden Aspekte wie Selbstreferenzialität, Offenheit, Geschlossenheit, Autopoiesis und die Kommunikation innerhalb des Schulsystems behandelt.
- Kapitel 4: Alternative Betrachtungsweisen von Schule
Dieses Kapitel analysiert den Schulbegriff nach Bourdieu und seine Theorie des Habitus und des Kapitals. Es werden die verschiedenen Zustände des Schulsystems nach Bourdieu (inkorporiert, objektiviert, institutionalisiert) vorgestellt.
- Kapitel 5: Warum Luhmann und nicht Bourdieu ?
Dieses Kapitel argumentiert für die Verwendung der Systemtheorie von Luhmann im Vergleich zur Theorie von Bourdieu. Es werden die Vorzüge von Luhmanns Ansatz für die Analyse von Kompositionseffekten in Bildungssystemen erläutert.
- Kapitel 6: Methodisches Vorgehen
In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen der Arbeit beschrieben. Es werden das Forschungsdesign, die Datengrundlage (PISA 2003 I Plus) und die verwendeten Variablen (abhängige, unabhängige, Kontrollvariablen) vorgestellt.
- Kapitel 7: Kurzcharakteristik der Stichprobe
Kapitel 7 bietet eine kurze Beschreibung der Stichprobe, die für die Untersuchung der Kompositionseffekte verwendet wird.
- Kapitel 8: Grundlagen der Mehrebenenanalyse
Dieses Kapitel erläutert die Grundlagen der Mehrebenenanalyse als Forschungsmethode zur Analyse von Kompositionseffekten. Es werden die Grundlagen der Kontextanalyse, die Vorstellung von Statistikprogrammen und die Beschaffenheit der Daten bei Mehrebenenanalysen behandelt.
- Kapitel 9: Grundlagen der Analysemodelle
In diesem Kapitel werden die Grundlagen verschiedener Analysemodelle vorgestellt, darunter das allgemeine lineare Modell, die multiple lineare Regression und die Varianzanalyse.
- Kapitel 10: Das verwendete Analysemodell
Dieses Kapitel beschreibt das spezifische Analysemodell, das für die Untersuchung der Kompositionseffekte in der Arbeit verwendet wird.
- Kapitel 11: Darstellung der Ergebnisse
Kapitel 11 präsentiert die Ergebnisse der Analyse der Kompositionseffekte.
- Kapitel 12: Interpretation der Ergebnisse
Dieses Kapitel interpretiert die Ergebnisse der Analyse und diskutiert die Implikationen für die Effektivität von Bildungssystemen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind Kompositionseffekte, Schulsystem, Gemeinschaftsschule, Leistungseffizienz, Schülergüte, ethnisch-kultureller Hintergrund, Mehrebenenanalyse, quantitative Forschungsmethoden, Bildungssoziologie, PISA Studie, Individuelle Leistung, und Sozialisation.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2024, Leistungseffizienz durch Kompositionseffekte. Vergleich von Gemeinschaftsschulen und dem gegliederten Schulsystem, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1470736