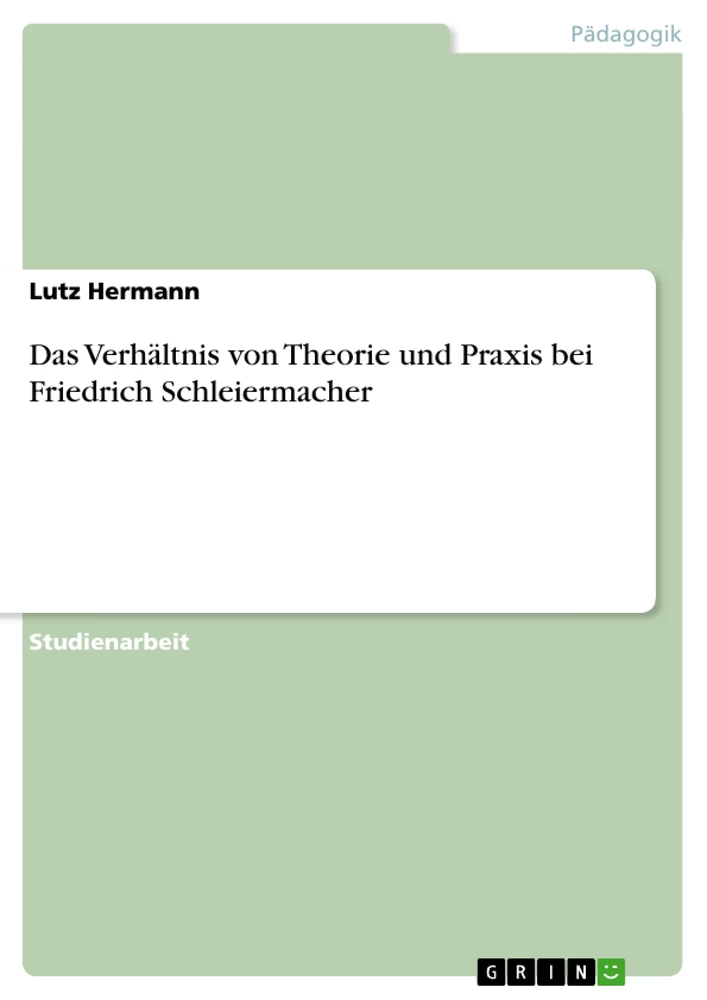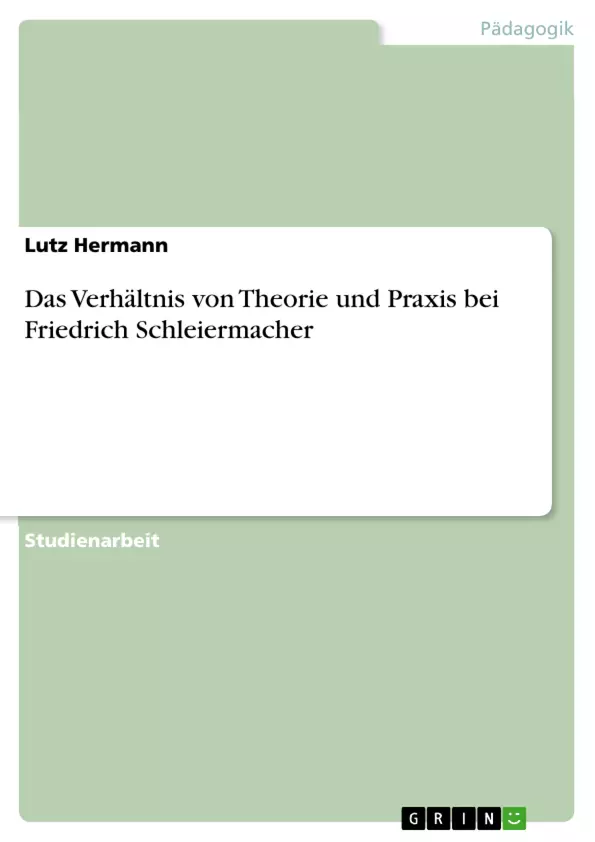Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher war Pädagoge und Theologe, Theoretiker und Praktiker, Pfarrer und Professor. Sein Werk spiegelt diese Vielseitigkeit der Person wieder. Es enthält unter anderem Schriften über die Religion, Vorlesungen über Pädagogik und Kirchengeschichte, Übersetzungen von Platons Schriften, sowie Prosa und romantische Fragmente.
In der Erziehungswissenschaft besteht allgemeiner Konsens, dass Friedrich Schleiermacher (zusammen mit Herbart) als der „neuzeitliche Begründer der Pädagogik als Wissenschaft“ gilt.
Die Frage nach dem Verhältnis von Theorie und Praxis in der Pädagogik ist ein spezifisches Problem der heutigen Erziehungswissenschaft. Dies lässt sich an Aufsätzen von Elisabeth Badry (1999) und Helmut Heid (2001) aufzeigen.
Von Theorie und Praxis redet allerdings auch schon Schleiermacher in seiner Erziehungsvorlesung von 1826. Er bringt hier das Verhältnis von Theorie und Praxis in seinem berühmten Satz von der „Dignität der Praxis“ scheinbar auf den Punkt. Johanna Hopfner hat dieser einen Aussage Schleiermachers einen ganzen Aufsatz gewidmet. Die vorliegende Arbeit wählt die entgegengesetzte Vorgehensweise: Sie sucht nicht die konzentrierte Auseinandersetzung mit einem einzelnen Satz, sondern unterwirft das gesamte Vorkommen der Begriffe „Theorie“ und „Praxis“, in einem begrenzten Textabschnitt, einer inhaltlichen und formalen Analyse. Der zu untersuchende Textausschnitt soll die Einleitung zu Schleiermachers Erziehungsvorlesung von 1826 sein.
Die in der vorliegenden Arbeit zu diskutierende These ist folgende:
Das Aufstellen einer Theorie ist der Versuch, die Wirklichkeit in Form von Sprache handhabbar zu machen. Dabei müssen sowohl Form, als auch Inhalt der Sprache, der Komplexität der Wirklichkeit entsprechen. Praxis ist nicht mit Wirklichkeit gleichzusetzen. Sie kann als durch Theorie bewusstgewordene Wirklichkeit verstanden werden. Dennoch behält die Praxis ihren von der Theorie unabhängigen Wert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Darstellung der Methode
- Exkurs: Sprachphilosophische Kritik an der Methode
- 3. Quantitative Analyse der Begriffe „Theorie“ und „Praxis“
- 4. Inhaltliche Analyse des Begriffs „Praxis“
- 4.1 Praxis der Erziehung ist...
- 4.2 Äquivalente Begriffe
- 5. Inhaltliche Analyse des Begriffs „Theorie“
- 5.1 Theorie der Erziehung ist....
- 5.2 Äquivalente Begriffe
- 6. Formale Analyse
- 7. Versuch der Definitionsbildung der Begriffe „Theorie“ und „Praxis“
- 7.1 Versuch einer Definition von „Praxis“
- 7.2 Versuch einer Definition von „Theorie“
- 8. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das Verhältnis von Theorie und Praxis bei Friedrich Schleiermacher anhand seiner Erziehungsvorlesung von 1826. Ziel ist es, Schleiermachers Verständnis von „Theorie“ und „Praxis“ durch eine quantitative und inhaltliche Analyse der verwendeten Begriffe in einem begrenzten Textabschnitt zu ergründen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Einleitung der Vorlesung und vermeidet eine isolierte Betrachtung einzelner Sätze.
- Schleiermachers Verständnis von Theorie und Praxis
- Die Rolle der Sprache in der Bildung von Theorien
- Die methodische Herangehensweise an die Analyse des Textmaterials
- Die Herausforderungen der Begriffsdefinition bei Schleiermacher
- Das Verhältnis von Sprache und Wirklichkeit bei Schleiermacher
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema des Verhältnisses von Theorie und Praxis bei Friedrich Schleiermacher ein. Sie stellt Schleiermacher als bedeutenden Pädagogen und Theologen vor und betont die Relevanz der Thematik für die heutige Erziehungswissenschaft. Die Arbeit konzentriert sich auf eine Analyse der Begriffe „Theorie“ und „Praxis“ in der Einleitung zu Schleiermachers Erziehungsvorlesung von 1826, anstatt sich auf einzelne Sätze oder Aussagen zu beschränken. Die zentrale These ist, dass das Aufstellen einer Theorie ein Versuch ist, die Wirklichkeit sprachlich handhabbar zu machen, wobei Praxis als durch Theorie bewusstgewordene Wirklichkeit verstanden werden kann, jedoch ihren eigenständigen Wert behält.
2. Darstellung der Methode: Dieses Kapitel erläutert die methodische Vorgehensweise der Arbeit. Die gewählte Methode ist hermeneutisch ausgerichtet, wobei der Fokus auf der Sprache Schleiermachers liegt. Um ein geeignetes Textmaterial zu wählen, wird ein Mittelweg zwischen der Analyse eines einzelnen Satzes und der gesamten Erziehungsvorlesung eingeschlagen. Es werden alle Stellen in der Einleitung der Vorlesung ausgewertet, in denen die Begriffe „praktisch“, „Praxis“, „Theorie“ und „theoretisch“ vorkommen. Die Schwierigkeit, exakte Begriffsdefinitionen bei Schleiermacher zu finden, wird mit dem Problem der Abbildung einer komplexen und dynamischen Wirklichkeit in Sprache begründet.
Exkurs: Sprachphilosophische Kritik an der Methode: Dieser Exkurs befasst sich kritisch mit der gewählten Methode und der Schwierigkeit, Schleiermachers sperrige Sprache mit einer starren Methode zu erfassen. Es wird auf die erkenntnistheoretische Herausforderung hingewiesen, komplexe und dynamische Wirklichkeiten adäquat sprachlich darzustellen. Schleiermachers fehlende explizite Begriffsdefinitionen werden im Kontext seines dynamischen Denkens gesehen, wobei die Sprache als stets veränderlich und nicht festlegbar betrachtet wird. Das Sprachproblem wird als zentrale Herausforderung bei der Erfassung der Praxis in der Erziehungswissenschaft identifiziert, wobei die Sprache die Wirklichkeit nur defizitär abbilden kann.
Schlüsselwörter
Friedrich Schleiermacher, Theorie, Praxis, Pädagogik, Hermeneutik, Sprache, Wirklichkeit, Erziehungsvorlesung, Begriffsdefinition, Sprachphilosophie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse von Schleiermachers Verständnis von Theorie und Praxis
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Verhältnis von Theorie und Praxis bei Friedrich Schleiermacher anhand seiner Erziehungsvorlesung von 1826. Der Fokus liegt auf der Ergründung von Schleiermachers Verständnis der Begriffe „Theorie“ und „Praxis“ durch eine quantitative und inhaltliche Analyse der in einem begrenzten Textabschnitt (der Einleitung der Vorlesung) verwendeten Begriffe.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine hermeneutische Methode, die sich auf die Sprache Schleiermachers konzentriert. Es wird eine quantitative Analyse der Häufigkeit der Begriffe „praktisch“, „Praxis“, „Theorie“ und „theoretisch“ durchgeführt. Die Analyse vermeidet die isolierte Betrachtung einzelner Sätze und konzentriert sich auf den Gesamtkontext der Einleitung.
Welche Textstelle wird analysiert?
Analysiert wird die Einleitung der Erziehungsvorlesung Schleiermachers von 1826. Es wird ein Mittelweg zwischen der Analyse eines einzelnen Satzes und der gesamten Vorlesung gewählt, um ein repräsentatives Textmaterial zu erhalten.
Welche Schwierigkeiten werden bei der Analyse angesprochen?
Die Arbeit thematisiert die Schwierigkeit, exakte Begriffsdefinitionen bei Schleiermacher zu finden, da seine Sprache als dynamisch und nicht festlegbar beschrieben wird. Der Exkurs widmet sich einer sprachphilosophischen Kritik an der gewählten Methode und der Herausforderung, komplexe Wirklichkeiten adäquat sprachlich darzustellen. Das Problem der defizitären Abbildung der Wirklichkeit durch Sprache wird als zentrale Herausforderung identifiziert.
Welche Ergebnisse werden angestrebt?
Ziel der Arbeit ist es, Schleiermachers Verständnis von „Theorie“ und „Praxis“ zu ergründen und eine eigene Definitionsbildung dieser Begriffe im Kontext seines Denkens zu versuchen. Die zentrale These ist, dass das Aufstellen einer Theorie ein Versuch ist, die Wirklichkeit sprachlich handhabbar zu machen, wobei Praxis als durch Theorie bewusstgewordene Wirklichkeit verstanden werden kann, aber ihren eigenständigen Wert behält.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Schleiermachers Verständnis von Theorie und Praxis, die Rolle der Sprache in der Bildung von Theorien, die methodische Herangehensweise an die Textanalyse, die Herausforderungen der Begriffsdefinition und das Verhältnis von Sprache und Wirklichkeit bei Schleiermacher.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zur Einleitung, Darstellung der Methode, einen Exkurs zur sprachphilosophischen Kritik, quantitative und inhaltliche Analysen der Begriffe „Theorie“ und „Praxis“, eine formale Analyse, einen Versuch der Definitionsbildung der Begriffe und einen Schluss.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Friedrich Schleiermacher, Theorie, Praxis, Pädagogik, Hermeneutik, Sprache, Wirklichkeit, Erziehungsvorlesung, Begriffsdefinition, Sprachphilosophie.
- Arbeit zitieren
- Lutz Hermann (Autor:in), 2009, Das Verhältnis von Theorie und Praxis bei Friedrich Schleiermacher, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/147226