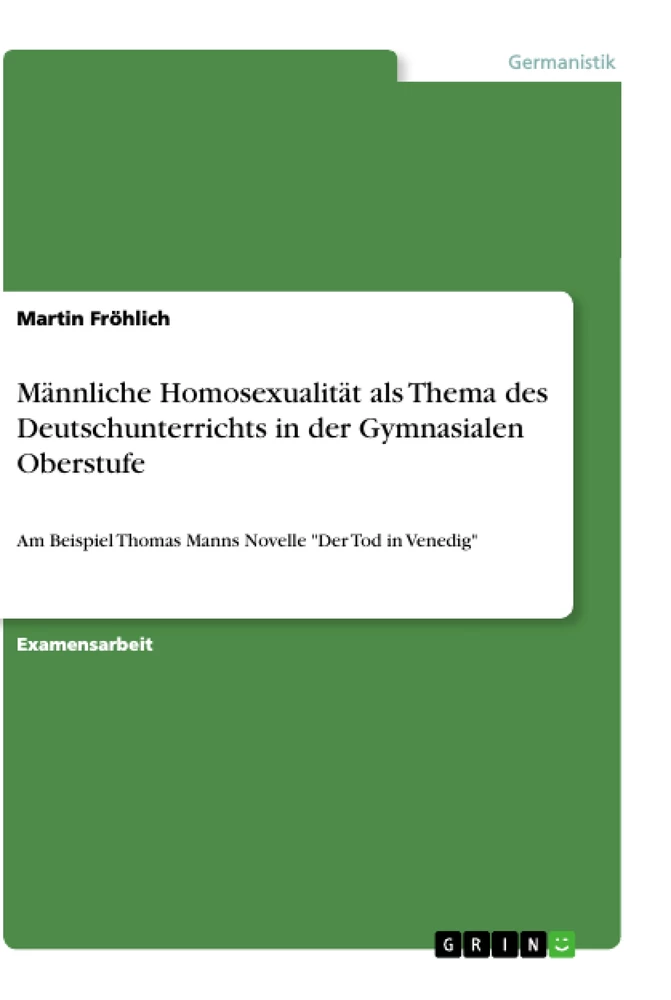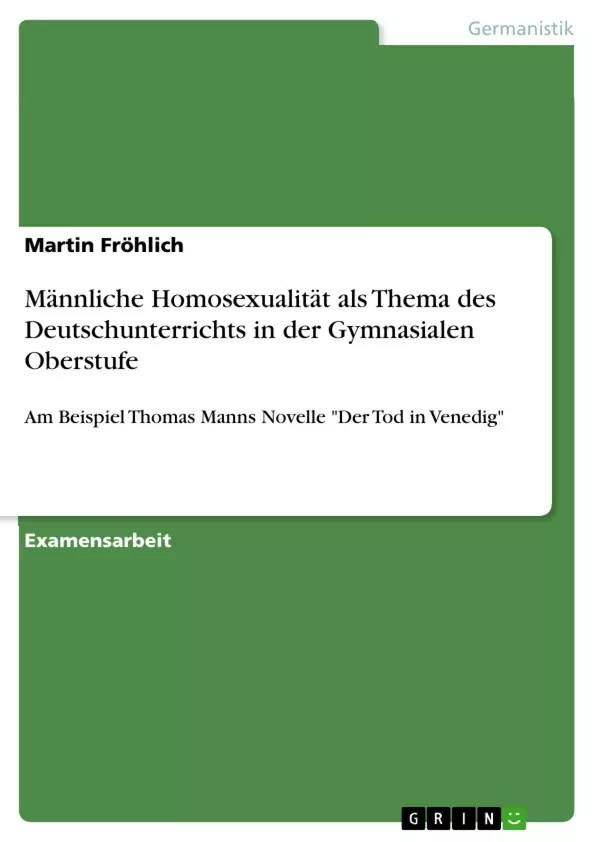In der Gesellschaft existiert eine starke Unsicherheit in Bezug auf Homosexualität. Dies zeigt neuerdings unter anderem die polemische Diskussion über die Adoptionsfrage homosexueller Paare seitens der Politik (BÖHRINGER/VERBEET 2005: 50). Diese Unsicherheit der Homosexualität gegenüber, wird in allen Bereichen der Gesellschaft manifest und somit auch in der Institution Schule. Die Schule als staatsunterstellte Institution hat jedoch bestimmte Aufgaben, die ihr durch Lehrpläne auferlegt werden, zu erfüllen. Diese Aufgaben beschränken sich nicht nur auf die Schulung und Ausbildung fachlicher Kompetenzen, sondern auch auf die Vermittlung von sozialen Fähigkeiten. Dazu gehört unter anderem das Aufzeigen und Ausräumen von Vorurteilen gegenüber sozialen Minderheiten. Diese Minderheiten bezeichnen nicht nur den Bereich der Homosexualität oder gar ausschließlich der männlichen Homosexualität.
Es stellt sich in dieser Arbeit also die Frage, wie dieser Thematik in der Gesellschaft und besonders im Bereich Schule, als persönlichkeitsausbildende, staatsimmanente Institution entgegengetreten wird.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Der Begriff „Homosexualität“
- 1.1 Die männliche Homosexualität als Sexualitätskonzept betrachtet von der Antike bis zur Gegenwart
- 1.1.1 Antike
- 1.1.2 Mittelalter
- 1.1.3 Neuzeit bis einschließlich 20. Jahrhundert
- 1.2 Praxen der Erzeugung der Geschlechterdifferenz in der Neuzeit
- 1.2.1 Jungenbilder – gender und sex
- 1.2.2 Probleme der Rollenbilder - doing gender und gender trouble
- 1.3 Männliche Homosexualität in der Gesellschaft
- 2. Männliche Homosexualität und Schule
- 2.1 Die Aufgabe der Schule als werte- und moralvermittelnde Instanz und die Einbindung der Homosexualität in diesen Kontext
- 2.2 Der Fachbereich Deutsch als Plattform für das Thema der männlichen Homosexualität
- 2.2.1 Der literarische Schulkanon und die Thematisierung der männlichen Homosexualität
- 2.2.2 Die Lehrwerke des Fachbereichs Deutsch von Klasse 7-13 und die Thematisierung der männlichen Homosexualität
- 3. Die Behandlung des Themas der männlichen Homosexualität im Literaturunterricht des Faches Deutsch am Beispiel „Der Tod in Venedig“ von Thomas Mann
- 3.1 Inhaltsanalyse der Novelle „Der Tod in Venedig“ mit dem Schwerpunkt auf männlicher Homosexualität Literaturauswahl
- 3.1.1 Aschenbach und der Gegensatz „apollinisch“ und „dionysisch“
- 3.1.2 Venedig
- 3.1.3 Der Phaidros-Dialog
- 3.2 Die Eignung des Werkes für die Thematisierung der männlichen Homosexualität im Deutschunterricht
- 3.3 Die Verarbeitung des Themas der männlichen Homosexualität in Unterrichtsmodellen zu „Der Tod in Venedig“ Literaturauswahl
- 3.3.1 Vorstellen der Unterrichtsmodelle
- 3.3.1.1 Analyse und Kritik zu dem Unterrichtsmodell der Handreichung für Schwule und lesbische Lebensweisen
- 3.3.1.2 Analyse und Kritik zu dem Unterrichtsmodell von Frizen
- 3.3.2 Fazit zu den Unterrichtsmodellen
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Thematik der männlichen Homosexualität im Kontext des Deutschunterrichts in der gymnasialen Oberstufe. Sie untersucht, wie die männliche Homosexualität in der Gesellschaft und insbesondere im schulischen Kontext wahrgenommen und behandelt wird. Dabei werden die Herausforderungen und Möglichkeiten der Thematisierung von Homosexualität im schulischen Kontext beleuchtet, insbesondere im Hinblick auf den literarischen Schulkanon und die didaktische Umsetzung.
- Die Rolle der Schule als werte- und moralvermittelnde Instanz im Hinblick auf Homosexualität
- Die Bedeutung des Faches Deutsch als Plattform für die Auseinandersetzung mit der männlichen Homosexualität
- Die Eignung von literarischen Werken wie „Der Tod in Venedig“ von Thomas Mann zur Thematisierung von Homosexualität im Unterricht
- Die Herausforderungen und Möglichkeiten der didaktischen Umsetzung von Unterrichtsmodellen zum Thema Homosexualität
- Die Bedeutung der Sensibilisierung für die Lebensrealität und die Bedürfnisse von Menschen mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Relevanz des Themas männliche Homosexualität im Kontext von gesellschaftlicher Unsicherheit und den Aufgaben der Schule als staatsunterstellte Institution. Sie führt die zentrale Fragestellung ein, wie dieser Thematik im schulischen Kontext begegnet wird. Die Arbeit stellt die These auf, dass Homosexualität im Unterricht als marginales Thema verstanden wird und nur am Rande Erwähnung findet. Sie befasst sich mit der Frage, warum die Bedeutung von Homosexualität in einer aufgeklärten und toleranten Gesellschaft unbeachtet bleibt.
Kapitel 1 liefert eine umfassende Definition des Begriffs „Homosexualität“ und beleuchtet die Entwicklung der Sichtweisen auf männliche Homosexualität von der Antike bis zur Neuzeit. Es werden die Praxen der Erzeugung der Geschlechterdifferenz in der Neuzeit erörtert, wobei die Begriffe „gender“ und „sex“ als Basis dienen. Das Kapitel beleuchtet die Entstehung und die Konsequenzen von Rollenbildern in der Gesellschaft.
Kapitel 2 untersucht die Rolle der Schule als werte- und moralvermittelnde Instanz und die Einbindung der Homosexualität in diesen Kontext. Es beleuchtet den Fachbereich Deutsch als Plattform für die Thematisierung der männlichen Homosexualität und analysiert den literarischen Schulkanon sowie die Lehrwerke des Faches Deutsch im Hinblick auf die Thematisierung von Homosexualität.
Kapitel 3 widmet sich der Behandlung des Themas der männlichen Homosexualität im Literaturunterricht des Faches Deutsch am Beispiel von Thomas Manns Novelle „Der Tod in Venedig“. Es beinhaltet eine Inhaltsanalyse der Novelle mit Fokus auf männlicher Homosexualität, untersucht die Eignung des Werkes für die Thematisierung von Homosexualität im Unterricht und analysiert verschiedene Unterrichtsmodelle zu „Der Tod in Venedig“ im Hinblick auf die Verarbeitung des Themas der männlichen Homosexualität.
Schlüsselwörter
Männliche Homosexualität, Deutschunterricht, Gymnasiale Oberstufe, „Der Tod in Venedig“, Thomas Mann, Sexualerziehung, Schulkanon, Unterrichtsmodelle, Gender, Sex, Rollenbilder, Toleranz, Diskriminierung, Gesellschaftliche Unsicherheit
Häufig gestellte Fragen
Warum sollte Homosexualität Thema im Deutschunterricht sein?
Schule hat neben der Fachausbildung die Aufgabe, soziale Fähigkeiten zu vermitteln und Vorurteile gegenüber Minderheiten abzubauen.
Welches literarische Werk dient als Hauptbeispiel?
Thomas Manns Novelle „Der Tod in Venedig“ wird intensiv auf seine Eignung zur Thematisierung männlicher Homosexualität untersucht.
Was bedeuten die Begriffe „gender“ und „sex“ in diesem Kontext?
„Sex“ bezieht sich auf das biologische Geschlecht, während „Gender“ die soziale Geschlechterrolle und die damit verbundenen gesellschaftlichen Erwartungen beschreibt.
Wie wird Homosexualität in aktuellen Lehrwerken behandelt?
Die Arbeit stellt die These auf, dass das Thema oft marginalisiert wird und in Lehrwerken für die Klassen 7-13 nur am Rande Erwähnung findet.
Was ist das Ziel didaktischer Unterrichtsmodelle zu diesem Thema?
Sie sollen Lehrkräften helfen, das Thema sensibel zu integrieren, Rollenbilder zu hinterfragen und Toleranz gegenüber unterschiedlichen Lebensweisen zu fördern.
- Quote paper
- Martin Fröhlich (Author), 2009, Männliche Homosexualität als Thema des Deutschunterrichts in der Gymnasialen Oberstufe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/147597