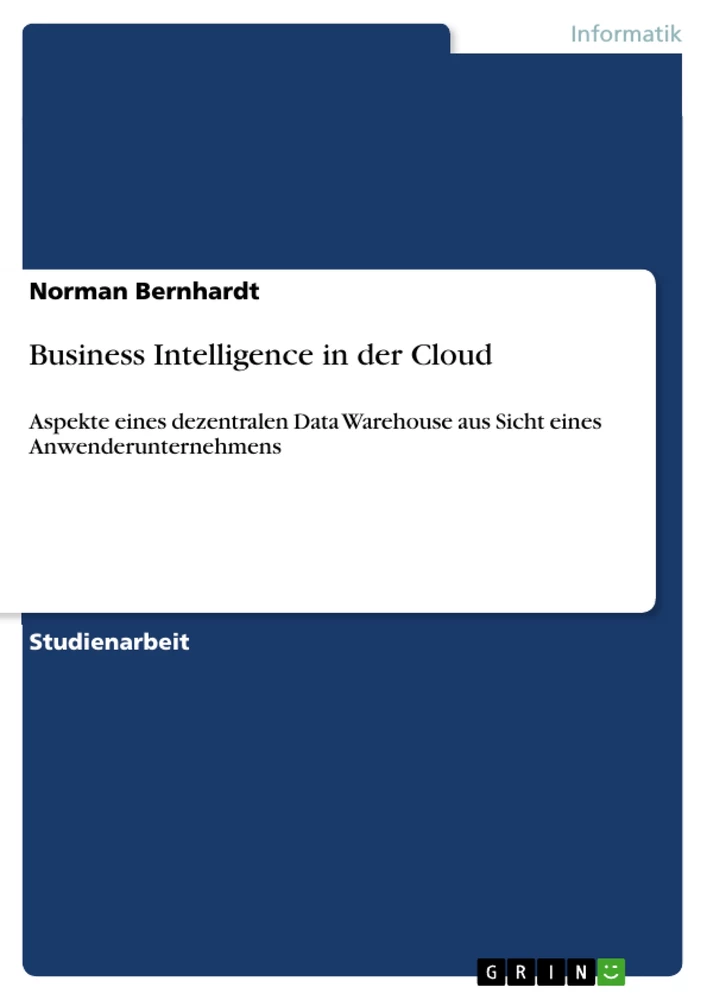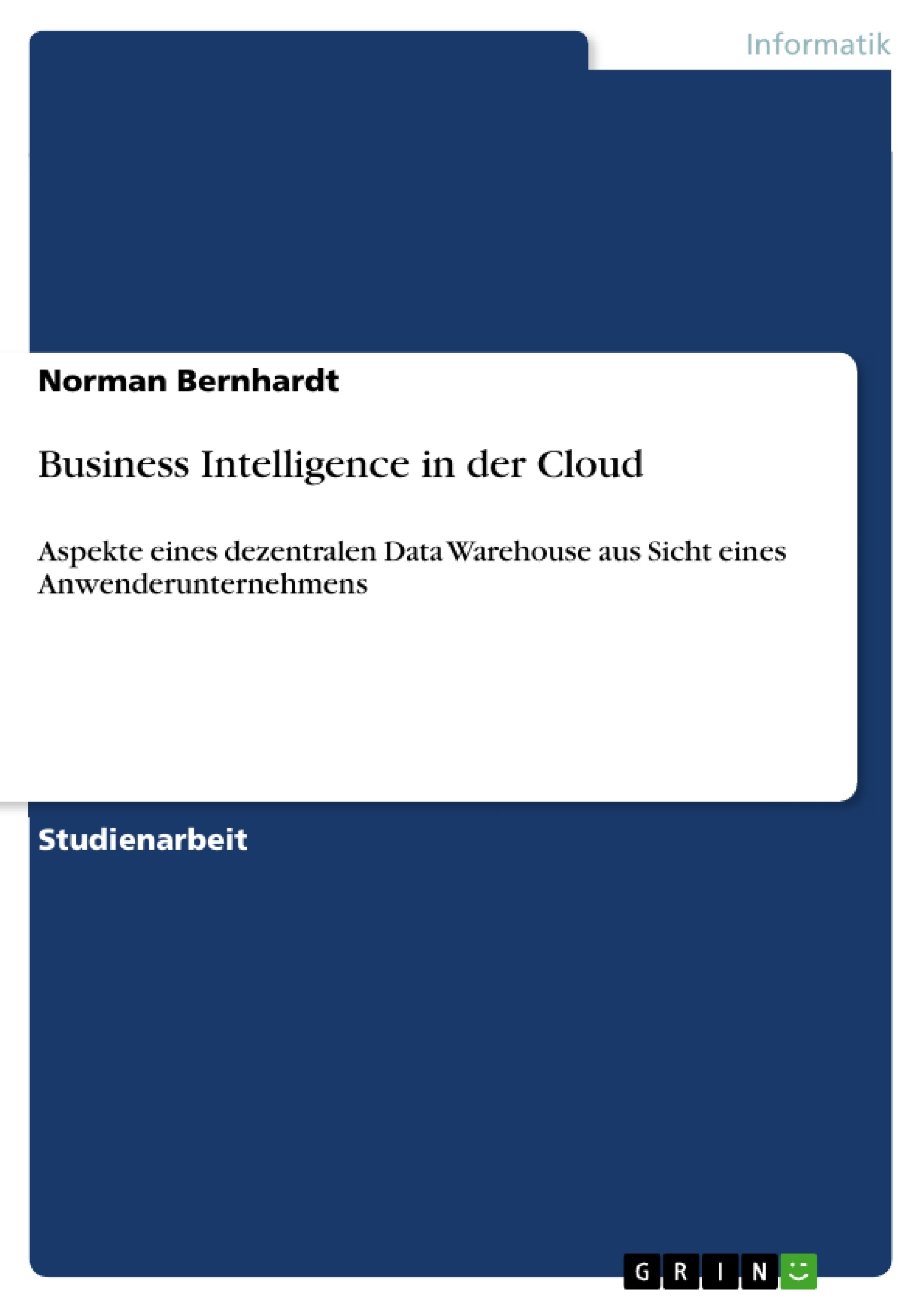In Zeiten globaler Krisen und Unsicherheiten stellt die Erhöhung der Steuerbarkeit von Unternehmen eine zentrale Aufgabe des Managements dar. Eine bessere Informationsversorgung für Entscheidungsträger, sowie Analysen von Schwachstellen und Einsparpotenzialen rücken in den Fokus.
Business Intelligence (BI)-Systeme unterstützen Unternehmen dabei, ihre geschäftskritischen Daten und Prozesse transparent zu machen und versetzen Mitarbeiter in die Lage, bessere Entscheidungen zu treffen, sowie notwendige Ergebnisse schneller zu erzielen.
Die Integration von BI-Lösungen in die Unternehmensinfrastruktur, sowie der spätere Betrieb stellen jedoch hohe Anforderungen an die IT-Abteilungen dar und sind oft mit großen Investitionen verbunden.
Ein Ansatz zur Entkopplung der betriebswirtschaftlich notwendigen BI-Lösungen von den damit unweigerlich verbundenen technischen Aspekten des Plattformbetriebs könnte das Konzept des Cloud Computing sein.
Da die „Wolke“ noch als großer und wenig transparenter Hype betrachtet wird, soll diese Hausarbeit die aus BI-Sicht bestehenden Anforderungen gegen die Aspekte einer Implementierung in der Cloud legen, und neben technischen Parametern auch auf nichtfunktionale Anforderungen eingehen.
Es gilt also die Frage zu beantworten, inwiefern BI-Lösungen nach dem Konzept des Cloud Computing umsetzbar sind.
Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis:
1. Theoretische Grundlagen der Business Intelligence
2. Theoretische Grundlagen des Cloud Computing
3. Anforderungen an Business Intelligence Lösungen
4. Business Intelligence Lösungen in der "cloud"
"BI in the cloud" Architekturen
Kritische Betrachtung des Konzepts
Vorteile und Chancen
Nachteile und Risiken
Juristische Betrachtung
Vertragliche Aspekte
Datenschutz und Datensicherheit
Wirtschaftliche Aspekte
Marktentwicklung
5.Fazit
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG
- 2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN DER BUSINESS INTELLIGENCE
- 2.1 Begriffsdefinition
- 2.1.1 Business Intelligence
- 2.1.2 Data Warehouse
- 2.1.3 Berichtswesen
- 2.1.4 Analyse
- 3 THEORETISCHE GRUNDLAGEN DES CLOUD COMPUTING
- 3.1 Begriffsdefinition
- 3.1.1 Cloud Computing
- 3.1.2 Virtualisierung
- 3.1.3 Service-orientierte Architekturen (SOA)
- 3.1.4 Web Services
- 3.2 Cloud-Architekturen
- 3.2.1 Organisatorisch
- 3.2.2 Technisch
- 3.3 Beispiele für Cloud-Angebote
- 3.3.1 Amazon Web Services
- 3.3.2 Microsoft Azure
- 4 ANFORDERUNGEN AN BUSINESS INTELLIGENCE LÖSUNGEN
- 4.1 Kriterien des Online Analytical Processing
- 4.2 FASMI Evaluierungsregeln
- 4.3 Informationsbereitstellung
- 4.3.1 Datenqualität
- 4.3.2 Geschwindigkeit des Zugriffs
- 4.3.3 Präsentation der Informationen
- 4.3.4 Sicherheitsaspekte
- 4.4 Business Intelligence Integration in die Unternehmensstrategie
- 5 BUSINESS INTELLIGENCE LÖSUNGEN IN DER "CLOUD"
- 5.1 "Bl in the cloud" Architekturen
- 5.2 Kritische Betrachtung des Konzepts
- 5.2.1 Vorteile und Chancen
- 5.2.2 Nachteile und Risiken
- 5.3 Juristische Betrachtung
- 5.3.1 Vertragliche Aspekte
- 5.3.2 Datenschutz und Datensicherheit
- 5.4 Wirtschaftliche Aspekte
- 5.5 Marktentwicklung
- 6 FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Integration von Business Intelligence (BI) Lösungen in Cloud-Umgebungen. Ziel ist es, die Vorteile und Herausforderungen dieser Kombination aus Sicht eines Anwenderunternehmens zu analysieren. Die Arbeit untersucht die theoretischen Grundlagen von BI und Cloud Computing, beleuchtet die Anforderungen an BI-Lösungen sowie die spezifischen Aspekte von BI in der Cloud.
- Definition und Bedeutung von Business Intelligence und Cloud Computing
- Anforderungen an BI-Lösungen im Kontext der Cloud
- Architektur und Funktionsweise von BI-Lösungen in der Cloud
- Vorteile und Herausforderungen der Integration von BI in die Cloud
- Juristische und wirtschaftliche Aspekte von BI in der Cloud
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und erläutert die Relevanz von BI-Lösungen in der Cloud. Kapitel 2 und 3 beleuchten die theoretischen Grundlagen von BI und Cloud Computing. Kapitel 4 definiert die Anforderungen an BI-Lösungen, wobei Aspekte wie Datenqualität, Geschwindigkeit des Zugriffs und Sicherheit im Vordergrund stehen. Kapitel 5 widmet sich der Analyse von BI-Lösungen in der Cloud, inklusive der Vorteile, Risiken und rechtlichen Rahmenbedingungen. Abschließend werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und ein Fazit gezogen.
Schlüsselwörter
Business Intelligence, Cloud Computing, Data Warehouse, Online Analytical Processing (OLAP), Service-orientierte Architekturen (SOA), Virtualisierung, Datenschutz, Datensicherheit, Wirtschaftliche Aspekte, Marktentwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist "Business Intelligence in the Cloud"?
Es bezeichnet die Bereitstellung von BI-Lösungen (Analyse, Berichtswesen) über Cloud-Computing-Modelle, um technische Plattformkosten von betriebswirtschaftlichen Zielen zu entkoppeln.
Welche Vorteile bietet BI aus der Cloud?
Vorteile sind unter anderem geringere Anfangsinvestitionen in Hardware, schnellere Skalierbarkeit und die Entlastung der internen IT-Abteilungen.
Welche Risiken bestehen bei Cloud-BI-Lösungen?
Zu den Risiken zählen Sicherheitsaspekte, Abhängigkeit vom Anbieter (Lock-in) sowie potenzielle Probleme bei der Datenqualität und Zugriffsgeschwindigkeit.
Welche juristischen Aspekte müssen beachtet werden?
Besonderes Augenmerk liegt auf vertraglichen Aspekten sowie den strengen Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit in der "Wolke".
Was sind die technischen Grundlagen für Cloud-BI?
Die Arbeit erläutert Grundlagen wie Virtualisierung, Service-orientierte Architekturen (SOA) und Web Services.
Welche Anforderungen stellen OLAP und FASMI an BI-Lösungen?
Diese Kriterien definieren die notwendige Flexibilität, Schnelligkeit und Analysefähigkeit, die eine BI-Lösung auch in einer Cloud-Umgebung erfüllen muss.
- Quote paper
- Norman Bernhardt (Author), 2010, Business Intelligence in der Cloud, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/148409