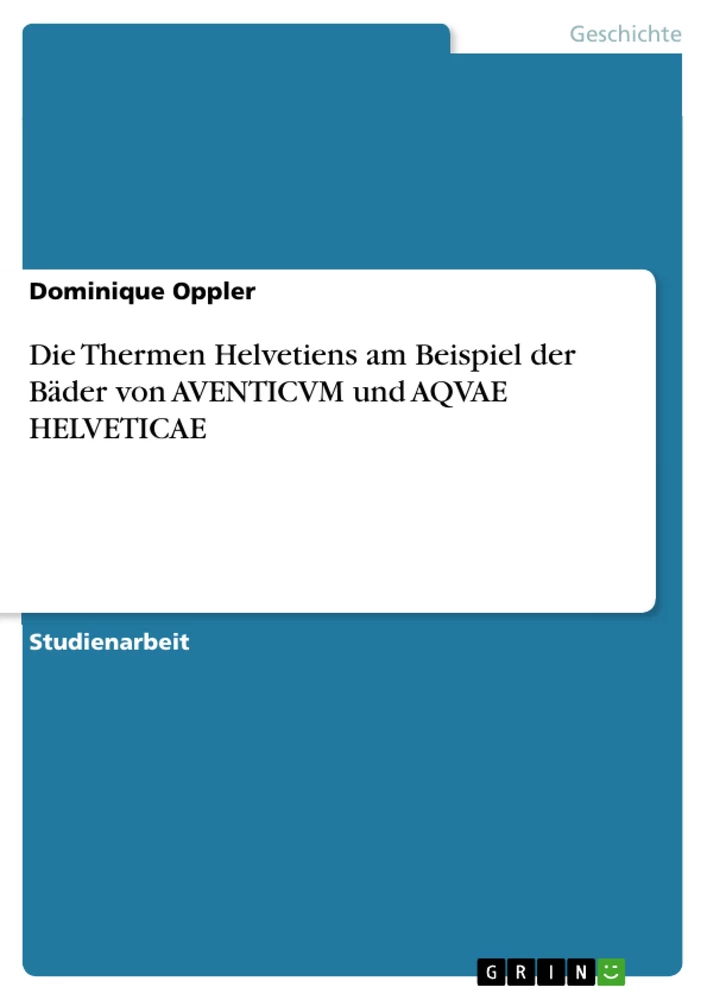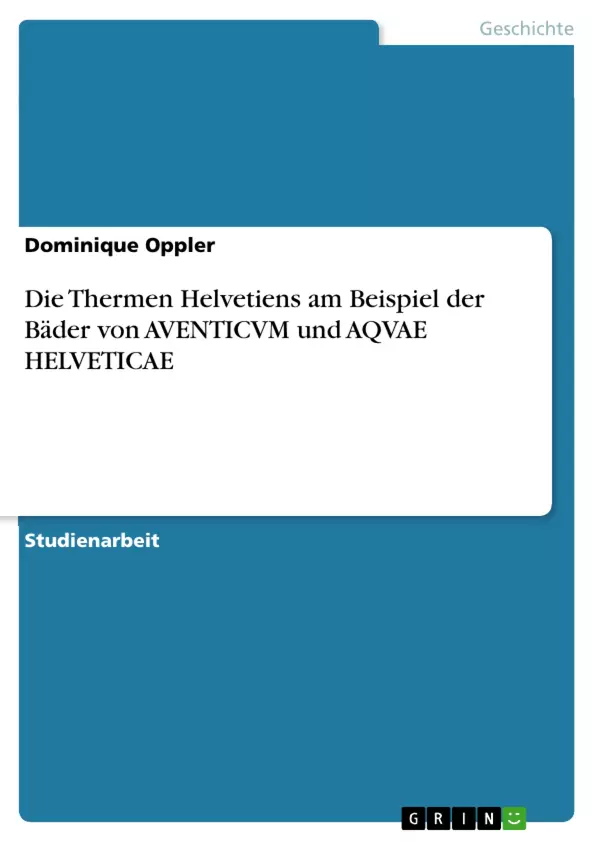Mit der Welt des Badens und der Thermen steigen wir ein in einen Themenkreis, der sich von der frühesten- bis in die heutige Zeit beinahe nahtlos verfolgen lässt. Eine Entwicklungsgeschichte die historisch, literarisch und archäologisch sehr gut dokumentiert ist.
Gebadet wird seit Menschengedenken. Aus hygienischen, gesundheitlichen, rituellen Gründen – oder einfach zum Zeitvertreib, Erholung und zum Spass.
Bäder, Schwitzbäder, sind bereits aus dem Neolithikum bekannt. Die Griechen haben das Bad domestiziert und eine eigentliche Badekultur entwickelt, diese ins römische Imperium importiert, und dort zu palastähnlichen Anlagen ausgebaut und dekoriert.
Das Baden wurde bei den Römern zu einem Grundbedürfnis und einem bedeutenden Teil des Alltagslebens. Gebadet wurde in den Städten, in öffentlichen oder privaten Bädern, auf dem Lande, praktisch jeder Vicus verfügte über eigene Bäder, und auch in ein Legionslager gehörten Thermen.
Badegewohnheiten geben einzigartige makro- und mikrologische Einblicke in den Alltag einer Bevölkerung. Thermen und Badeanlagen sind das Abbild, eine sichtbare Verdichtung sozialer, ethischer, religiöser, politischer Bedürfnisse und Gewohnheiten eines Ortes, einer Region und eines Volkes. Über den grossen politischen Coup, bis hin zur peinlichsten Intimsphäre, vermag die Architektur und die Ausstattung der Thermen zu berichten.
Mit dem Bau von Thermen war man sich der Gunst des Volkes sicher. Das hatte auch Agrippa um 19 v. Chr. erkannt. Er liess die Agrippa-Thermen in Rom erbauen und befahl den freien Eintritt in die öffentlichen Bäder für das gesamte Reich.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Römische Thermenarchitektur
- Aufbau und Badevorgang
- Bauweise
- Heizung
- Die flavischen Thermen „En Perruet\" in Aventicum
- Geschichte
- Lage der Thermen
- Räume
- Aventicum Insula 19
- Zur ersten Bauetappe: Tiberische Zeit
- Zur zweiten Bauetappe: 72 n. Chr.
- Zur dritten Bauetappe: 135 – 137 n. Chr.
- Der grosse Brunnen
- Thermen Aquae Helveticae (Baden AG)
- Geschichte
- Befunde der letzten Grabungen
- Bassin I
- Bassin II
- Nebenräume
- Weitere Bade- und Gebäudeteile
- Thermentypologisierung und Datierung
- Religion und Quellverehrung
- In Baden wird wieder gegraben
- Archäologische Zukunft
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Geschichte und Architektur römischer Thermen im Gebiet der heutigen Schweiz, am Beispiel der Bäder in Aquae Helveticae (Baden AG) und Aventicum. Die Arbeit analysiert die Entwicklung, den Aufbau und die Funktion dieser Badeanlagen, und beleuchtet die Bedeutung der Thermen im römischen Alltag und in der Kultur.
- Die Entwicklung der römischen Thermenarchitektur
- Die Funktion und der Aufbau der Thermen
- Die Bedeutung der Thermen im römischen Alltag und in der Kultur
- Die Geschichte und die archäologischen Befunde der Thermen in Aquae Helveticae und Aventicum
- Die Rolle der Thermen in der religiösen Praxis und der Quellverehrung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der römischen Thermen ein und beleuchtet deren Bedeutung in der Geschichte und Kultur. Es werden die verschiedenen Typen von Thermen und deren Aufbau beschrieben, sowie die Bedeutung des Badens im römischen Alltag.
Kapitel 2 und 3 widmen sich den Thermen in Aventicum. Es werden die Geschichte, die Lage und die Architektur der flavischen Thermen „En Perruet\" und der Thermen auf der Insula 19 beschrieben.
Kapitel 4 befasst sich mit den Thermen in Aquae Helveticae (Baden AG). Die Geschichte der Anlage, die Befunde der letzten Grabungen und die archäologische Zukunft werden beleuchtet. Es werden auch die Thermentypologisierung und die Datierung der Anlage, sowie die Rolle der Thermen in der religiösen Praxis und der Quellverehrung behandelt.
Schlüsselwörter
Römische Thermen, Thermenarchitektur, Aquae Helveticae, Aventicum, Baden AG, Geschichte, Archäologie, Badekultur, Religion, Quellverehrung, Hypokausten, Caldarium, Tepidarium, Frigidarium.
Häufig gestellte Fragen
Welche Bedeutung hatten Thermen im römischen Alltag?
Thermen waren weit mehr als Reinigungsstätten; sie dienten der Gesundheit, der Erholung, dem sozialen Austausch und waren ein zentraler Treffpunkt für alle Gesellschaftsschichten.
Was zeichnet die Thermen von Aventicum aus?
Aventicum (Avenches) besaß beeindruckende Anlagen wie die flavischen Thermen „En Perruet“, die den palastähnlichen Charakter römischer Architektur in Helvetien widerspiegeln.
Was war die Besonderheit von Aquae Helveticae?
Aquae Helveticae (das heutige Baden AG) war berühmt für seine natürlichen Thermalquellen, die bereits von den Römern intensiv für Heilzwecke und Quellverehrung genutzt wurden.
Wie funktionierte die Heizung in römischen Thermen?
Römische Thermen nutzten das Hypokausten-System, eine Fußboden- und Wandheizung, bei der heiße Luft aus einem Brennofen (Praefurnium) unter den Boden geleitet wurde.
Welche Räume gehörten standardmäßig zu einer Therme?
Typisch waren das Apodyterium (Umkleideraum), Frigidarium (Kaltbad), Tepidarium (Warmbad) und Caldarium (Heißbad).
- Quote paper
- Dominique Oppler (Author), 2010, Die Thermen Helvetiens am Beispiel der Bäder von AVENTICVM und AQVAE HELVETICAE, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150246