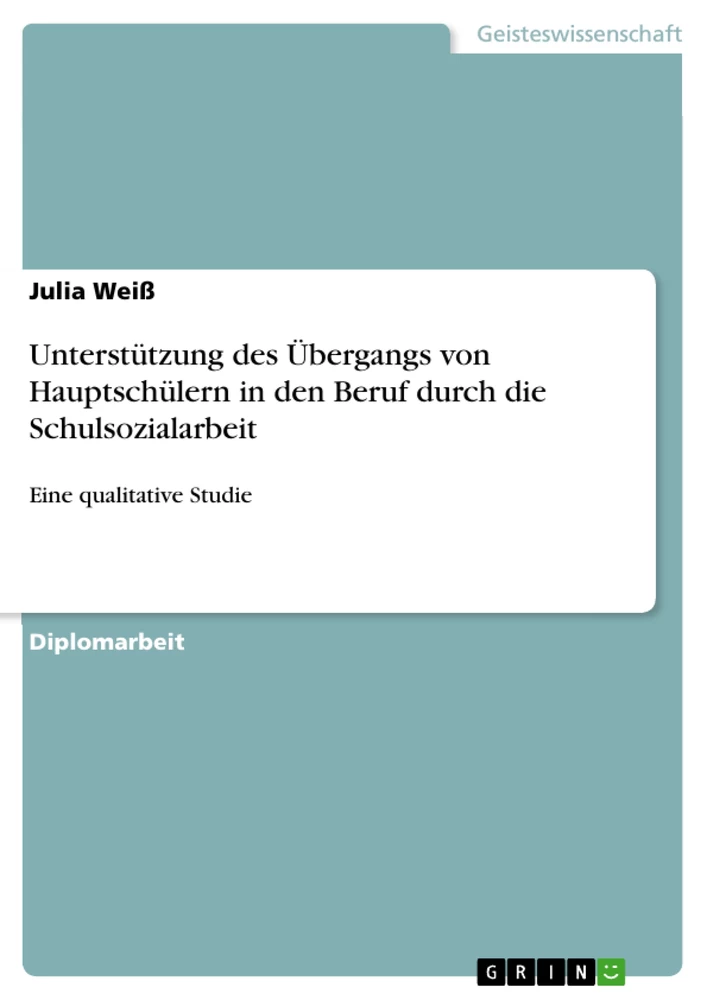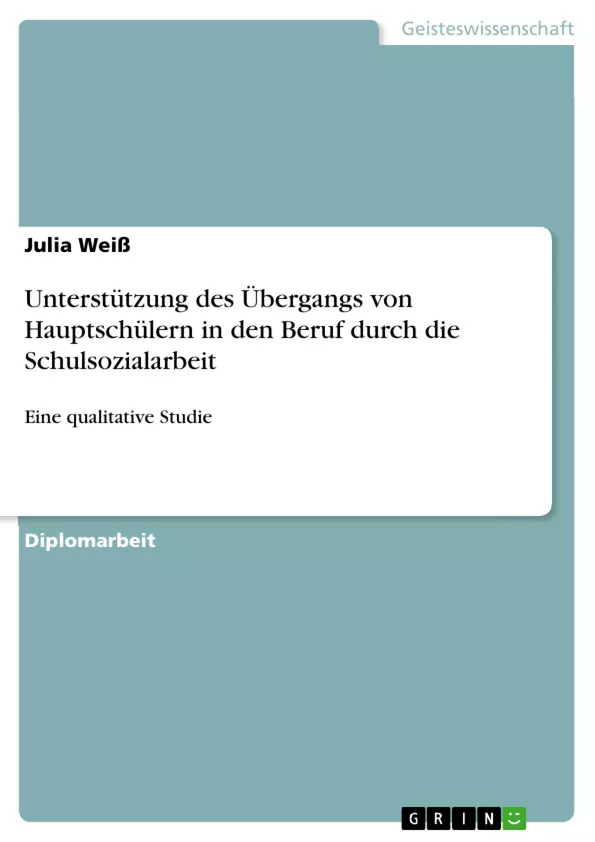Einleitung
Bereits im Juni 2004 wies Wolfgang Clement, der damalige Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, darauf hin, dass die Hauptschule zu einer Restschule verkommen sei. Er kritisierte, dass hierdurch junge Menschen mit Potenzial bei ihrer Suche nach einem Ausbildungsplatz mit vielen Absagen fertig werden müssen (vgl. Welt Online 2004). Clement machte damals auf eine Problematik aufmerksam, die sich seit einigen Jahren immer weiter verschärft hatte und die noch heute aktuell ist. Je größer der Mangel an Ausbildungsplätzen auf dem Arbeitsmarkt ist, desto größer wird auch die Konkurrenz um diese. Betriebe befinden sich oft in der Situation zwischen vielen Bewerbern auswählen zu können und laden zum Bewerbungsgespräch vorzugsweise Personen mit höheren Schulabschlüssen ein. Hauptschüler bleiben hierbei oft auf der Strecke und müssen feststellen, dass ihr Abschluss „in einem Bildungswesen, in dem auch die Schulen zu Markte getragen werden, nicht mehr konkurrenzfähig ist" (Rösner 2007, S. 13). Eine Besserung der Chancen auf dem Arbeitsmarkt ist für Hauptschüler nicht in Sicht. Die Lage wird sich in den nächsten Jahren angesichts der aktuellen Weltwirtschaftskrise vermutlich eher noch verschärfen. Daher ist es notwendig, dass den Hauptschülern Mut gemacht wird und ihnen neue Wege aufgezeigt werden. Durch eine solche Unterstützung können die Schüler zuversichtlicher in ihre Zukunft blicken und sich mit mehr Motivation aktiv um eine Ausbildung bemühen.
Eine solche Hilfestellung bietet an der Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule Albbruck eine Schulsozialarbeiterin. Sie legt einen Schwerpunkt ihrer Arbeit auf die berufliche Unterstützung der Schüler. In der vorliegenden Arbeit soll die Bedeutung dieser Unterstützung für die Schüler anhand einer qualitativen Studie untersucht werden. Diese Studie konzentriert sich darauf, wie die Schüler die berufliche Unterstützung der Schulsozialarbeit wahrnehmen und ob sie diese tatsächlich als Hilfe für ihren weiteren beruflichen Werdegang erfahren. Da eine Langzeitstudie aus zeitlichen Gründen nicht möglich war, kann die Studie allerdings keine Aussagen darüber machen, inwiefern die Unterstützung den Jugendlichen tatsächlich etwas bei ihrer späteren Ausbildungssuche und ihrem Arbeitsleben gebracht hat.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptschule
- Geschichte der Hauptschule
- Hauptschule heute
- Schüler
- Benachteiligung
- Hauptschule am Ende?
- Beruf - individuelle und gesellschaftliche Aspekte
- Recht auf freie Berufswahl
- Relevanz von Erwerbsarbeit
- Wandel der Arbeitswelt
- Wandel der Anforderungen
- Berufliche Normalbiographie
- Übergang Schule - Beruf
- Jugendarbeitslosigkeit
- Schulsozialarbeit
- Geschichte
- Rechtliche Grundlagen
- Aufgaben und Handlungsprinzipien
- Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule
- Aspekte der Unterstützung beim Übergang in den Beruf
- Schulsozialarbeit an der GHS mit WRS Albbruck
- Schule
- Schulsozialarbeit
- Berufliche Unterstützung
- Bewerbungstraining mit Wirtschaftsjunioren
- Sozialpraktikum
- Methodisches Vorgehen
- Forschungsdesign
- Qualitative Sozialforschung
- Leitfaden-Interview
- Gütekriterien
- Auswertungsmethode
- Untersuchung
- Festlegung des Materials
- Entstehungssituation
- Kontaktaufnahme
- Durchführung der Interviews
- Formale Charakteristika des Materials
- Interviewleitfaden
- Transkription
- Analyse
- Fragestellung
- Kategoriensystem
- Ergebnisse
- Susan
- Kontakt zur Arbeitswelt
- Berufliche Zukunftspläne
- Sozialpraktikum
- Bewerbungstraining mit Wirtschaftsjunioren
- Schulsozialarbeit
- Zusammenfassung
- Darija
- Kontakt zur Arbeitswelt
- Berufliche Zukunftspläne
- Sozialpraktikum
- Bewerbungstraining mit Wirtschaftsjunioren
- Schulsozialarbeit
- Zusammenfassung
- Melanie
- Kontakt zur Arbeitswelt
- Berufliche Zukunftspläne
- Sozialpraktikum
- Bewerbungstraining mit Wirtschaftsjunioren
- Schulsozialarbeit
- Zusammenfassung
- Lisa
- Kontakt zur Arbeitswelt
- Berufliche Zukunftspläne
- Sozialpraktikum
- Bewerbungstraining mit Wirtschaftsjunioren
- Schulsozialarbeit
- Zusammenfassung
- Gesamtauswertung der Kategorien
- Kontakt zur Arbeitswelt
- Berufliche Zukunftspläne
- Sozialpraktikum
- Bewerbungstraining mit Wirtschaftsjunioren
- Schulsozialarbeit
- Reflexion über den Forschungsprozess
- Auswertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Bedeutung der Schulsozialarbeit für den Übergang von Hauptschülern in den Beruf. Sie basiert auf einer qualitativen Studie, die die subjektiven Erfahrungen von Hauptschülern mit der beruflichen Unterstützung durch die Schulsozialarbeit beleuchtet.
- Die aktuelle Situation von Hauptschülern am Arbeitsmarkt
- Die Rolle der Schulsozialarbeit bei der Unterstützung des Übergangs in den Beruf
- Die Wahrnehmung der beruflichen Unterstützung durch die Schulsozialarbeit aus der Perspektive der Schüler
- Die Auswirkungen der Schulsozialarbeit auf die berufliche Orientierung und den weiteren Werdegang der Schüler
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik des Übergangs von Hauptschülern in den Beruf dar und führt in die Forschungsfrage ein. Kapitel 1 beleuchtet die Geschichte und die aktuelle Situation der Hauptschule, inklusive der Herausforderungen, denen Hauptschüler am Arbeitsmarkt gegenüberstehen. Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem Beruf und seinen individuellen und gesellschaftlichen Aspekten, wobei der Wandel der Arbeitswelt und die Relevanz von Erwerbsarbeit im Fokus stehen. Kapitel 3 gibt einen Überblick über die Schulsozialarbeit, ihre Geschichte, rechtlichen Grundlagen und Aufgaben. Kapitel 4 beschreibt die konkrete Situation an der Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule Albbruck, inklusive der Arbeit der Schulsozialarbeiterin. Das methodische Vorgehen der qualitativen Studie wird in Kapitel 5 erläutert. Kapitel 6 widmet sich der Untersuchung, der Festlegung des Materials und der Analyse der Interviews.
Schlüsselwörter
Hauptschule, Schulsozialarbeit, Übergang Schule-Beruf, Jugendarbeitslosigkeit, qualitative Forschung, Interview, berufliche Orientierung, Unterstützung, Arbeitsmarkt, Benachteiligung, Bewerbungstraining, Sozialpraktikum.
Häufig gestellte Fragen
Warum haben Hauptschüler Probleme beim Übergang in den Beruf?
Durch den Mangel an Ausbildungsplätzen und die Konkurrenz durch Bewerber mit höheren Abschlüssen wird die Hauptschule oft als „Restschule“ wahrgenommen, was die Chancen der Absolventen mindert.
Wie hilft Schulsozialarbeit beim Berufseinstieg?
Sie bietet Unterstützung durch Bewerbungstraining, Sozialpraktika und individuelle Beratung, um Schülern Mut zu machen und berufliche Wege aufzuzeigen.
Was ist das Ziel der qualitativen Studie in Albbruck?
Die Studie untersucht, wie Hauptschüler die berufliche Unterstützung durch die Schulsozialarbeit wahrnehmen und ob sie diese tatsächlich als hilfreiche Vorbereitung empfinden.
Welche Rolle spielen Wirtschaftsjunioren beim Bewerbungstraining?
In Kooperation mit der Schulsozialarbeit führen Wirtschaftsjunioren realitätsnahe Trainings durch, um den Schülern einen direkten Kontakt zur Arbeitswelt zu ermöglichen.
Können Praktika die Einstellung der Schüler verändern?
Ja, die Untersuchung zeigt, dass praktische Erfahrungen wie das Sozialpraktikum die beruflichen Zukunftspläne und die Motivation der Schüler positiv beeinflussen können.
- Quote paper
- Julia Weiß (Author), 2009, Unterstützung des Übergangs von Hauptschülern in den Beruf durch die Schulsozialarbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150332