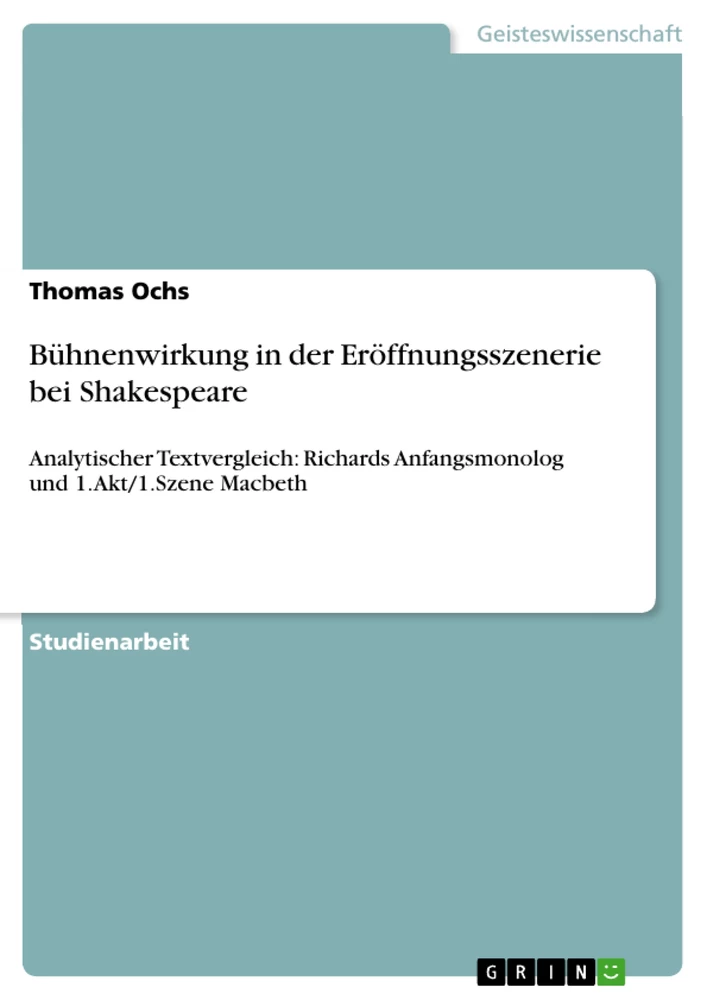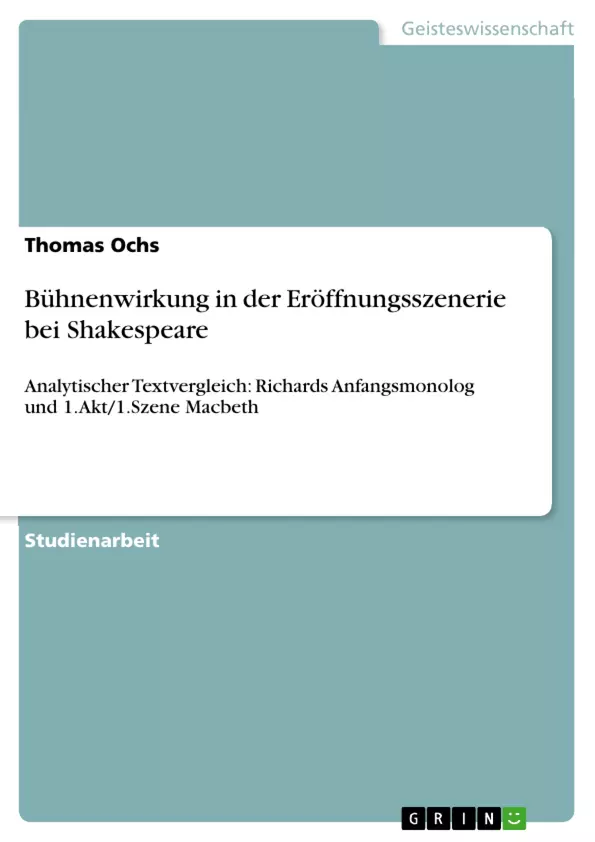Eine programmatische Anekdote aus der Verlagsarbeit und Literaturkritik besagt, dass ein literarisches Werk stark von seinen ersten Sätzen abhängig ist . Es soll anscheinend maßgeblich für die Wirkung auf den Leser sein inwieweit man sich durch den einleitenden Wortschatz, also die Sprachgewalt fasziniert bzw. beeindruckt fühlt.
Die Eröffnungsszenerien in Shakespeares Dramen würden sicherlich alle dem Anspruch genügen den Zuschauer in seinen Bann zu ziehen. Es stellt sich die Frage mit welcher Spezifität Shakespeare in das jeweilige Stück einzuleiten vermag und inwieweit die Eröffnungsszenerie im Zusammenhang mit der gesamten Thematik steht? Welche sprachlichen und rhetorischen Mittel finden in Shakespeares Werken Verwendung und auf was begründet sich der Mythos seiner bildreichen Sprache ?
Innerhalb eines textanalytischen Rahmens soll in dieser Seminararbeit grundsätzlich erörtert werden, auf welche Art und Weise Shakespeare in seine dramatischen Werke einzuleiten vermag und welche Wirkung diese ersten Verse auf das Publikum haben.
Um diesen Rahmen jedoch nicht zu sprengen, gilt es sich auf einzelne Stücke zu beschränken und die jeweilige Eröffnungsszenerie nicht übermäßig auf die Gesamthandlung zu beziehen. Anhand eines punktuellen Textvergleiches von Richard III. (Anfangsmonolog) und Macbeth (Erster Akt/1.Szene) sollten am Ende dieses wissenschaftlichen Diskurses gewisse Unterschiede und Gemeinsamkeiten hinsichtlich der Bühnenwirksamkeit - Wirkung der Szenerie aufs Publikum - der Eröffnungsszenerie bei Shakespeare zu finden sein. Inwieweit lassen sich diese wiederum auf eine allgemeine Formel herunter brechen?
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Bühnenwirkung im Anfangsmonolog Richard des Dritten
3. Bühnenwirkung in Macbeth: Erster Akt/ 1. Szene
4. Analytischer Textvergleich: Bühnenwirkung von Richard III. (Monolog) und Macbeth (Erster Akt/1. Szene)
5. Schlussbemerkung
6. Literatur- und Quellenverzeichnis
1. Einleitung
Eine programmatische Anekdote aus der Verlagsarbeit und Literaturkritik besagt, dass ein literarisches Werk stark von seinen ersten Sätzen abhängig ist[1]. Es soll anscheinend maßgeblich für die Wirkung auf den Leser sein inwieweit man sich durch den einleitenden Wortschatz, also die Sprachgewalt fasziniert bzw. beeindruckt fühlt.
Die Eröffnungsszenerien in Shakespeares Dramen würden sicherlich alle dem Anspruch genügen den Zuschauer[2] in seinen Bann zu ziehen. Es stellt sich die Frage mit welcher Spezifität Shakespeare in das jeweilige Stück einzuleiten vermag und inwieweit die Eröffnungsszenerie im Zusammenhang mit der gesamten Thematik steht? Welche sprachlichen und rhetorischen Mittel finden in Shakespeares Werken Verwendung und auf was begründet sich der Mythos seiner bildreichen Sprache[3] ?
Innerhalb eines textanalytischen Rahmens soll in dieser Seminararbeit grundsätzlich erörtert werden, auf welche Art und Weise Shakespeare in seine dramatischen Werke einzuleiten vermag und welche Wirkung diese ersten Verse auf das Publikum haben.
Um diesen Rahmen jedoch nicht zu sprengen, gilt es sich auf einzelne Stücke zu beschränken und die jeweilige Eröffnungsszenerie nicht übermäßig auf die Gesamthandlung zu beziehen. Anhand eines punktuellen Textvergleiches von Richard III. (Anfangsmonolog) und Macbeth (Erster Akt/1.Szene) sollten am Ende dieses wissenschaftlichen Diskurses gewisse Unterschiede und Gemeinsamkeiten hinsichtlich der Bühnenwirksamkeit - Wirkung der Szenerie aufs Publikum - der Eröffnungsszenerie bei Shakespeare zu finden sein. Inwieweit lassen sich diese wiederum auf eine allgemeine Formel herunter brechen?
2. Bühnenwirkung im Anfangsmonolog Richard des Dritten
Mit der dominanten Kraft eines machtgierigen Selbstporträts führt die Titelfigur Richard der Dritte den Zuschauer monologisch in das Geschehen ein[4]. Die Deutlichkeit und Ehrlichkeit mit der Richard auftritt und sowohl seine „Mißgestalt“[5] wie auch seine verräterischen Absichten[6] preisgibt, nutzt Shakespeare um mehrere Elemente des Stückes von Beginn an zu etablieren und vor allem um den Zuschauer ins Vertrauen zu ziehen. Die Funktion als einziger Mitwissender über Richards Vorhaben und Gedanken macht den Zuschauer zum einen zu einem Teil des Geschehens und zum anderen fungiert diese Offenheit insoweit als Spannungsmotor, da man gespannt sein kann, wie Richard sein Ziel verwirklichen wird und wie er die anderen Figuren zu täuschen vermag[7].
Shakespeare hat das Innenleben seiner Figuren zum eigentlichen Thema seines Theaters gemacht, und er hat die Erforschung dieses Lebens bis an den Punkt des Wahnsinns, des Selbstzweifels getrieben.[8]
Der Zuschauer weiß aufgrund des Anfangsmonologes was Richard vor hat[9] bzw. wirklich in seinem Inneren denkt und ist sich gleichzeitig seiner Falschheit[10], Einsamkeit[11] bewusst. Richard stellt von Anfang an klar, dass es im weiteren Geschehen um „Komplotte“, „Weissagungen“, „Schmähungen“ und Tod gehen wird[12]. Der Frieden ist vorbei[13]. Der narzisstische[14] Herzog von Gloucester, „lahm und ungestalt“[15], „befleißigt“ sich in seinem Monolog „trocken gesetzter Pointen und geschliffener ironischer Formulierungen []“[16], wodurch er gerade in der englischen Fassung rhythmisch und klanglich über sprachliche Mittel wie beispielsweise Binnenreime, Alliterationen, Anaphern und Assonanzen[17] das Publikum in seinen verführerischen Bann zu ziehen vermag[18].
[...]
[1] Anm. Dieser Aspekt wird gerade durch die Tatsache unterstrichen, dass der einleitende Satz des Romans ‚Butt’ von Günter Grass im Jahre 2007 von der Stiftung Lesen und der Initiative deutsche Sprache zu dem schönsten ersten Satz gekürt wurde.
[2] Anm. Shakespeares Stücke sind eigentlich als Bühnenstücke konzipiert.
[3] Anm. Zur Zeit des elisabethanischen Theaters gab es wenige Möglichkeiten Atmosphären mittels eines Bühnenbildes zu erzeugen; es wurde beispielsweise immer tagsüber gespielt; Nacht darzustellen war nur mittels Worten möglich.
[4] Anm. Szenerie wird durch 1 Figur eröffnet; durch 1 langen Monolog; kein Dialog; es geht hier nur um Richard.
[5] William Shakespeare, König Richard III.. Zweisprachige Ausgabe, Übers. Frank Günther, München: DTV 2001, V. 27.
[6] Vgl: Ebd. V. 30-38.
[7] Maria-Beate Loeben, „Shakespeares sprachliche Ironie und die Entwicklung seiner Dramatik”, Diss., Ludwig-Maximilians-Universität München 1965, S. 36.
[8] Kümmel, Peter, „Erfindung der modernen Seele“, Die Zeit 2008/19, http://www.zeit.de/2008/19/OdE28-Theater?page=all, 17.01.2009.
[9] Vgl: William Shakespeare, König Richard III., V. 30-35.
[10] Vgl: Ebd. V. 37.
[11] Vgl: Ebd. V. 25-28; Vgl: Manfred Brauneck, Die Welt als Bühne 1, Stuttgart/Weimar: Metzler 1993, S. 615.
[12] Vgl: Ebd. V. 32-35.
[13] Vgl: Ebd. V. 1-14, Anm. beschriebene Idylle des ‚Nun’ (V. 1) wird durchbrochen durch ‚Doch ich’ (V. 14).
[14] Anm.: 11 Mal selbst beschreibende Pronomen verwendet; Vgl: Ebd. V. 14-23 bzw. Richards Vergnügen seinen Schatten zu beobachten; Vgl: Ebd. V. 26.
[15] Ebd. V. 22.
[16] Ebd. S. 316.
[17] Vgl: Ebd. S. 10, Binnenreim (V. 3); Anapher (V. 6-8); Alliteration (V. 4-5); Assonanzen (V. 6-8).
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Textanalyse?
Diese Seminararbeit erörtert, auf welche Art und Weise Shakespeare in seine dramatischen Werke einzuleiten vermag und welche Wirkung diese ersten Verse auf das Publikum haben. Es wird ein Textvergleich von Richard III. (Anfangsmonolog) und Macbeth (Erster Akt/1.Szene) durchgeführt, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten hinsichtlich der Bühnenwirksamkeit der Eröffnungsszenerie bei Shakespeare zu finden.
Was ist die Bedeutung des Anfangsmonologs in Richard III.?
Der Anfangsmonolog dient dazu, den Zuschauer ins Vertrauen zu ziehen, indem Richard seine "Mißgestalt" und verräterischen Absichten offenbart. Der Zuschauer wird zum Mitwissenden und die Offenheit dient als Spannungsmotor.
Welche sprachlichen Mittel setzt Shakespeare in Richard III. ein?
Shakespeare verwendet rhythmische und klangliche Mittel wie Binnenreime, Alliterationen, Anaphern und Assonanzen, um das Publikum in seinen Bann zu ziehen.
Was macht Shakespeares Sprache so bildreich und wirkungsvoll?
Zur Zeit des elisabethanischen Theaters gab es wenige Möglichkeiten Atmosphären mittels eines Bühnenbildes zu erzeugen; es wurde beispielsweise immer tagsüber gespielt; Nacht darzustellen war nur mittels Worten möglich.
Was ist der Unterschied zwischen den Eröffnungsszenerien von Richard III. und Macbeth, laut dieser Analyse?
Die Analyse zielt darauf ab, Unterschiede und Gemeinsamkeiten hinsichtlich der Bühnenwirksamkeit der Eröffnungsszenerien in den beiden Stücken zu finden. Die Ergebnisse des Textvergleichs werden im weiteren Verlauf der Arbeit präsentiert.
Warum wird die Bühnenwirkung so stark betont?
Shakespeares Stücke sind eigentlich als Bühnenstücke konzipiert, daher ist die Wirkung auf das Publikum von großer Bedeutung.
Was wird im ersten Akt, erste Szene von Macbeth analysiert?
Diese Seminararbeit analysiert die sprachlichen Mittel und die Bühnenwirksamkeit in der Eröffnungsszene von Macbeth, um sie mit Richard III. zu vergleichen. Die Analyse zielt darauf ab, festzustellen, wie Shakespeare das Publikum durch die ersten Verse fesselt.
- Citation du texte
- Thomas Ochs (Auteur), 2009, Bühnenwirkung in der Eröffnungsszenerie bei Shakespeare, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150608