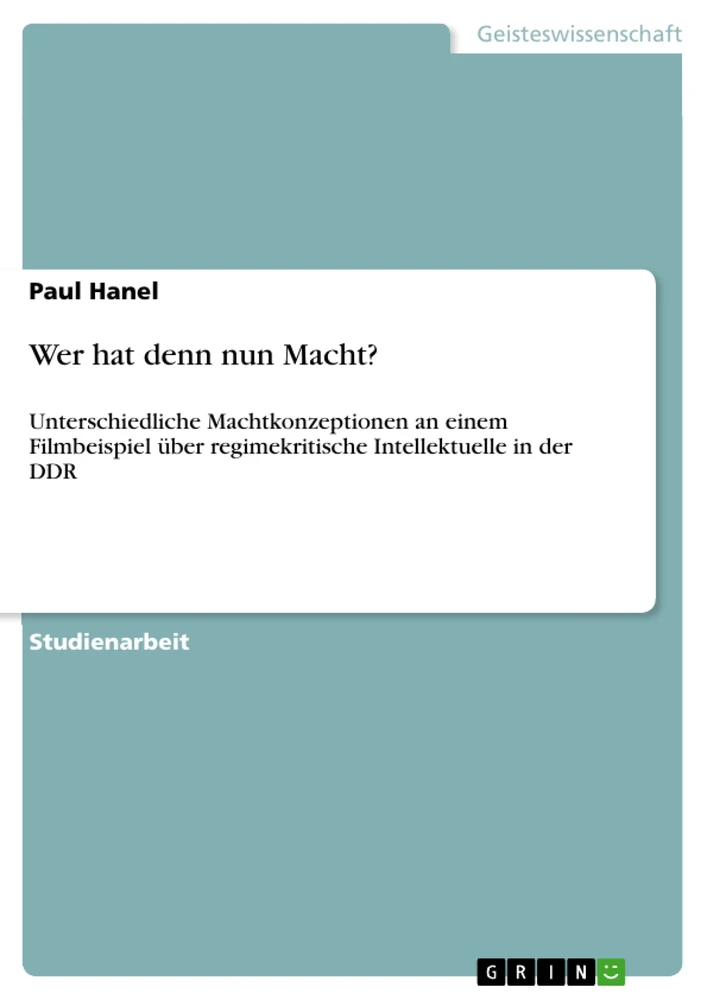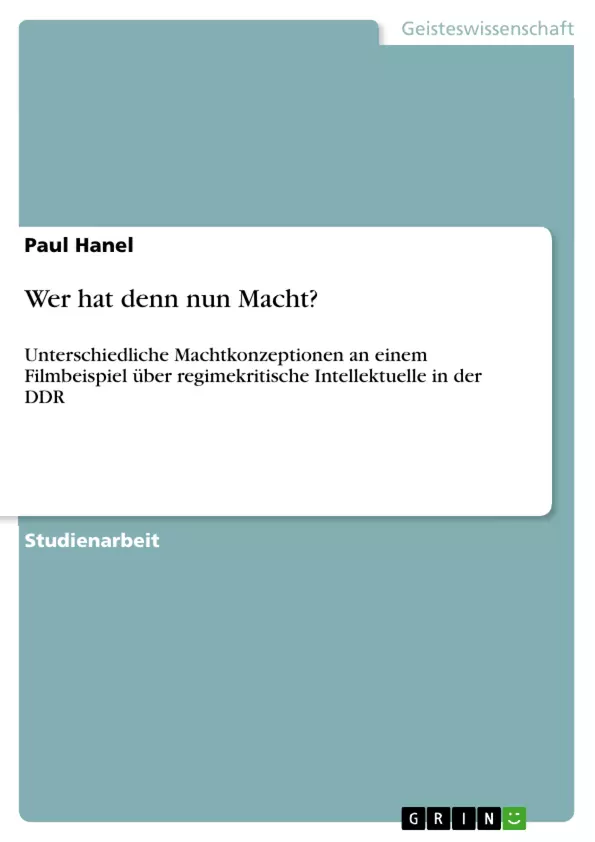Es soll anhand des Films „Das Leben der Anderen“ von Florian Henckel von Donnersmarck(2006) untersucht werden, inwieweit die regimekritischen Intellektuellen in der DDR die Regierung und insbesondere den Staatssicherheitsdienst (kurz SSD oder „Stasi“) beeinflussten und besonders ob es gerechtfertigt ist, in diesem Zusammenhang von Macht und Herrschaft im weberschen Sinne (Weber 1976) zu sprechen. Zusätzlich soll die Baumannsche Definition von
Macht (Baumann 2000) zur Beschreibung herangezogen werden.
Nach einem Überblick über den für diese Arbeit relevanten Filmteil wird die Situation der (regimekritischen) Intellektuellen in der DDR allgemein beschrieben, ehe mithilfe der oben genannten Konstrukte näher auf das Beispiel in dem oben genannten Film eingegangen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zusammenfassung des Films „Das Leben der Anderen“
- Oppositionelle Intellektuelle in der DDR
- Ufassen die Definitionen von Macht und Herrschaft von Max Weber (1976) das ausgewählte Beispiel?
- Inwieweit umfasst Baumanns (2000) Konstrukt der Macht das ausgewählte Beispiel?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Einfluss regimekritischer Intellektueller in der DDR auf den Regierungsapparat und insbesondere den Staatssicherheitsdienst (Stasi), mit besonderem Augenmerk auf die Frage, ob von Macht und Herrschaft im weberschen Sinne gesprochen werden kann. Dazu wird der Film „Das Leben der Anderen“ von Florian Henckel von Donnersmarck (2006) als Beispiel herangezogen, um die Konzepte von Macht und Herrschaft nach Max Weber (1976) und Zygmunt Bauman (2000) zu analysieren.
- Die Rolle von Oppositionellen in der DDR
- Macht und Herrschaft im weberschen Sinne
- Baumannsche Definition von Macht
- Analyse des Films „Das Leben der Anderen“
- Die Bedeutung von Intellektuellen in Zeiten von Repression
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Arbeit untersucht den Einfluss regimekritischer Intellektueller in der DDR auf den Regierungsapparat mithilfe des Films „Das Leben der Anderen“. Ziel ist es, die weberschen Konzepte von Macht und Herrschaft sowie Baumanns Definition von Macht im Kontext des Films zu analysieren.
Zusammenfassung des Films „Das Leben der Anderen“
Der Film zeigt die Arbeit des Stasi-Hauptmanns Gerd Wiesler, der mit der Überwachung des Dramatikers Georg Dreyman beauftragt wird. Während der Überwachung beginnt Wiesler, an seiner Loyalität zur DDR-Regierung zu zweifeln und unterstützt Dreyman heimlich in seinen oppositionellen Aktivitäten.
Oppositionelle Intellektuelle in der DDR
Oppositionelle Gruppen hatten es in der DDR schwer. Die Stasi gelang es, Inoffizielle Mitarbeiter (IM) in Oppositionelle Gruppen einzuschleusen und deren politische Wirkung einzuschränken. Intellektuelle spielten eine wichtige Rolle als Gewissen der Gesellschaft, hielten den politisch Mächtigen einen Spiegel vor und dienten als öffentliche Vorbilder.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Macht und Herrschaft, Opposition, Intellektuelle, DDR, Stasi, „Das Leben der Anderen“, Max Weber, Zygmunt Bauman, Regimekritik, Filmbeispiel.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Macht im Film „Das Leben der Anderen“ analysiert?
Die Arbeit untersucht anhand des Films, wie regimekritische Intellektuelle trotz staatlicher Repression Einfluss auf den Staatssicherheitsdienst (Stasi) ausübten und ob dies als Macht im Sinne von Max Weber gelten kann.
Was ist Max Webers Definition von Macht und Herrschaft?
Weber definiert Macht als die Chance, den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen. Herrschaft hingegen ist die Chance, für einen Befehl bei angebbaren Personen Gehorsam zu finden.
Welche Rolle spielten oppositionelle Intellektuelle in der DDR?
Intellektuelle fungierten oft als das "Gewissen der Gesellschaft". Sie hielten den politisch Mächtigen einen Spiegel vor und dienten als öffentliche Vorbilder, was sie zu einem primären Ziel der Stasi-Überwachung machte.
Wie geht Zygmunt Bauman mit dem Begriff der Macht um?
Baumans Definition von Macht wird in der Arbeit herangezogen, um die subtileren Formen der Beeinflussung und Kontrolle in einem repressiven System wie der DDR zu beschreiben.
Konnte die Stasi die Wirkung von Oppositionellen vollständig unterdrücken?
Obwohl die Stasi massiv Inoffizielle Mitarbeiter (IM) einschleuste, zeigt das Beispiel im Film, dass die moralische Integrität Einzelner die Überwacher selbst beeinflussen und somit eine Form von Gegenmacht erzeugen konnte.
- Quote paper
- Paul Hanel (Author), 2010, Wer hat denn nun Macht? , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151133