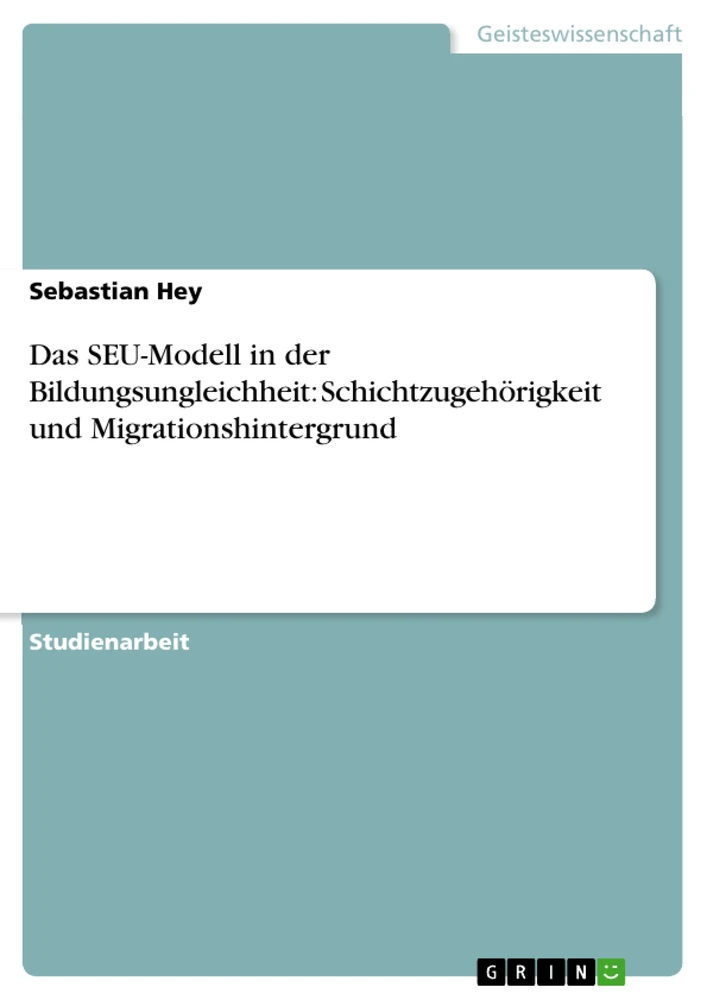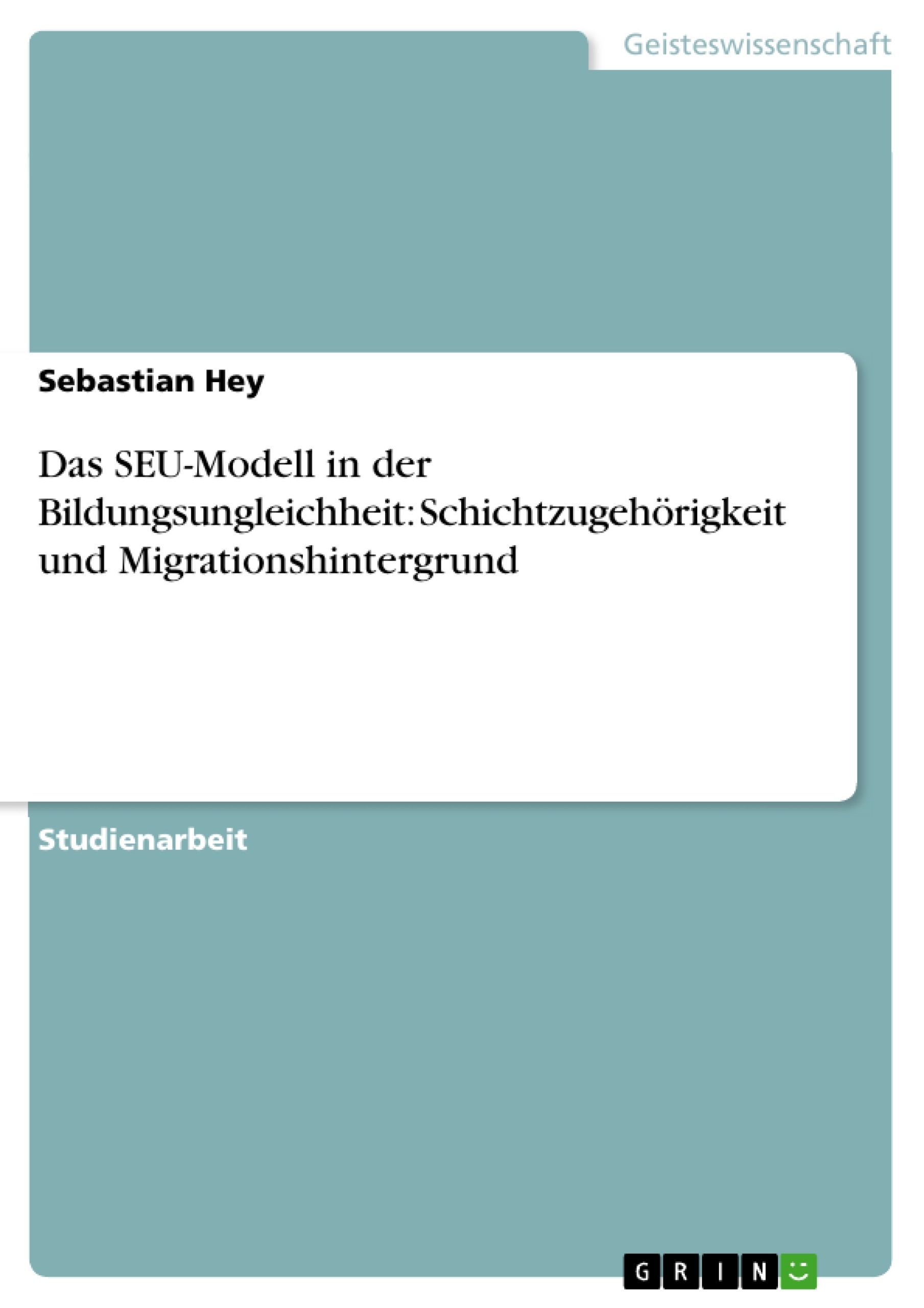In der heutigen Medienlandschaft wird häufig thematisiert und in erster Linie pauschalisiert, dass vor allem Jugendliche mit Migrationshintergrund schulisch schlechter abschneiden und sich somit später im Arbeitsmarkt schlechter eingliedern können. Dies geht hin bis zu bewussten Vorwürfen der Diskriminierung. Es herrscht aber immer noch Freiheit bei der Wahl der Bildungseinrichtung und jedem ist es rechtlich freigestellt seine schulische Laufbahn selbst zu bestimmen.
Nun stellt sich die Frage, ob sich diese Behauptungen empirisch belegen lassen und wenn ja, warum dies so ist. Wäre es denkbar, dass nicht der Migrationshintergrund als solcher die schulische
Laufbahn beeinflusst, sondern bestimmte ethnische Gruppen in bestimmten Schichten der deutschen Gesellschaft stärker repräsentiert sind und somit eher die Schichtzugehörigkeit eine Rolle spielt?
Diese Arbeit soll sich vorrangig mit dieser Frage nach dem Einfluss der sozioökonomischen Zugehörigkeit beschäftigen. Als Hilfsmittel dient hierbei auf theoretischer Ebene der Esser'sche Rational-Choice-Ansatz und diverse Studien, die sich sowohl mit dem Einfluss von Schicht-Zugehörigkeit, als auch dem des Migrationshintergrundes auf den schulischen Werdegang beschäftigen. Des weiteren soll die Frage beantwortet werden - sollte ein Effekt der ethnischen Zugehörigkeit vorliegen - ob es Unterschiede zwischen den verschiedenen Gruppen ethnischer Minderheiten in Deutschland gibt, wovon mehrere Studien berichten und warum sich diese auf die Schichten der Gesellschaft verteilen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Zum Einfluss der sozialen Herkunft
- 2.2 Rational-Choice-Ansatz / SEU-Modell
- 3. Empirie & Anwendung der Theorie
- 3.1 Statusreproduktion im deutschen Schulsystem
- 3.2 Einfluss des Migrationshintergrundes
- 4. Fazit und bildungspolitischer Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Einfluss der sozioökonomischen Zugehörigkeit auf die Wahl der weiterführenden Schule, insbesondere den Übergang in die Sekundarstufe I. Dabei wird der Fokus auf die Frage gelegt, ob der Migrationshintergrund an sich oder eher die Schichtzugehörigkeit, in der bestimmte ethnische Gruppen überrepräsentiert sind, den schulischen Werdegang beeinflusst. Die Arbeit nutzt den Esser'schen Rational-Choice-Ansatz als theoretisches Rahmenmodell und bezieht sich auf diverse empirische Studien.
- Einfluss der sozioökonomischen Schichtzugehörigkeit auf den Bildungsverlauf
- Anwendung des Rational-Choice-Ansatzes (SEU-Modell) zur Erklärung von Bildungsentscheidungen
- Rolle des Migrationshintergrunds im Kontext sozialer Schichtzugehörigkeit
- Statusreproduktion im deutschen Schulsystem
- Implikationen für die bildungspolitische Diskussion
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einleitung thematisiert die gängige, aber oft pauschalisierende Darstellung von schulischen Problemen bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Sie hinterfragt die These, ob der Migrationshintergrund selbst oder die soziale Schichtzugehörigkeit den entscheidenden Einfluss auf den Bildungsverlauf hat. Die Arbeit konzentriert sich auf den Einfluss der sozioökonomischen Zugehörigkeit und nutzt dazu den Rational-Choice-Ansatz sowie empirische Studien, um den Einfluss von Schichtzugehörigkeit und Migrationshintergrund zu untersuchen. Sie beleuchtet die Frage nach möglichen Unterschieden zwischen verschiedenen Gruppen ethnischer Minderheiten und deren Verteilung über die Gesellschaftsschichten. Abschließend wird die Notwendigkeit einer bildungspolitischen Überarbeitung in Betracht gezogen, die sich nicht nur auf Minderheiten, sondern auch auf bildungsferne Menschen deutscher Herkunft konzentriert. Der Fokus liegt auf dem Übergang in die Sekundarstufe I, welcher stark vom sozialen Umfeld, insbesondere den Eltern, beeinflusst wird.
2. Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel legt den theoretischen Grundstein der Arbeit. Zunächst wird der Einfluss der sozialen Herkunft auf Bildungsentscheidungen diskutiert, wobei Hartmut Essers Feststellung hervorgehoben wird, dass sich trotz Reformen die Bildungsungleichheit zwischen den Schichten kaum verändert hat. Der Esser'sche Rational-Choice-Ansatz und das SEU-Modell werden eingeführt. Es wird erläutert, wie Individuen Kosten und Nutzen von Bildungsentscheidungen abwägen, wobei neben direkten Kosten auch Opportunitätskosten und Statusverlust eine Rolle spielen. Das SEU-Modell wird vorgestellt und vereinfacht dargestellt, wobei die Bedeutung der Wahrscheinlichkeit des Bildungserfolgs, des erwarteten Nutzens und des Statusverlusts für die Entscheidung über die Schulwahl erläutert wird. Die Formel wird detailliert erklärt und auf die Motivation zur Bildung und das Investitionsrisiko bezogen. Die Bedeutung des niedrigen Ausgangsstatus und der Unsicherheit des Bildungserfolgs für die Bildungsentscheidung wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Bildungsungleichheit, Soziale Schicht, Migrationshintergrund, Rational-Choice-Ansatz, SEU-Modell, Statusreproduktion, Sekundarstufe I, Bildungspolitik, sozioökonomische Zugehörigkeit, ethnische Minderheiten.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Sozioökonomische Einflüsse auf die Schulwahl
Was ist das Thema der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht den Einfluss der sozioökonomischen Zugehörigkeit, insbesondere den Migrationshintergrund und die soziale Schicht, auf die Wahl der weiterführenden Schule, fokussiert auf den Übergang in die Sekundarstufe I. Es wird hinterfragt, ob der Migrationshintergrund an sich oder die soziale Schichtzugehörigkeit den entscheidenden Einfluss auf den Bildungsverlauf hat.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit verwendet den Rational-Choice-Ansatz nach Hartmut Esser und das SEU-Modell (Subjective Expected Utility) als theoretischen Rahmen. Dieses Modell hilft zu verstehen, wie Individuen Kosten und Nutzen von Bildungsentscheidungen abwägen, indem sie Wahrscheinlichkeit des Erfolgs, erwarteten Nutzen und potentiellen Statusverlust berücksichtigen.
Welche empirischen Aspekte werden behandelt?
Die Arbeit bezieht sich auf empirische Studien zur Statusreproduktion im deutschen Schulsystem und untersucht den Einfluss des Migrationshintergrunds im Kontext der sozialen Schichtzugehörigkeit. Sie analysiert, wie sich die sozioökonomische Schichtzugehörigkeit auf den Bildungsverlauf auswirkt und ob Unterschiede zwischen verschiedenen Gruppen ethnischer Minderheiten bestehen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einführung, die den Forschungsstand und die Fragestellung darlegt; einen theoretischen Hintergrund mit der Erläuterung des Rational-Choice-Ansatzes und des SEU-Modells; ein Kapitel zur Empirie und Anwendung der Theorie mit Fokus auf Statusreproduktion und Migrationshintergrund; und ein Fazit mit bildungspolitischen Ausblicken.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bildungsungleichheit, Soziale Schicht, Migrationshintergrund, Rational-Choice-Ansatz, SEU-Modell, Statusreproduktion, Sekundarstufe I, Bildungspolitik, sozioökonomische Zugehörigkeit, ethnische Minderheiten.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass die soziale Schichtzugehörigkeit einen maßgeblichen Einfluss auf die Schulwahl hat. Der Migrationshintergrund wirkt sich eher indirekt über die soziale Schicht aus. Die Arbeit unterstreicht die Notwendigkeit einer bildungspolitischen Überarbeitung, die sich nicht nur auf Minderheiten, sondern auch auf bildungsferne Menschen deutscher Herkunft konzentriert.
Welche Rolle spielt der Migrationshintergrund?
Die Arbeit untersucht, ob der Migrationshintergrund an sich oder die damit oft verbundene soziale Schichtzugehörigkeit den Bildungsverlauf stärker beeinflusst. Es wird analysiert, ob es Unterschiede zwischen verschiedenen ethnischen Minderheiten gibt und wie diese über die Gesellschaftsschichten verteilt sind.
Wie wird der Rational-Choice-Ansatz angewendet?
Der Rational-Choice-Ansatz und das SEU-Modell werden genutzt, um die Bildungsentscheidungen von Individuen zu erklären. Es wird untersucht, wie Kosten (z.B. finanzielle Kosten, Opportunitätskosten, Statusverlust) und Nutzen (z.B. erwarteter beruflicher Erfolg) abgewogen werden und wie diese Abwägung von Faktoren wie der Wahrscheinlichkeit des Bildungserfolgs und dem Ausgangsstatus beeinflusst wird.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung ist es, den Einfluss der sozioökonomischen Zugehörigkeit auf die Wahl der weiterführenden Schule zu untersuchen und die Rolle des Migrationshintergrunds in diesem Kontext zu beleuchten. Die Arbeit will ein besseres Verständnis der Bildungsungleichheit schaffen und Implikationen für die Bildungspolitik aufzeigen.
- Arbeit zitieren
- Sebastian Hey (Autor:in), 2009, Das SEU-Modell in der Bildungsungleichheit: Schichtzugehörigkeit und Migrationshintergrund, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151751