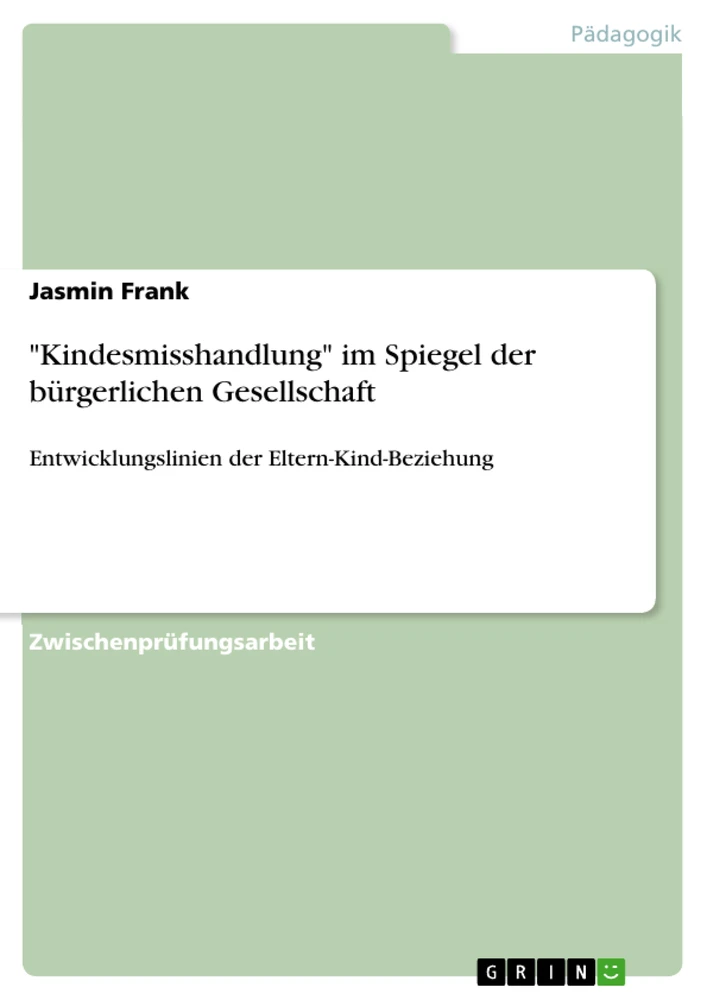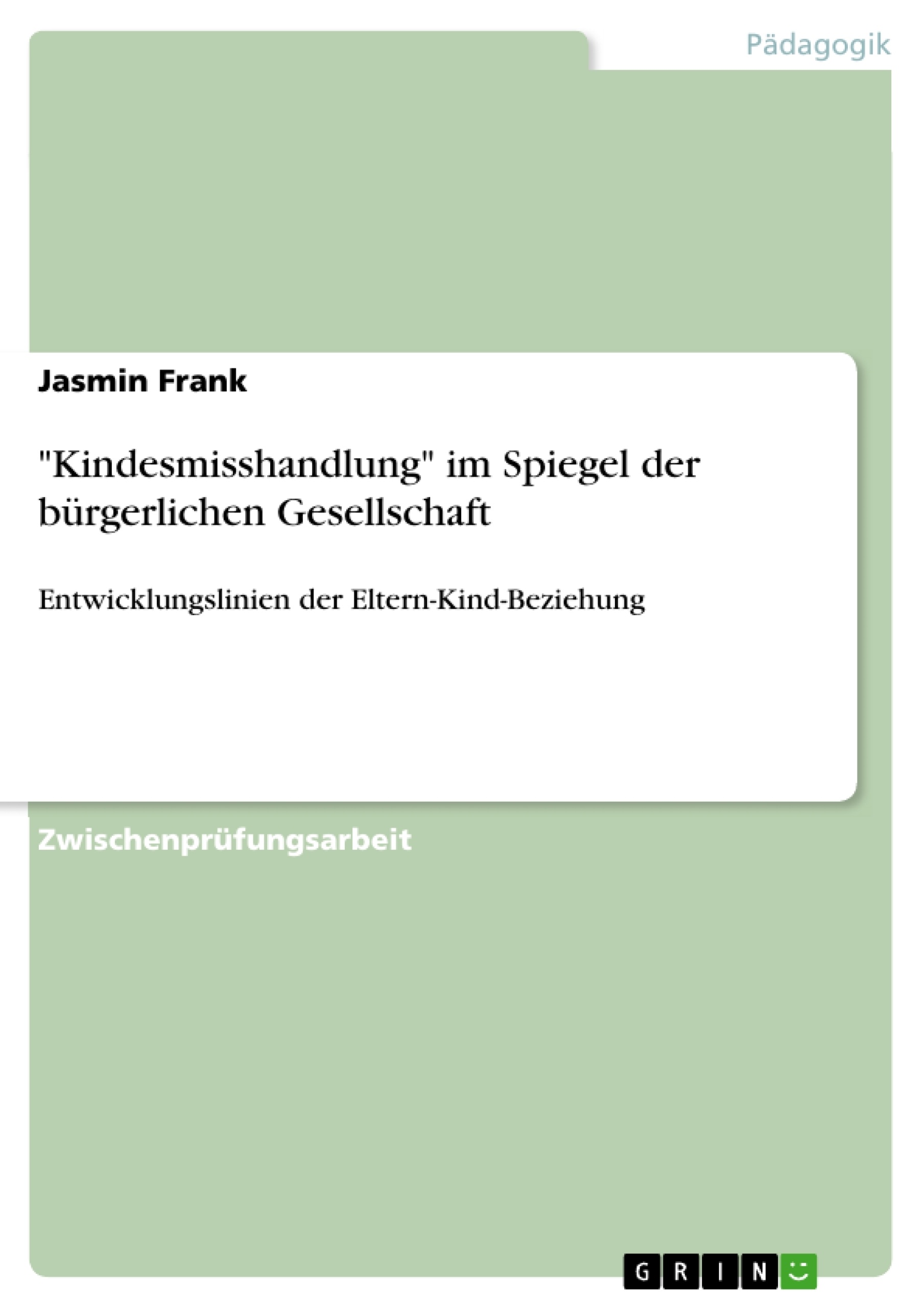Einleitung
Das 18. Jahrhundert wird gemeinhin auch als das 'pädagogische Jahrhundert' bezeichnet. Studiert man geschichtliche Texte und Quellen, werden die Gründe für diese Bezeichnung deutlich, von denen hier einige grob zusammengefasst werden sollen. Der Rationalismus, der bereits im Barock hervortritt, erreicht im Zeitalter der Aufklärung seinen vorläufigen Höhepunkt: der Mensch wird als Individuum wahrgenommen, wenn auch noch nicht als
'Individualität'. Die Gleichheit und Freiheit des Menschen rückt in den Vordergrund, durch das Vertrauen in die Ratio soll der Mensch befreit werden von Absolutismus und kirchlicher Autorität. „Der zentralistische Machtstaat des Barockzeitalters,(...) wird in
der Aufklärungsepoche allmählich zum Wohlfahrts- und Rechtsstaat.“
In Folge von politischen und wirtschaftlichen Wandlungen werden auch die Standesschranken gelockert, so dass eine weltbürgerliche Einstellung entstehen kann, das heißt, Hof und Adel verlieren an Bedeutung, das Bürgertum rückt an ihre Stelle im politischen wie sozialen Bereich. Das 18. Jahrhundert ist geprägt von Vernunftgläubigkeit und Autoritätsfeindlichkeit.
Neue Freiheiten entstehen, auf dem Gebiet der Religion ebenso wie auf dem Gebiet des Denkens.
Durch eine solche Skizzierung entsteht leicht der Eindruck, das pädagogische Jahrhundert sei eine Epoche voll Freiheit und Glanz, als sei mit dem Licht der Aufklärung alles Übel der Unterdrückung von der Menschheit abgefallen. Doch dieses Bild wäre einseitig. Die Zeit der Aufklärung, die Zeit des Bürgertums als treibende Kraft, hat ebenso ihre Schattenseiten wie jedes andere Zeitalter auch. Die dunklen Flecken in der Erziehung der nachwachsenden Generation sind nicht plötzlich mit dem Beginn einer neuen Epoche ausradiert.
Um diese dunklen Flecken soll es in der vorliegenden Arbeit gehen, genauer um jenen einen, den wir in der heutigen Terminologie als "Kindesmisshandlung" bezeichnen. Hier soll es vor allem um die Misshandlung im Milieu der bürgerlichen Familie gehen.
Dafür ist es zunächst notwendig, einen historischen Abriss über die Entwicklung des bürgerlichen Familienlebens zu geben, ebenso wie seine Merkmale sowie die typischen Merkmale der (früh-)bürgerlichen Erziehung zu nennen. Nur so kann vermieden werden, alle im vergangenen 18./19. Jahrhundert gängigen Erziehungspraktiken aus heutiger Sicht und mit heutigen Maßstäben zu messen und somit quasi von vornherein als Misshandlung zu kategorisieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Voraussetzungen für die Entstehung der (früh-)bürgerlichen Familie
- Der Begriff der Kindesmisshandlung
- Eingrenzende Definitionen
- Historische Entwicklungen
- Vom „ganzen Haus“ zur bürgerlichen Kernfamilie
- Familie: Produktions- und Lebensgemeinschaft
- Die Rolle der Frau bei der Familienbildung
- Erziehung im Bürgertum
- Zentrale Merkmale (früh-)bürgerlicher Erziehung
- Fallbeispiele (Kurzanalysen)
- Fallbeispiel I: Kälte und Hunger - Elizabeth Grant, Memoirs of a Highland Lady
- Fallbeispiel II: Seelenmord - Der Fall Schreber
- Fallbeispiel III: Tödliche Korrektheit, unterdrückte Sexualität - Fritz Zorn, Mars
- Von der bürgerlichen Kernfamilie zu alternativen Familienformen der Moderne
- Erhöhte Trennungsbereitschaft
- Der Vater als Alleinversorger stirbt aus
- Die Vermischung von privatem und öffentlichem Lebensbereich
- Die Stellung des Kindes innerhalb moderner Familienformen
- Die Stellung des Kindes in der „stabilen“ bürgerlichen Kernfamilie
- Die Stellung des Kindes innerhalb der Stieffamilie
- Die Stellung des Kindes bei einem alleinerziehenden Elternteil (Ein-Eltern-Familie)
- Zusammenhänge zwischen der Auflösung der bürgerlichen Familie und der Misshandlung von Kindern
- Zur Häufigkeit von Misshandlung in der Bundesrepublik Deutschland
- Allgemeine Gründe und Risikofaktoren für Misshandlung in modernen Familienformen
- Kinderstimmen zu Gewalt in der Familie und ihre Erklärungen der Gründe und Folgen
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Misshandlung von Kindern im Milieu der bürgerlichen Familie im 18. und 19. Jahrhundert. Sie beleuchtet die historischen Entwicklungen der bürgerlichen Familie und Erziehung sowie deren Auswirkungen auf die Behandlung von Kindern. Der Fokus liegt dabei auf den Schattenseiten der bürgerlichen Erziehung und der Frage, inwiefern diese zu Misshandlungen führen können.
- Die Entstehung und Entwicklung der bürgerlichen Familie
- Die Merkmale und Auswirkungen der (früh-)bürgerlichen Erziehung
- Der Begriff der Kindesmisshandlung und seine historische Entwicklung
- Fallbeispiele von Kindesmisshandlung in bürgerlichen Familien
- Die Rolle von gesellschaftlichen Normen und Werten in der Entstehung von Kindesmisshandlung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das 'pädagogische Jahrhundert' des 18. Jahrhunderts vor und führt den Leser in die Thematik der Kindesmisshandlung im bürgerlichen Kontext ein. Kapitel 1 beleuchtet die Voraussetzungen für die Entstehung der bürgerlichen Familie und beschreibt die neu gewonnene Privatheit und Freiheit, die gleichzeitig Gefahren und Zerbrechlichkeit mit sich bringen. Kapitel 2 definiert den Begriff der Kindesmisshandlung und zeigt dessen historische und kontextuelle Abhängigkeit auf. Die einzelnen Kapitel 3.1.1 und 3.1.2 befassen sich mit der Entwicklung der bürgerlichen Familie und der Rolle der Frau innerhalb dieser. Kapitel 4 untersucht die zentralen Merkmale der bürgerlichen Erziehung und präsentiert Fallbeispiele von Kindesmisshandlung aus verschiedenen Zeiträumen.
Schlüsselwörter
Kindesmisshandlung, bürgerliche Familie, Erziehung, bürgerliches Jahrhundert, historische Entwicklung, Fallbeispiele, soziale Normen, gesellschaftliche Werte, Familie, Kindheit, Gewalt, Rationalismus, Aufklärung, Individualität, Privatheit.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird das 18. Jahrhundert als "pädagogisches Jahrhundert" bezeichnet?
In der Aufklärung wurde Erziehung zentrales Thema; der Mensch wurde als bildungsfähiges Individuum entdeckt, und pädagogische Reformen rückten in den Fokus der bürgerlichen Gesellschaft.
Was kennzeichnete die Misshandlung in bürgerlichen Familien?
Oft handelte es sich um subtile Formen wie emotionale Kälte, extreme Disziplinierung ("Seelenmord") oder die Unterdrückung natürlicher Bedürfnisse im Namen der Vernunft und Korrektheit.
Welche Rolle spielte der Wandel vom "ganzen Haus" zur Kernfamilie?
Die neu gewonnene Privatheit der Kernfamilie bot Schutz, schuf aber auch einen unkontrollierten Raum, in dem Erziehungspraktiken und Misshandlungen hinter verschlossenen Türen stattfinden konnten.
Was zeigt das Fallbeispiel des "Falls Schreber"?
Es verdeutlicht eine Form der "Schwarzen Pädagogik", bei der durch extreme körperliche und psychische Kontrolle der Wille des Kindes gebrochen werden sollte.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Familienauflösung und Misshandlung heute?
Die Arbeit diskutiert, ob moderne instabile Familienformen und der Verlust bürgerlicher Strukturen neue Risikofaktoren für Gewalt gegen Kinder darstellen.
- Vom „ganzen Haus“ zur bürgerlichen Kernfamilie
- Citar trabajo
- Jasmin Frank (Autor), 2009, "Kindesmisshandlung" im Spiegel der bürgerlichen Gesellschaft, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/152333