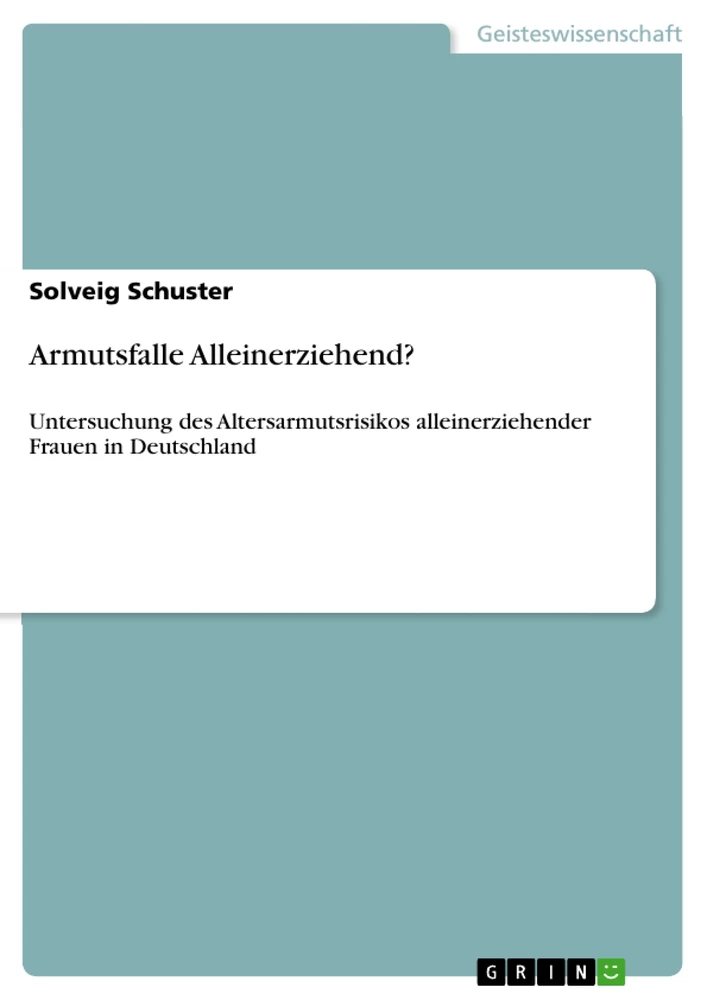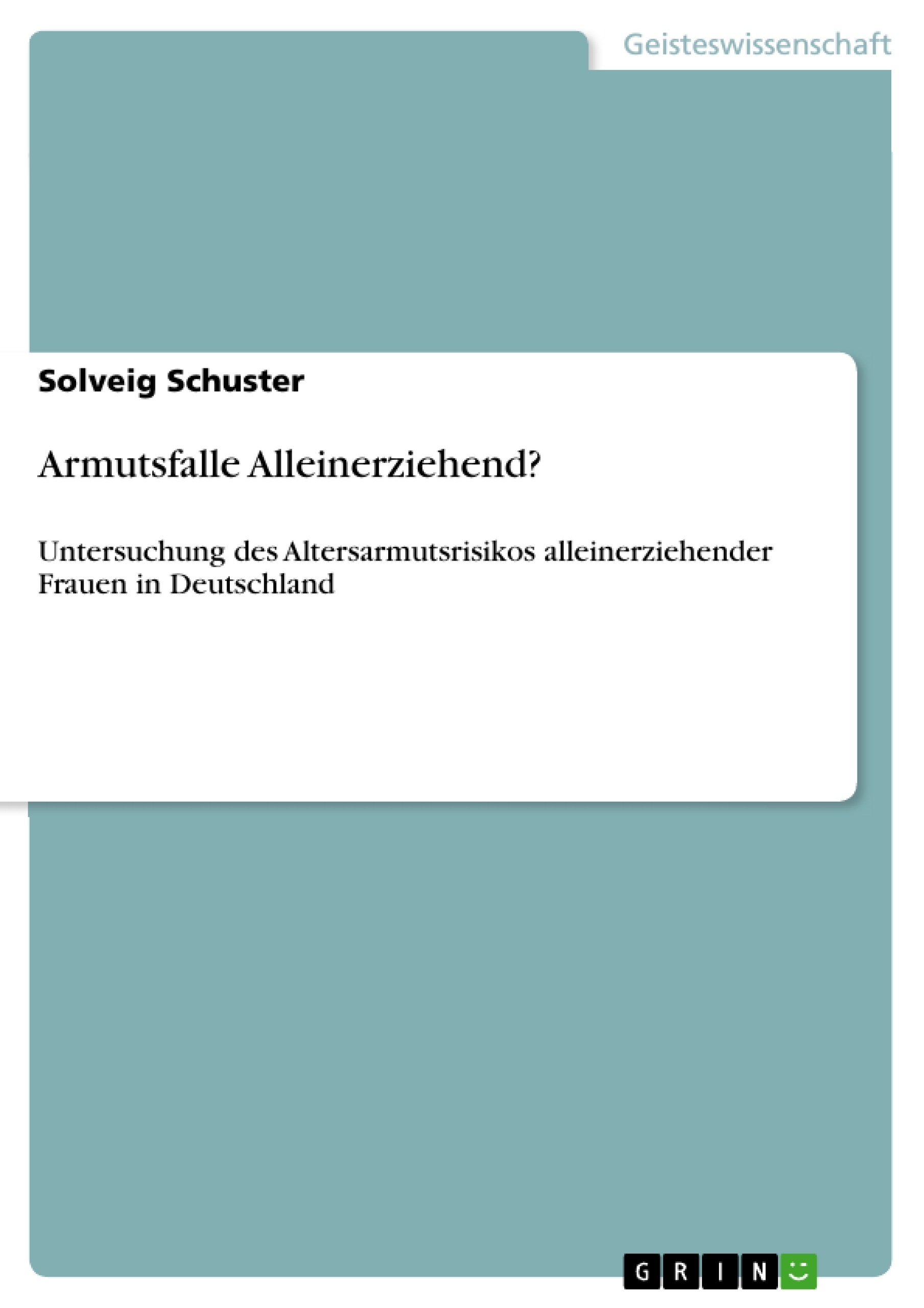Ein dramatischer Geburtenrückgang, steigende Scheidungszahlen und rückläufige Eheschließungen sowie die Zunahme von Haushalten und Lebensgemeinschaften ohne Kinder werden als maßgebliche Hinweise auf die Erosion der gesellschaftlichen Institution Ehe erachtet. Das traditionelle Modell der bürgerlichen Kleinfamilie verliert seine Monopolstellung. Neben den nichtehelichen Lebensgemeinschaften ist in den letzten Jahren auch die Zahl der Einelternfamilien deutlich angewachsen. Zwischen 1979 und 1996 erhöhte sich der Anteil der Alleinerziehenden in den Altbundesländern von etwa 6 auf 12,6 Prozent und stieg bis zum Jahr 2006 weiter bis auf 17 Prozent an (Statistisches Bundesamt, 2008, S. 7). Heute sind fast ein Fünftel aller Familien Einelternfamilien. Alleinerziehen stellt längst eine gesellschaftliche Realität dar, die Ausdruck der Pluralisierung von Familienformen und Lebensstilen ist (Deutscher Bundestag, 16/10257).
In Literatur und Wissenschaft finden sich mittlerweile diverse Studien, die die Lebenssituation Alleinerziehender umreißen und ein umfassendes Bild darüber vermitteln, welchen Belastungen Alleinerziehende, insbesondere auch als alleiniger Haushaltsvorstand in finanzieller Hinsicht mit all seinen Folgeerscheinungen ausgesetzt sind. Insbesondere am Arbeitsmarkt sind Alleinerziehende aufgrund ihrer Lebenssituation benachteiligt. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gestaltet sich generell für Einelternfamilien schwierig (ebenda). Dies spiegelt sich in geringem Einkommen, überproportionaler Arbeitslosigkeit und einem erhöhten Armutsrisiko. Wie der 3. Armuts- und Reichtumsbericht zeigt, sind insbesondere Alleinerziehende und ihre Kinder deutlich stärker als andere Gruppen von Einkommensarmut betroffen. Mehr als ein Viertel (26 Prozent) der in Familien mit alleinerziehendem Elternteil lebenden Bevölkerung war im Jahr 2005 armutsgefährdet, in Familien mit mindestens zwei Erwachsenen dagegen höchstens jeder Elfte (9 Prozent, Statistisches Bundesamt, 2008a, S. 9). Häufig leben Kinder in relativer Armut, weil ihre Eltern oder andere, die sie unterstützen, nicht in der Lage sind, die notwendige materielle Sicherheit zu gewährleisten, um unabhängig von staatlichen Unterstützungsleistungen leben zu können. Kinderarmut ist demnach familiäre Armut. Zu 35 bis 40 Prozent betrifft sie Kinder in Einelternfamilien (Bertram, 2008a, S. 20).
Doch was heißt das für die Zukunft? Werden die Armen von heute auch die Armen von morgen sein?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ehe und Familie im Wandel
- Einelternfamilien in Deutschland
- Im Spiegel der Statistik
- Definition
- Alter und Haushaltsgröße
- Familienstand
- Bildung
- Verweildauer im Status „allein erziehend"
- Erwerbsleben von Einelternfamilien
- Chancen und Teilhabe
- Arbeitslosigkeit
- Familienpolitische Konzepte zur Förderung der Erwerbsarbeit
- Einkommens- und Lebenssituation
- Staatliche Leistungen und Transfers
- Haushaltseinkommen
- Kinder in Einelternfamilien
- Wohnsituation
- Gesundheitliche Risiken
- Soziale Netze und Hilfsangebote
- Finanzielle Situation von Frauen im Alter – staatliche Unterstützung und private Vorsorge
- Die gesetzliche Rente
- Aufbau und Finanzierung
- Probleme der Rentenversicherung
- Altersvorsorge von Frauen
- Förderung der eigenständigen Absicherung
- Höhe und Entwicklung der Zahlbeträge der gesetzlichen Rente
- Hinzuverdienst,Rente wegen Arbeitslosigkeit und Altersteilzeit
- Rente wegen Erwerbsminderung
- Bedarfsorientierte Grundsicherung
- Beamtenversorgung
- Privat- und Betriebsvorsorge
- Haushaltseinkommen von Frauen im Alter
- Aktuelle wirtschaftliche Lage der Rentnerinnen
- Projizierte Netto-Alteseinkommen
- Vererbung und Vermögen
- Armut in Deutschland
- Definitionen und Dimensionen
- Wissenschaftliche Ansätze und Konzepte
- Armuts- und Reichtumsbericht
- Deutschland im europäischen Vergleich
- Indikatoren der Altersarmut
- Risiko von Alleinerziehenden
- Abkürzungsverzeichnis
- Glossar
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Untersuchung und Analyse des Altersarmutsrisikos alleinerziehender Frauen in Deutschland. Ziel ist es, die besonderen Herausforderungen und Risiken dieser Gruppe im Hinblick auf die finanzielle Absicherung im Alter zu beleuchten. Dabei werden die spezifischen Lebenslagen und die soziale Situation von Alleinerziehenden im Kontext der demografischen Entwicklung und der aktuellen Familienpolitik betrachtet.
- Soziale und wirtschaftliche Situation von Alleinerziehenden in Deutschland
- Herausforderungen und Risiken der Altersarmut für alleinerziehende Frauen
- Analyse der staatlichen und privaten Altersvorsorge im Hinblick auf die Bedürfnisse von Alleinerziehenden
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der finanziellen Absicherung von Alleinerziehenden im Alter
- Bedeutung von Familienpolitik und sozialer Sicherungssysteme für die Prävention von Altersarmut
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Altersarmut von Alleinerziehenden ein und skizziert die Relevanz des Themas im Kontext der demografischen Entwicklung und der aktuellen Familienpolitik. Sie stellt die Forschungsfrage und die methodische Vorgehensweise der Arbeit dar.
Das Kapitel „Ehe und Familie im Wandel" beleuchtet die Veränderungen in den Familienstrukturen und die wachsende Bedeutung von Einelternfamilien in Deutschland. Es analysiert die Ursachen für die Zunahme von Einelternfamilien und die damit verbundenen Herausforderungen für die Gesellschaft.
Das Kapitel „Einelternfamilien in Deutschland" untersucht die sozioökonomische Situation von Einelternfamilien in Deutschland. Es analysiert die Lebensbedingungen, die Erwerbsbeteiligung und die finanzielle Situation von Alleinerziehenden. Dabei werden die spezifischen Herausforderungen und Risiken von Alleinerziehenden im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Armutsgefährdung und die soziale Integration beleuchtet.
Das Kapitel „Finanzielle Situation von Frauen im Alter – staatliche Unterstützung und private Vorsorge" befasst sich mit der Altersvorsorge von Frauen in Deutschland. Es analysiert die Funktionsweise der gesetzlichen Rentenversicherung und die Möglichkeiten der privaten Altersvorsorge. Dabei werden die besonderen Herausforderungen von Frauen im Hinblick auf die Altersarmut, die Rentenhöhe und die Finanzierung der Altersvorsorge betrachtet.
Das Kapitel „Armut in Deutschland" definiert den Begriff der Armut und analysiert die Ursachen und Folgen von Armut in Deutschland. Es beleuchtet die Armutsgefährdung von Alleinerziehenden und die Rolle der Sozialpolitik bei der Armutsbekämpfung.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Altersarmut, Alleinerziehende, Frauen, Familienpolitik, soziale Sicherungssysteme, Rentenversicherung, private Altersvorsorge, Armut, Einkommensungleichheit, demografischer Wandel, Familienstrukturen, Erwerbsbeteiligung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Lebensbedingungen, soziale Integration, Handlungsempfehlungen.
Häufig gestellte Fragen
Warum haben Alleinerziehende ein höheres Armutsrisiko?
Gründe sind die schwierige Vereinbarkeit von Familie und Beruf, überproportionale Arbeitslosigkeit, geringeres Einkommen durch Teilzeitarbeit und die oft alleinige Last der Haushaltsfinanzierung.
Wie hoch ist die Armutsgefährdung bei Einelternfamilien?
Laut Statistiken sind etwa 26 % bis über ein Drittel der Alleinerziehenden und ihrer Kinder von Armut betroffen, was deutlich über dem Durchschnitt von Paarfamilien liegt.
Welche Folgen hat die aktuelle Lebenslage für die Rente?
Durch Erwerbsunterbrechungen und geringere Einzahlungen droht alleinerziehenden Frauen im Alter eine niedrige gesetzliche Rente, was das Risiko für Altersarmut massiv erhöht.
Was sind familienpolitische Konzepte zur Unterstützung?
Dazu gehören der Ausbau der Kinderbetreuung, staatliche Transferleistungen (wie Unterhaltsvorschuss) und steuerliche Entlastungen, um die Erwerbstätigkeit Alleinerziehender zu fördern.
Welche zusätzlichen Belastungen gibt es neben den Finanzen?
Alleinerziehende tragen oft ein höheres gesundheitliches Risiko durch Stress und haben weniger Zeit für soziale Netze, was die psychische Belastung weiter verstärken kann.
- Quote paper
- Lic. rer. publ. Solveig Schuster (Author), 2010, Armutsfalle Alleinerziehend?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/152414